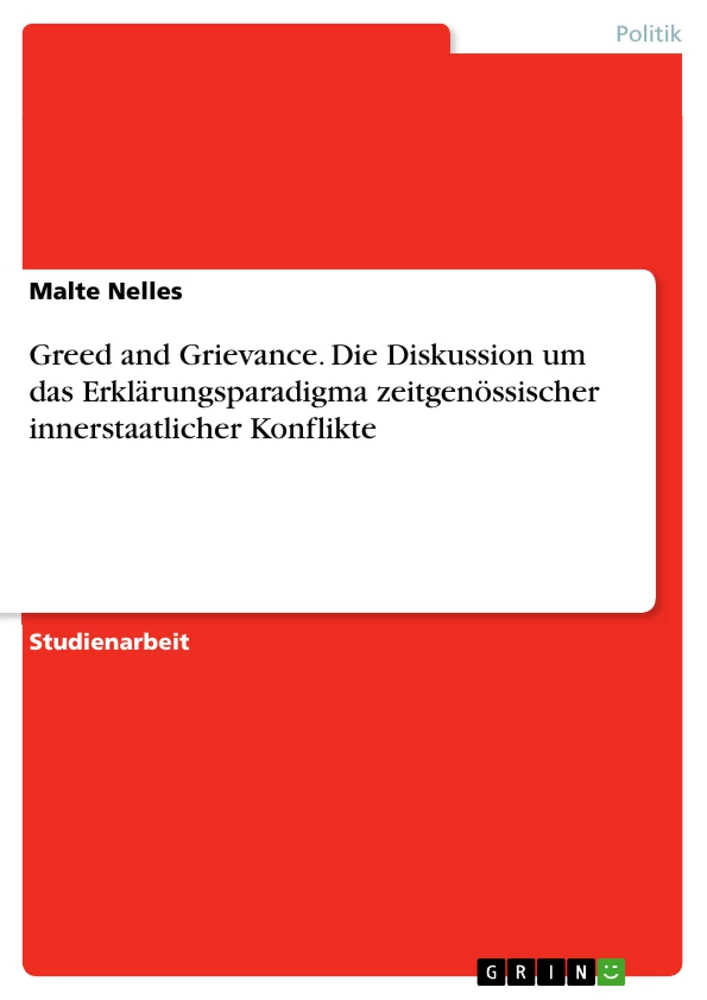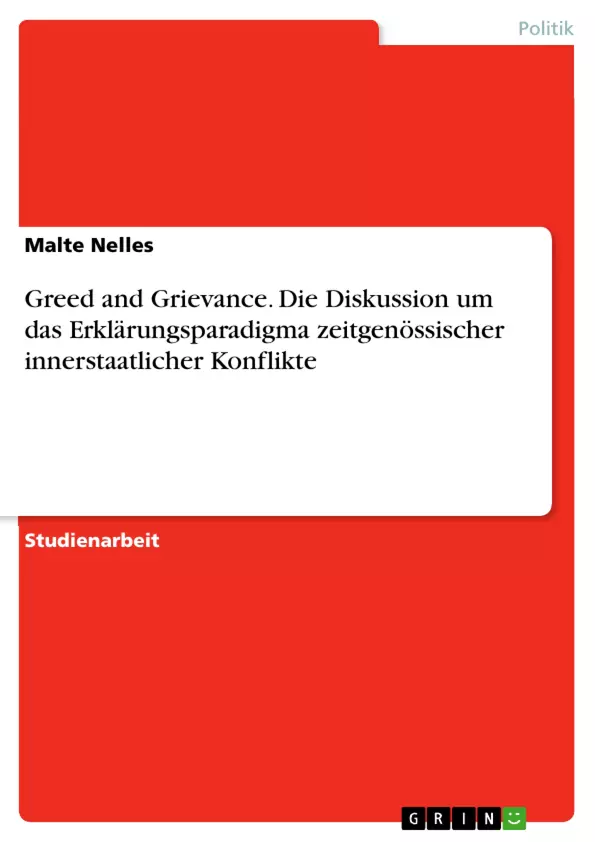Ziel dieser Hausarbeit soll es sein, die zentralen Prämissen der "Greed and Grievance"-Debatte darzustellen, sie kritisch zu diskutieren und die makrotheoretischen Grundlagen beider Erklärungsansätze aufzuzeigen. Die Struktur der Arbeit und die spezifischen Forschungsfragen stellen sich wie folgt dar:
In einem ersten Schritt soll möglichst kurz auf die wichtigsten Rahmenbedingungen des aktuellen Konfliktgeschehens eingegangen werden. Sie nehmen im Kontext dieser Arbeit "nur" die Rolle von Rahmenbedingungen ein, da die "Greed and Grievance"-Debatte auf der Akteursebene ansetzt und die makrostrukturellen Determinanten der Konflikte als unabhängige Variablen voraussetzt. Bei dem Forschungsgegenstand handelt es sich somit nicht um eine "kritische" [Wie etwa bei Fricke], politökonomische oder wie auch immer genannte an Marx orientierte Form der Sozialwissenschaft. Es wird nicht, wie etwa bei der "Hamburger Schule" [Vgl. Siegelberg, Jung, Schlichte], versucht, einen ganzheitlichen theoretischen Rahmen zu erschaffen, in dem nicht die Konflikte selbst untersucht werden, sondern ihre Einbettung. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle keine tiefer greifende Analyse der "Rahmenbedingungen" in Angriff genommen werden, sondern nur allgemeine Erkenntnisse aus den Forschungsfeldern dargestellt werden. Konkret bedeutet das, dass sowohl die Folgen der Globalisierung als auch die damit verbundene Veränderung der Staatlichkeit angesprochen werden.
Der Kern der Arbeit beschäftigt sich mit den Inhalten von "Greed" und "Grievance". Hierbei sollen beide Argumentationslinien getrennt untersucht und kritisch hinterfragt werden. Dabei wird ein chronologischer Vorgang gewählt, das heißt der Faktor "Grievance" wird zuerst dargestellt. Da er jedoch in keinerlei Hinsicht ein einheitliches Konzept darstellt, sondern von den Greed-Theoretikern als schemenhaftes Abgrenzungsobjekt konstruiert wurde, soll dieser Logik im Sinne der Diskussion gefolgt werden und thematisch (und nicht autorenorientiert) auf die grundsätzlichen Aussagen eingegangen werden. Im Anschluss soll die ökonomische Analyse und ihre Auseinandersetzung mit der politischen (politologischen) Argumentation untersucht und hinsichtlich ihrer empirischen Evidenz beleuchtet werden.
Der wissenschaftliche Schwerpunkt der Hausarbeit liegt auf einer theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema, es soll jedoch auch vereinzelt auf die Ergebnisse von empirischen Fallanalysen und statistischen Erhebungen verwiesen werden.
Ergebnis der Arbeit soll eine idealtypische Darstellung der Dichotomie von "Greed" und "Grievance" in Form einer Tabelle sein. Hierbei kommt es darauf an, die grundlegenden Aussagen vereinfacht gegenüberzustellen.
Im Fazit erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit der Gesamtdiskussion. Hierbei wird die These vertreten werden, dass "Greed" und "Grievance" für sich alleine genommen keine hinreichende theoretische wie auch empirische Überzeugungskraft entfalten können, sondern qua natura einander bedingen und interagieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Rahmenbedingungen innerstaatlicher Konflikte
- Die Globalisierung
- Die ökonomische Dimension
- Die soziokulturelle Fragmentierung
- Die Rolle des Staates
- Der Staatszerfall und das Erbe des Kolonialismus
- Die Privatisierung der Gewalt
- Die Globalisierung
- Die ,,Greed and Grievance\"-Debatte
- Der Erklärungsansatz „Grievance“
- Etnizität als Kriegsursache
- Theoretische Grundperspektiven und Kriegsverständnis
- Kritische Einwände zur Grievance-Perspektive
- Der Erklärungsansatz „Greed“
- Paul Colliers Weltbankreport
- Elwerts sozialanthropologischer Ansatz der Gewaltmärkte
- Theoretische Grundannahmen und Kriegsverständnis
- Kritische Einwände zur ökonomischen Kriegsanalyse
- Methodische Schwächen des Greed-Ansatzes
- Die Depolitisierungstendenz ökonomischer Kriegsanalysen
- Tabelle: Idealtypische Gegenüberstellung „Greed and Grievance“
- Der Erklärungsansatz „Grievance“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der „Greed and Grievance“-Debatte, welche die dominierende Motivation von Akteuren in zeitgenössischen Bürgerkriegen untersucht. Ziel ist es, die zentralen Prämissen beider Erklärungsansätze, „Greed“ und „Grievance“, darzustellen, kritisch zu diskutieren und ihre makrotheoretischen Grundlagen aufzuzeigen. Im Fokus stehen die Herausforderungen der Globalisierung und der Staatszerfall, sowie die Rolle von Ethnizität und Ökonomie als Triebkräfte für Konflikte.
- Die Rolle der Globalisierung als Rahmenbedingung für innerstaatliche Konflikte
- Die Auswirkungen des Staatszerfalls und des Erbes des Kolonialismus auf die Entstehung von Kriegen
- Die „Greed and Grievance“-Debatte und die Kontroverse um die Motivation von Kriegsparteien
- Die Bedeutung von ethnischen Faktoren als potenzielle Ursachen für Konflikte
- Die ökonomischen Aspekte von Bürgerkriegen und die Kritik an der Depolitisierungstendenz ökonomischer Analysen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext der „Greed and Grievance“-Debatte dar und zeigt die Verschiebung von geostrategischen Stellvertreterkriegen hin zu Bürgerkriegen in der dritten Welt auf. Sie beleuchtet die Rolle der Globalisierung und des Staatszerfalls als Rahmenbedingungen für Konflikte.
Das erste Kapitel analysiert die Rahmenbedingungen innerstaatlicher Konflikte, wobei die Auswirkungen der Globalisierung und die Rolle des Staates im Fokus stehen. Es werden die ökonomischen und soziokulturellen Dimensionen der Globalisierung sowie der Staatszerfall und die Privatisierung der Gewalt beleuchtet.
Im zweiten Kapitel wird die „Greed and Grievance“-Debatte in ihren zentralen Argumentationslinien untersucht. Es werden die „Grievance“-Perspektive und ihre kritischen Einwände, sowie die „Greed“-Perspektive und ihre methodischen Schwächen und die Depolitisierungstendenz ökonomischer Analysen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: „Greed and Grievance“, innerstaatliche Konflikte, Globalisierung, Staatszerfall, Ethnizität, Ökonomie, Kriegsursachen, Bürgerkrieg, Machtpolitik, Politikwissenschaft, sozialanthropologischer Ansatz, Gewaltmärkte, theoretische Grundlagen, empirische Evidenz, kritische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die "Greed and Grievance"-Debatte?
Es ist eine wissenschaftliche Kontroverse darüber, ob innerstaatliche Konflikte primär durch ökonomische Gewinnabsichten ("Greed") oder durch soziale und politische Ungerechtigkeiten ("Grievance") motiviert sind.
Was besagt der "Greed"-Ansatz von Paul Collier?
Collier argumentiert, dass Bürgerkriege dort entstehen, wo Rebellen die Möglichkeit haben, sich durch Rohstoffe oder illegale Märkte zu finanzieren, unabhängig von politischen Zielen.
Was sind typische "Grievances" als Kriegsursachen?
Dazu gehören ethnische Diskriminierung, religiöse Unterdrückung, soziale Ungleichheit und der Mangel an politischer Teilhabe.
Welchen Einfluss hat die Globalisierung auf Bürgerkriege?
Globalisierung schafft neue ökonomische Anreize durch Weltmärkte für Rohstoffe, kann aber auch zur soziokulturellen Fragmentierung und zum Staatszerfall beitragen.
Warum wird der rein ökonomische Ansatz kritisiert?
Kritiker werfen dem "Greed"-Ansatz eine Depolitisierung vor, da er die legitimen Beschwerden der Bevölkerung ignoriert und komplexe Konflikte auf kriminelle Energie reduziert.
Bedingen sich "Greed" und "Grievance" gegenseitig?
Ja, die Arbeit vertritt die These, dass beide Faktoren meist interagieren: Ungerechtigkeiten schaffen die Basis für Mobilisierung, während ökonomische Ressourcen den Krieg finanzierbar machen.
- Quote paper
- Malte Nelles (Author), 2004, Greed and Grievance. Die Diskussion um das Erklärungsparadigma zeitgenössischer innerstaatlicher Konflikte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43411