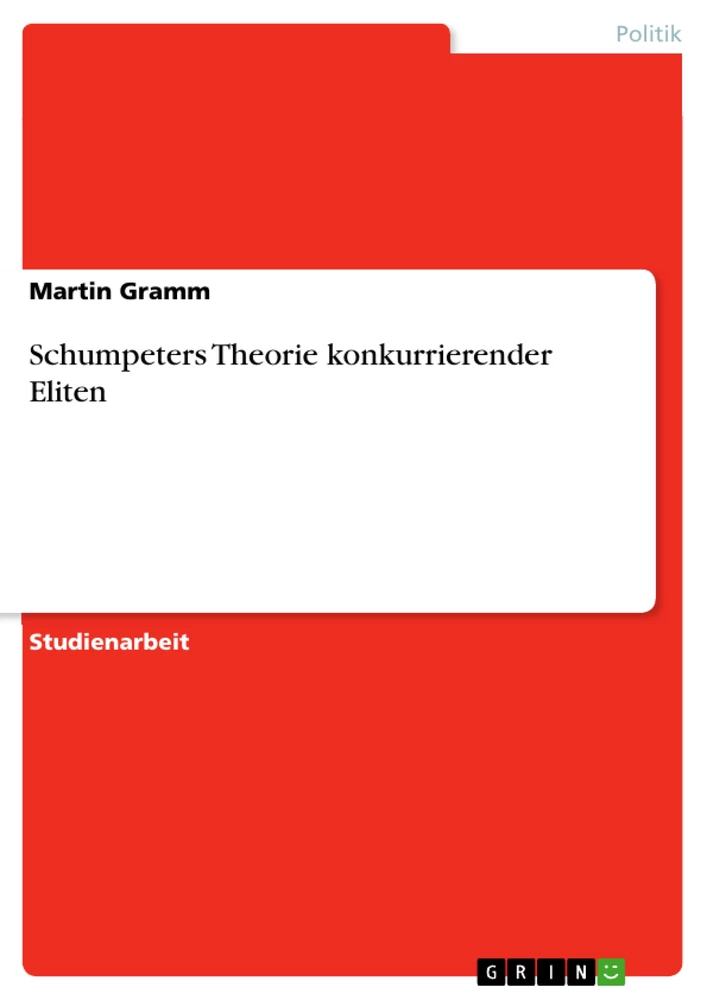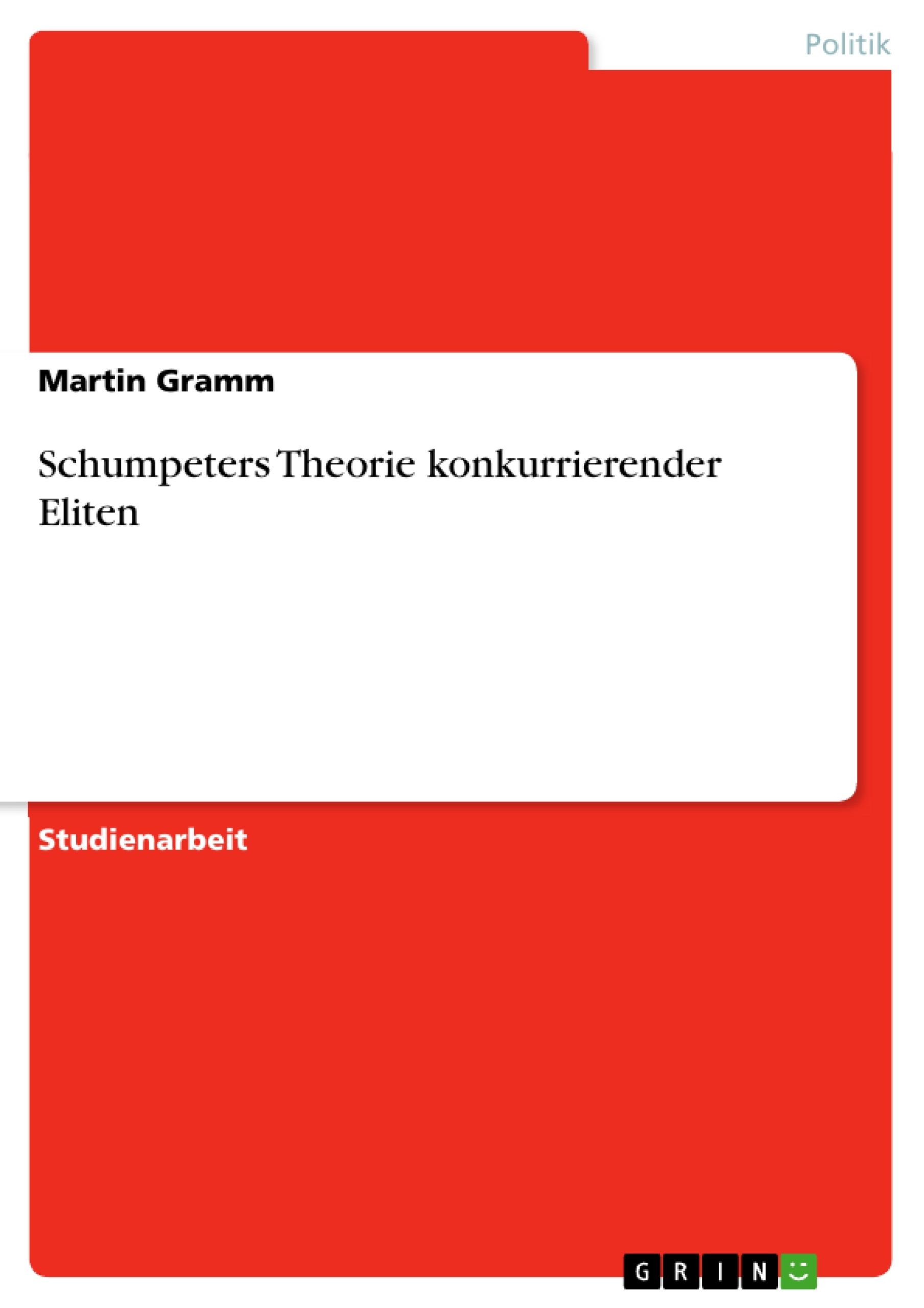Aufbauend auf die Gedanken Max Webers hat der 1883 in Triesch geborene Nationalökonom Joseph Alois Schumpeter im vierten Teil seines Werkes Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie den Grundstein für die realistische Demokratielehre gelegt. Primär sollte diese Theorie auf Kompatibilität mit dem Sozialismus untersucht werden und hielt somit den Fokus nicht in erster Linie auf die Demokratie selbst und obwohl Schumpeter in seinem Werk Gedanken aus fast allen seinen früheren Schriften aufgreift, ist zu beachten, dass es vor dem speziellen Hintergrund des Zweiten Weltkriegs und der Weltwirtschaftskrise entstanden ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Herleitung Schumpeters Demokratietheorie
- Das Denkexperiment
- Ablehnung der klassischen Lehre
- Schumpeters Menschenbild
- Die Elitendemokratie
- Methode und Markt
- Ausgestaltung der Elitendemokratie
- Voraussetzungen der Elitendemokratie
- Eliten
- Vorteile gegenüber der klassischen Demokratielehre
- Kritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Demokratietheorie von Joseph Alois Schumpeter. Sie analysiert die Entstehung und den Inhalt dieser Theorie, die auf einem realistischen, empirisch erfahrbaren Ansatz beruht. Insbesondere wird untersucht, wie Schumpeter die Demokratie als Markt und Methode konzipiert und welche Rolle die Schlagwörter 'Markt', 'Methode', 'Politiker' und 'Wähler*innen' in diesem Zusammenhang spielen.
- Schumpeters Kritik an der klassischen Demokratielehre
- Die Elitendemokratie als Alternative zur direkten Demokratie
- Das Konzept des politischen Wettbewerbs und der Auswahl von Führungspersonal
- Die Bedeutung von 'Markt' und 'Methode' in Schumpeters Demokratietheorie
- Die Rolle von Wähler*innen und Politiker*innen in der Elitendemokratie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt Schumpeters Demokratietheorie im Kontext seines Werkes "Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie" vor und skizziert die wichtigsten Aspekte seiner Theorie. Sie erläutert, dass Schumpeter eine realistische und empirisch erfahrbare Demokratie konzipiert, die sich auf politische Führung und den marktwirtschaftlichen Wettbewerb konzentriert.
- Herleitung Schumpeters Demokratietheorie: Dieses Kapitel untersucht, wie Schumpeter zu seiner Demokratietheorie gelangt. Zunächst beschreibt es sein Denkexperiment, das zeigt, dass die klassische Lehre der Demokratie in der Praxis nicht realisierbar ist. Anschließend werden Schumpeters Kritikpunkte an der klassischen Lehre und seine Ablehnung des Begriffs des Gemeinwohls erläutert.
- Die Elitendemokratie: Das dritte Kapitel stellt Schumpeters eigene Demokratietheorie, die Elitendemokratie, vor. Es behandelt die Konzepte von 'Markt' und 'Methode' und erläutert die Voraussetzungen und Funktionsweise der Elitendemokratie.
Schlüsselwörter
Schumpeters Demokratietheorie, Elitendemokratie, klassische Demokratielehre, Markt, Methode, Wettbewerb, politische Führung, Wähler*innen, Politiker*innen, Gemeinwohl.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Schumpeters Theorie der Elitendemokratie?
Schumpeter definiert Demokratie nicht als Herrschaft des Volkes, sondern als eine Methode, bei der politische Eliten in einem Wettbewerb um die Stimmen der Wähler konkurrieren.
Warum lehnt Schumpeter die "klassische Lehre" der Demokratie ab?
Er hält den Begriff des "Gemeinwohls" für unrealistisch und argumentiert, dass Wähler oft irrational handeln und politische Entscheidungen primär von Führungspersönlichkeiten getroffen werden.
Wie vergleicht Schumpeter Politik mit einem Markt?
In seiner Theorie sind Politiker die "Anbieter" von Programmen und Führung, während Wähler die "Konsumenten" sind, die durch ihre Wahlentscheidung über das Personal bestimmen.
Welche Rolle haben Wähler in der Elitendemokratie?
Die Rolle der Wähler beschränkt sich primär auf die Auswahl und Abwahl des Führungspersonals, nicht auf die direkte Mitbestimmung bei Sachfragen.
In welchem historischen Kontext entstand Schumpeters Werk?
Sein Hauptwerk "Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie" entstand vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs und der Weltwirtschaftskrise.
- Citar trabajo
- Martin Gramm (Autor), 2018, Schumpeters Theorie konkurrierender Eliten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/434830