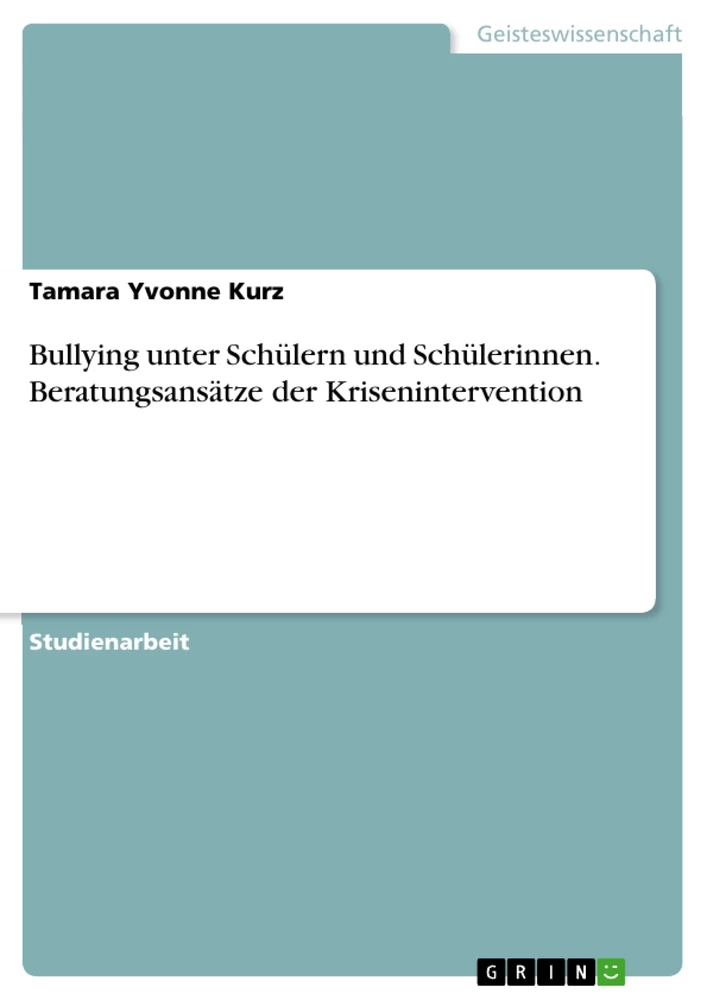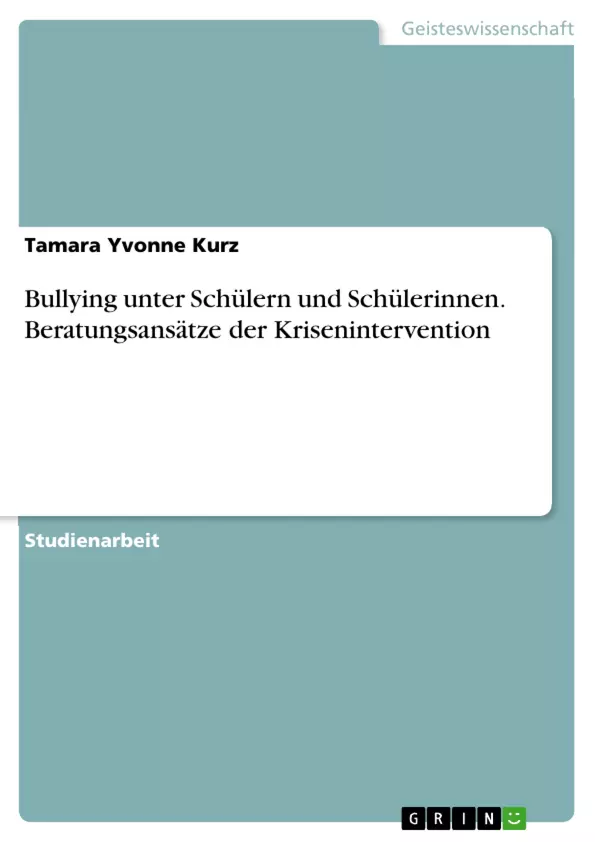Der Begriff Krise wird heutzutage fast schon inflationär verwendet. Wahrscheinlich hat jeder bereits Sätze wie „Ich bekomm `ne Krise!“ gesagt. Jedoch ist eine Krise ein sehr schwerwiegendes Thema, das den jeweiligen Menschen stark belastet. Doch was ist eine Krise genau? Welche Krisen gibt es? In welchen Situationen können diese auftreten und was braucht der Mensch, um sie bewältigen zu können? Gibt es Menschen, die hierfür sozusagen prädestiniert sind? Auf diese und weitere Fragen wird im Folgenden eingegangen. Hierzu werden verschiedene theoretische Konzepte in Bezug auf Krisen und in Bezug auf die Frage der Prädestination das Verletzlichkeits-Stress-Modell, vorgestellt.
Im zweiten Teil wird auf die Krise im Kontext von Bullying unter Schülern in Form einer Falldiskussion eingegangen. Hierzu wird ein Fallbeispiel zum Thema Bullying an der Schule mit anschließender Analyse, Interpretation und Interventions- bzw. Beratungsmöglichkeiten angeführt. Im letzten Teil wird ein Gesamtfazit zum Thema Krisenintervention unter Bezugnahme des Bullyings gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Hinführung
- II. Grundlagen
- II.1 Definition und Spezifizierung von Krisen
- II.2 Konzepte
- II.3 Verletzlichkeits- Stress-Modell
- III. Krise im Kontext Bullying
- III.1 Fallbeispiel
- III.2 Analyse und Interpretation
- III.2.1 Spiralmodell von Erika Schuchardt
- III.2.2 Konzept „Kritische Lebenslagen“
- III.3 Interventions- und Beratungsmöglichkeiten
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Krisenintervention, insbesondere im Kontext von Bullying unter Schülern. Ziel ist es, verschiedene Konzepte und Modelle der Krisenbewältigung vorzustellen und deren Anwendbarkeit auf Situationen von Mobbing zu beleuchten. Ein Fallbeispiel dient der Veranschaulichung und Analyse der Thematik.
- Definition und Spezifizierung von Krisen
- Theoretische Konzepte zur Krisenbewältigung
- Bullying als Auslöser von Krisen
- Analyse eines Fallbeispiels zum Thema Mobbing
- Interventions- und Beratungsmöglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
I. Hinführung: Die Einleitung thematisiert den weit verbreiteten, jedoch oft oberflächlichen Gebrauch des Begriffs „Krise“. Sie führt die zentralen Fragen der Arbeit ein: Was ist eine Krise genau? Welche Arten von Krisen gibt es? Wie entstehen sie und wie können sie bewältigt werden? Die Einleitung stellt die Struktur der Arbeit vor, die verschiedene theoretische Konzepte im Hinblick auf Krisen und das Verletzlichkeits-Stress-Modell vorstellt, ein Fallbeispiel zum Thema Bullying analysiert und schließlich ein Fazit zur Krisenintervention im Kontext von Mobbing zieht.
II. Grundlagen: Dieses Kapitel widmet sich der Definition und Spezifizierung von Krisen. Es werden verschiedene Definitionsversuche von Fachleuten vorgestellt, die zwischen latenten und akuten Krisen, sowie verschiedenen Arten von Krisen (psychosozial, psychiatrisch, traumatisch, suizidal etc.) unterscheiden. Das Kapitel beleuchtet verschiedene Konzepte, die das Verständnis von Krisen erweitern, untersucht die Rolle kritischer Lebensereignisse als Auslöser und betont die subjektive Bewertung von Situationen als krisenhaft. Es werden die Bedeutung von Selbstwertgefühl, Ressourcen und Bewältigungsstrategien für die Krisenbewältigung ausführlich diskutiert.
III. Krise im Kontext Bullying: Dieses Kapitel untersucht das Thema Bullying als Auslöser von Krisen. Durch die Analyse eines Fallbeispiels von Mobbing an der Schule werden die Problematik und die möglichen Folgen für die betroffenen Schüler veranschaulicht. Hier werden das Spiralmodell von Erika Schuchardt und das Konzept „Kritische Lebenslagen“ als analytische Werkzeuge eingesetzt um die Situation zu verstehen. Der Schwerpunkt liegt auf der Identifizierung von Interventions- und Beratungsmöglichkeiten, die den Betroffenen helfen können, die Krise zu bewältigen.
Schlüsselwörter
Krise, Krisenintervention, Bullying, Mobbing, Schüler, Verletzlichkeits-Stress-Modell, kritische Lebensereignisse, Bewältigungsstrategien, Ressourcen, Selbstwertgefühl, Intervention, Beratung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Krisenintervention im Kontext von Bullying
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Krisenintervention, insbesondere im Kontext von Bullying unter Schülern. Sie bietet eine Einführung in das Thema, erläutert grundlegende Konzepte der Krisenbewältigung und analysiert ein Fallbeispiel von Mobbing. Zusätzlich werden Interventions- und Beratungsmöglichkeiten vorgestellt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Hinführung zum Thema, ein Kapitel zu den Grundlagen der Krisendefinition und -bewältigung, ein Kapitel zur Krise im Kontext von Bullying mit Fallbeispielanalyse und schließlich ein Fazit. Innerhalb der Kapitel werden verschiedene Unterpunkte detailliert behandelt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, verschiedene Konzepte und Modelle der Krisenbewältigung vorzustellen und deren Anwendbarkeit auf Situationen von Mobbing zu beleuchten. Ein Fallbeispiel dient der Veranschaulichung und Analyse der Thematik.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Definition und Spezifizierung von Krisen, theoretische Konzepte zur Krisenbewältigung, Bullying als Auslöser von Krisen, Analyse eines Fallbeispiels zum Thema Mobbing und Interventions- und Beratungsmöglichkeiten.
Welche Konzepte und Modelle werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Definitionsversuche von Krisen, das Verletzlichkeits-Stress-Modell, das Spiralmodell von Erika Schuchardt und das Konzept „Kritische Lebenslagen“. Diese werden im Kontext von Bullying und dessen Bewältigung diskutiert.
Wie wird das Thema Bullying behandelt?
Bullying wird als Auslöser von Krisen untersucht. Ein Fallbeispiel veranschaulicht die Problematik und möglichen Folgen von Mobbing für betroffene Schüler. Die Analyse dieses Fallbeispiels nutzt die vorgestellten Konzepte zur Erklärung der Situation.
Welche Interventions- und Beratungsmöglichkeiten werden aufgezeigt?
Das dritte Kapitel widmet sich explizit der Identifizierung von Interventions- und Beratungsmöglichkeiten, die Betroffenen bei der Bewältigung von Krisen im Zusammenhang mit Mobbing helfen sollen. Konkrete Methoden werden jedoch nicht detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Krise, Krisenintervention, Bullying, Mobbing, Schüler, Verletzlichkeits-Stress-Modell, kritische Lebensereignisse, Bewältigungsstrategien, Ressourcen, Selbstwertgefühl, Intervention und Beratung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema einführt und die Struktur der Arbeit vorstellt. Es folgen Kapitel zu den Grundlagen, Bullying im Kontext von Krisen und schließlich ein Fazit. Innerhalb der Kapitel wird eine logische und nachvollziehbare Struktur mit Unterpunkten verfolgt.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Die Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, welches sich mit den Themen Krisenintervention und Bullying auseinandersetzen möchte. Der Fokus liegt auf der theoretischen Analyse und der Anwendung von Modellen.
- Arbeit zitieren
- Tamara Yvonne Kurz (Autor:in), 2018, Bullying unter Schülern und Schülerinnen. Beratungsansätze der Krisenintervention, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/435220