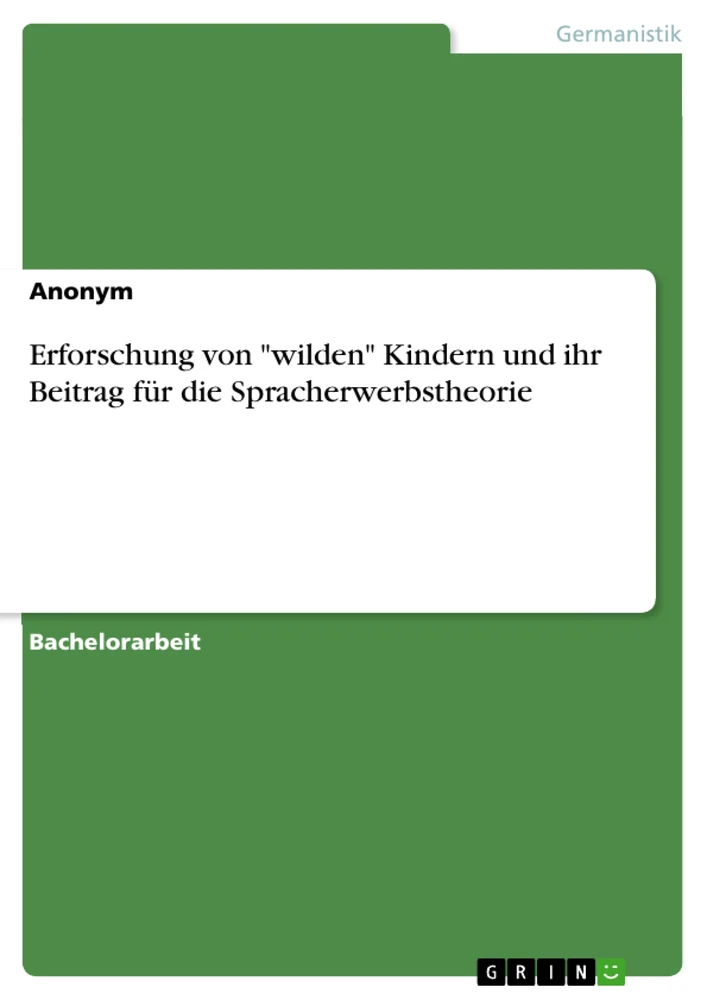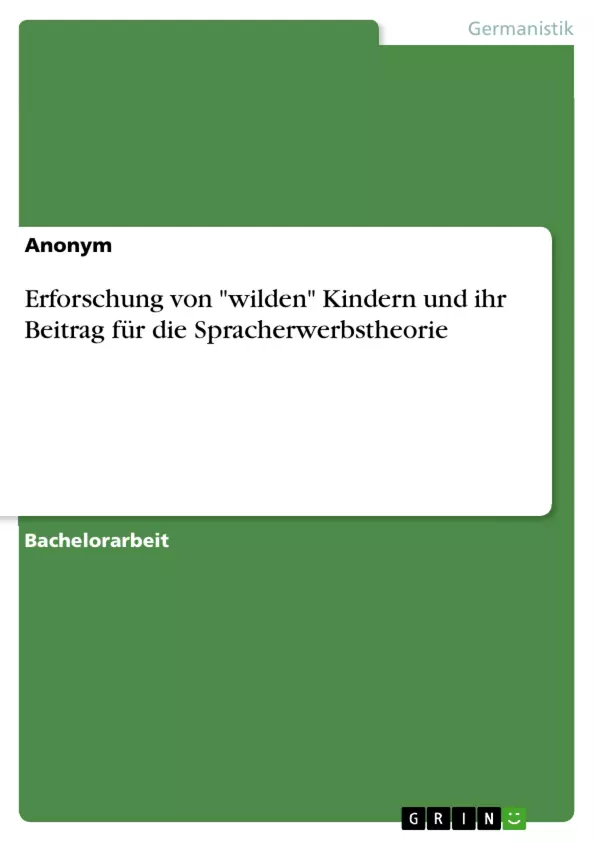Als generelle Voraussetzung, um überhaupt Sprache erwerben zu können, ist ein Säugling mit Fähigkeiten ausgestattet, wie zum Beispiel Dinge wahrnehmen, voneinander unterscheiden und sie im Gedächtnis behalten zu können. Schon von Beginn an versucht der Mensch die Dinge, die er wahrnimmt, in Kategorien zu ordnen, diese Fähigkeit ist für den Spracherwerb sehr wichtig.
Kinder mit späteren Sprachproblemen weisen oft Defizite in diesen sogenannten Vorausläuferfähigkeiten auf. Bei den "wilden" Kindern muss man berücksichtigen, will man ihren Sprachstand untersuchen und feststellen, wie viel sie sprachlich erreichen können, obwohl sie ohne sprachlichen Input aufgewachsen sind, welche sprachlichen Fähigkeiten, sowohl im aktiven Gebrauch als auch in der Rezeption, schon von Geburt an vorhanden sind, um genau sagen zu können, wie wichtig äußerer sprachlicher Einfluss für den Spracherwerb ist.
Diese Arbeit versucht, anhand von vorhandenen Daten zu "wilden" Kindern, den Wahrheitsgehalt der vorhandenen Spracherwerbstheorien zu erforschen und zusammenzufassen.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Kurze Einführung in die 4 Spracherwerbstheorien
- 1.1 Behaviorismus
- 1.2 Nativismus
- 1.3 Kognitivismus (konstruktivistischer Ansatz)
- 1.4 Interaktionismus
- 2. Angeborene Fähigkeiten und Mechanismen hinsichtlich der menschlichen Sprache
- 2.1 Einführung
- 2.2 Pränataler Spracherwerb
- 2.3 Die kritische Periode
- 3. „Wilde“ Kinder: erster sprachlicher Input nach
- 4. „Wilde“ Kinder: erster sprachlicher Input vor oder während der kritischen Periode (mit anschließender Isolation)
- 5. Fazit - Versuch einer eigenen angemessenen Spracherwerbstheorie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Spracherwerb anhand verschiedener Theorien und Fallstudien von „wilden“ Kindern. Ziel ist es, den Wahrheitsgehalt der bestehenden Spracherwerbstheorien zu überprüfen und eine eigene, angemessene Theorie zu formulieren.
- Analyse verschiedener Spracherwerbstheorien (Behaviorismus, Nativismus, Kognitivismus, Interaktionismus)
- Untersuchung angeborener Fähigkeiten im Spracherwerb
- Auswertung von Fallstudien „wilder“ Kinder und deren Relevanz für Spracherwerbstheorien
- Bedeutung der kritischen Periode für den Spracherwerb
- Formulierung einer eigenen, umfassenderen Spracherwerbstheorie
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung legt die Grundlage der Arbeit dar. Sie beschreibt die Bedeutung angeborener Fähigkeiten für den Spracherwerb und die Herausforderungen, die sich bei der Untersuchung des Spracherwerbs bei „wilden“ Kindern stellen. Die Schwierigkeit, verlässliche Daten aus der Vergangenheit zu erhalten, wird hervorgehoben, und das Ziel der Arbeit – die Überprüfung bestehender Theorien anhand von Fallstudien – wird klar definiert. Das Problem der mangelnden Datenlage für linguistisch fundierte Analysen wird explizit angesprochen.
1. Kurze Einführung in die 4 Spracherwerbstheorien: Dieses Kapitel bietet eine kurze Übersicht über vier bedeutende Spracherwerbstheorien: Behaviorismus, Nativismus, Kognitivismus und Interaktionismus. Der Behaviorismus wird als Theorie dargestellt, die den Spracherwerb als Konditionierungsprozess versteht, während der Nativismus die Annahme einer angeborenen Universalgrammatik betont. Der Kognitivismus verknüpft den Spracherwerb eng mit der kognitiven Entwicklung des Kindes, und der Interaktionismus hebt die soziale Interaktion und den Einfluss der Umgebung hervor. Die Stärken und Schwächen jedes Ansatzes werden kurz angerissen, wobei der Fokus auf dem Vergleich der verschiedenen Modelle liegt, um dem Leser ein umfassendes Verständnis der verschiedenen Perspektiven zu ermöglichen.
2. Angeborene Fähigkeiten und Mechanismen hinsichtlich der menschlichen Sprache: Dieses Kapitel befasst sich mit den angeborenen Fähigkeiten und Mechanismen, die den Spracherwerb ermöglichen. Es werden Aspekte des pränatalen Spracherwerbs und die Bedeutung der kritischen Periode für die Sprachentwicklung diskutiert. Die angeborenen Fähigkeiten werden als wichtige Grundlage für den Spracherwerb dargestellt, und die Diskussion über die kritische Periode unterstreicht den Einfluss der zeitlichen Komponente auf die erfolgreiche Sprachentwicklung. Die Einführung in diesem Kapitel dient als Brücke zu den folgenden Kapiteln, die sich mit Fallstudien auseinandersetzen.
3. „Wilde“ Kinder: erster sprachlicher Input nach: Dieses Kapitel analysiert Fallstudien von "wilden" Kindern, deren erster sprachlicher Input erst nach der kritischen Phase erfolgte. Hier wird untersucht, inwieweit diese Kinder trotz späterer Sprachförderung ihr Sprachvermögen entwickeln können. Durch die Analyse dieser Fälle können Rückschlüsse auf die Bedeutung frühkindlicher sprachlicher Stimulation für die Sprachentwicklung gezogen werden. Die detaillierte Untersuchung der Sprachentwicklung dieser Kinder erlaubt die Überprüfung der Theorien aus Kapitel 1.
4. „Wilde“ Kinder: erster sprachlicher Input vor oder während der kritischen Periode (mit anschließender Isolation): Dieses Kapitel untersucht Fallstudien von "wilden" Kindern, die zwar in der kritischen Phase sprachlichen Input hatten, aber anschließend isoliert aufwuchsen. Es wird analysiert, inwieweit die frühe sprachliche Stimulation ihre spätere Sprachentwicklung beeinflusst hat, trotz der Isolation. Diese Fallstudien liefern wertvolle Informationen über die nachhaltigen Auswirkungen früher sprachlicher Erfahrungen und das mögliche Ausmaß an angeborenen Sprachfähigkeiten, welches auch ohne konsistente sprachliche Umgebung zum Tragen kommt. Die Ergebnisse dieser Analyse können zur Validierung oder Falsifizierung bestehender Theorien herangezogen werden.
Schlüsselwörter
Spracherwerb, Spracherwerbstheorien, Behaviorismus, Nativismus, Kognitivismus, Interaktionismus, kritische Periode, angeborene Fähigkeiten, wilde Kinder, Sprachentwicklung, Universalgrammatik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Spracherwerbstheorien und Fallstudien "Wilder" Kinder
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Spracherwerb anhand verschiedener Theorien und Fallstudien von „wilden“ Kindern. Das Ziel ist die Überprüfung bestehender Spracherwerbstheorien und die Formulierung einer eigenen, umfassenderen Theorie.
Welche Spracherwerbstheorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt vier bedeutende Spracherwerbstheorien: Behaviorismus, Nativismus, Kognitivismus und Interaktionismus. Jede Theorie wird kurz vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen werden diskutiert.
Welche Rolle spielen angeborene Fähigkeiten im Spracherwerb?
Die Arbeit betont die Bedeutung angeborener Fähigkeiten und Mechanismen für den Spracherwerb. Der pränatale Spracherwerb und die kritische Periode werden als wichtige Faktoren diskutiert.
Welche Bedeutung haben die Fallstudien "wilder" Kinder?
Die Fallstudien „wilder“ Kinder dienen als empirische Grundlage zur Überprüfung der Theorien. Die Arbeit unterscheidet zwischen Kindern mit erstem sprachlichen Input nach der kritischen Periode und solchen, die zwar frühen Input hatten, aber später isoliert aufwuchsen. Die Analyse dieser Fälle soll Aufschluss über die Bedeutung frühkindlicher sprachlicher Stimulation und den Einfluss der kritischen Periode geben.
Was ist die kritische Periode im Spracherwerb?
Die kritische Periode beschreibt einen Zeitraum, in dem der Spracherwerb besonders effizient und effektiv stattfindet. Die Arbeit untersucht, wie sich ein späterer oder unterbrochener sprachlicher Input während oder nach dieser Periode auf die Sprachentwicklung auswirkt.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, auf Basis der Analyse der verschiedenen Theorien und Fallstudien eine eigene, angemessene Spracherwerbstheorie zu formulieren, welche die verschiedenen Aspekte des Spracherwerbs umfassender berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Spracherwerb, Spracherwerbstheorien, Behaviorismus, Nativismus, Kognitivismus, Interaktionismus, kritische Periode, angeborene Fähigkeiten, wilde Kinder, Sprachentwicklung, Universalgrammatik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Einführung in vier Spracherwerbstheorien, Angeborene Fähigkeiten und Mechanismen, Fallstudien "wilder" Kinder mit späterem sprachlichen Input, und Fallstudien "wilder" Kinder mit anschliessender Isolation nach frühem Input. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und formuliert eine eigene Theorie.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2008, Erforschung von "wilden" Kindern und ihr Beitrag für die Spracherwerbstheorie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/435229