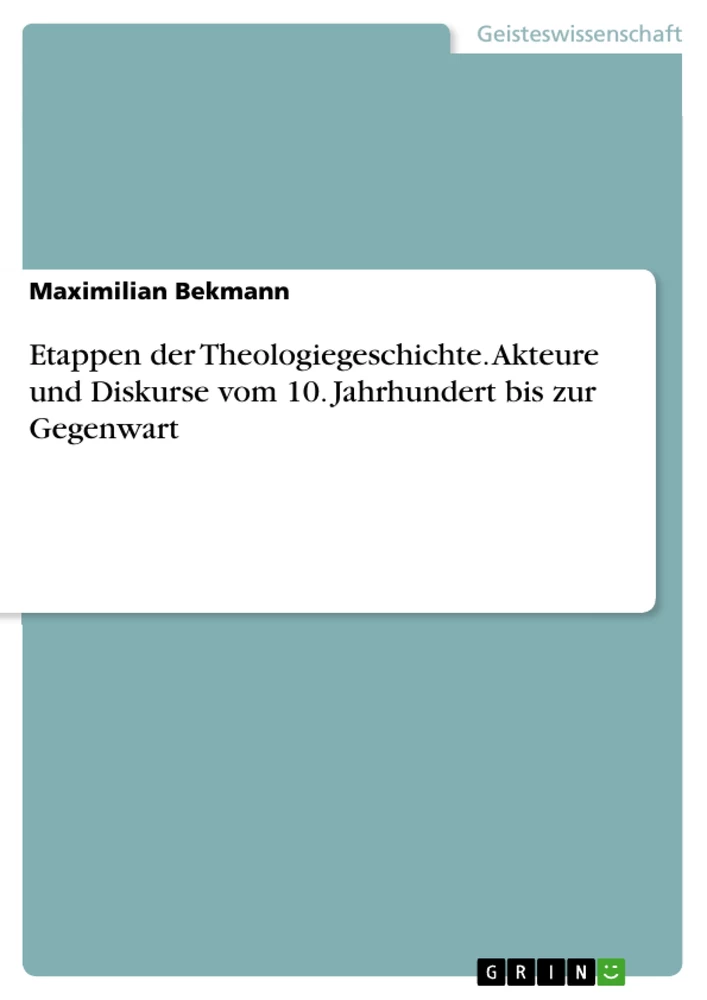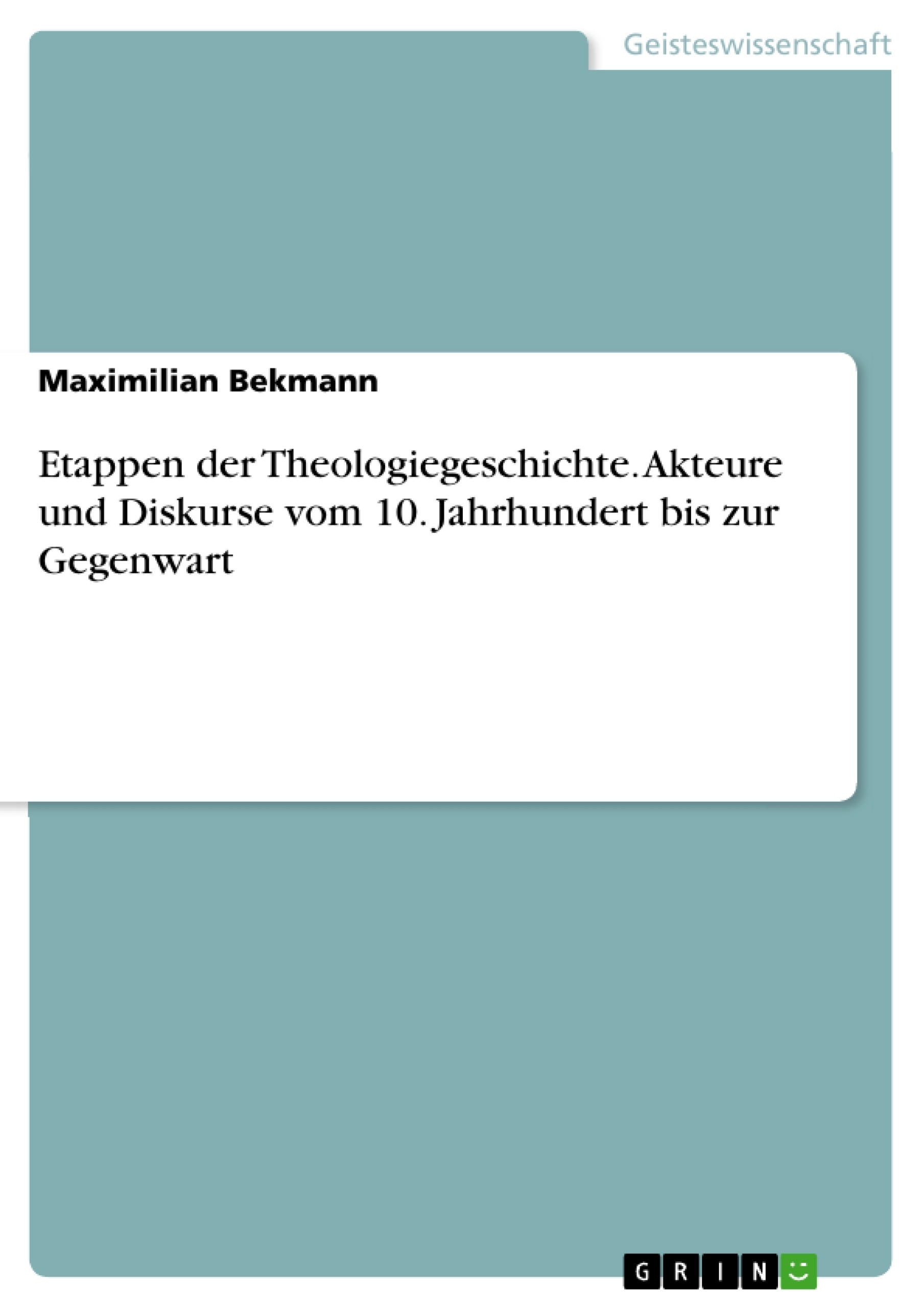Die theologische Ausarbeitung legt den Schwerpunkt besonders auf die Entwicklung römischer und reformatorischer Traditionen durch die Geschichte hindurch. Die Gottesfrage ist vielseitig, bleibt dabei immer aktuell. Sinn und Ziel der Skizzierung einer Theologiegeschichte ist es, das Aufkommen von Differenzen aufzuzeigen und den Versuch einer Lösung bis hinein in die Gegenwart nachvollziehen zu können.
Die Geschichte der Theologie ist ebenso wie jene der Philosophie eine Abfolge von Epochen, Traditionen und Denkwegen. Dabei haben das Mittelalter und die Neuzeit verschiedene Ansätze von Denkmodellen hervorgebracht, die in der Gegenwart nun teils wieder aufgegriffen, analysiert und weiterentwickelt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die Theologie und ihr geschichtlicher Entwicklungsprozess
- Teil I: DAS MITTELALTER
- 1.1. Das Zeitalter der Scholastik
- 1.1.1 Zur Problematik des Begriffs
- 1.1.2 Die Scholastik als einheitliches Lehrsystem
- 1.2. Anselm von Canterbury
- 1.2.1 Intellektuelle Mobilität im Frankenreich
- 1.2.2 Die Begegnung verschiedener Wissensformen zur Zeit Anselms
- 1.2.3 Die Metapherntheorie als intellektuelles Instrument der Gottesrede
- 1.2.4 Die Ebenen von Denken und Denknotwendigkeit im ontologischen Gottesbeweis
- 1.2.5 Die Veranschaulichung durch Künstler und Bild
- 1.3. Petrus Abaelard
- 1.3.1 Rationalisierungsschübe durch das Aufkommen verschiedener Autoritäten
- 1.3.2 Die offenen Grenzen der Vernunfterkenntnis auf die Deutung der Welt hin
- 1.4. Johannes Scottus Eriugena
- 1.4.1 Ein irischer Gelehrter zieht ins Westfrankenreich
- 1.4.2 Der neuplatonische Einfluss bei Eriugena in der Frage nach der Prädestination
- 1.4.3 Eriugenas Bemühen um die Einheit von Gottesgelehrsamkeit und Weltweisheit
- 1.4.4 Das Vermächtnis Eriugenas in seinem Hauptwerk „Periphyseon”
- 1.5. Mechthild von Magdeburg
- 1.5.1 Armutsbewegungen im Mittelalter
- 1.5.2 Die Armut als förmlicher Ort von Offenbarung
- 1.5.3 Das sprachtheologische Konzept der performativen Gottesrede
- 1.6. Johannes Duns Scotus
- 1.6.1 Die Aristoteles-Rezeption und ihre Folge für ein neues Theologieverständnis
- 1.6.2 Duns Scotus als wichtige Schaltstelle für den theologischen Diskurs
- 1.6.3 Der scotistische Ausweis der Theologie als Wissenschaft
- 1.7. Wilhelm von Ockham
- 1.7.1 Ockham als ein Vorläufer der Moderne im Mittelalter
- 1.7.2 Die Aufwertung der Laien zu relativierenden Größen in der Kirche
- 1.7.3 Der erkenntnistheoretische Primat des Individuums vor dem Allgemeinen
- 1.7.4 Die Erkenntnis als realistischer Konzeptualismus
- 1.8. Via moderna und Mystik
- 1.8.1 Die Via moderna als neues Gegenüber zur Via antiqua
- 1.8.2 Konzeptualismus und Nominalismus
- 1.8.3 Folgen für die Gottesbestimmung: potentia absoluta und potentia ordinata
- 1.8.4 Die Deutsche Mystik
- 1.1. Das Zeitalter der Scholastik
- Teil II: DIE NEUZEIT
- 2.1. Das Zeitalter der Reformation
- 2.1.1 Reformation als Epochenbegriff
- 2.1.2 Theologische Ursprünge der Reformation
- 2.1.3 Reformation als Emergenzphänomen
- 2.2. Martin Luther
- 2.2.1 Die intensive Kirchlichkeit und Religiosität am Beginn des 16. Jahrhunderts
- 2.2.2 Luthers Prägung durch eine rigorose Religiosität und ihre Folgen
- 2.2.3 Der Bann Luthers auf dem Reichstag zu Worms und die Spaltung der Kirche
- 2.2.4 Die Rechtfertigung allein aus dem Glauben als Inhalt reformatorischer Theologie
- 2.3. Johannes Calvin
- 2.3.1 Humanistische Studien in Paris und Hinwendung zur Reformation
- 2.3.2 Die festgelegte Kirchenstruktur als Charakteristikum calvinistischer Theologie
- 2.3.3 Der Vollzug der richtigen Gotteserkenntnis durch den Heiligen Geist
- 2.4. Gegenreformation und Konfessionalisierung
- 2.4.1 Die Gegenreformation als Kampfbegriff und Modernisierungsprozess
- 2.4.2 Umsetzung und Anwendung der katholischen Reform im Konzil von Trient
- 2.5. Melchior Cano
- 2.5.1 Spanien zur Zeit Canos
- 2.5.2 Kirchliche Reform und theologische Ausdifferenzierung an den Universitäten
- 2.5.3 Die Lehre der loci-theologici
- 2.6. Das Zeitalter der Aufklärung
- 2.6.1 Die Endkonfessionalisierung des Religionsbegriffes
- 2.6.2 Die anthropologische Unterfassung der Religion durch den Vernunftdiskurs
- 2.7. Die Neuscholastik
- 2.7.1 Der Rückbezug auf die mittelalterliche Scholastik
- 2.7.2 Das neuscholastische Theologiekonzept
- 2.8. Friedrich Schleiermacher
- 2.8.1 Romantik und Aufklärung als neue Paradigmen
- 2.8.2 Schleiermachers Religionsverständnis als Anschauung und Gefühl
- 2.8.3 Das Gefühl der „schlechthinnigen Abhängigkeit“ von der Erlösung
- 2.8.4 Schleiermachers Erfahrungsgedanke
- 2.8.5 Religion als Einswerden mit der Schöpfung
- 2.9. Karl Barth
- 2.9.1 Das ausgesprochene Wort Gottes als Aufgabe der Theologie
- 2.9.2 Der Perspektivenwechsel: Gottes Bewegung zum Menschen
- 2.9.3 Die Begründung der dialektischen Theologie
- 2.10. Rudolf Bultmann
- 2.10.1 Der Weg von der liberalen zur dialektischen Theologie
- 2.10.2 Die Einheit von Exegese und Systematik
- 2.10.3 Entmythologisierung und Kerygma als zentrale Begriffe
- 2.10.3 Die hermeneutischen Folgen für den österlichen Glauben an die Auferstehung
- 2.1. Das Zeitalter der Reformation
- Teil III: DIE GEGENWART
- 3.1. Der Begriff der Ökumene und ihr Ziel
- 3.1.1 Vorüberlegung
- 3.1.2 Historische Hintergründe der Ökumene
- 3.1.3 Die Wurzel der Ökumene: die gemeinsamen Märtyrer in den Zeiten der Diktatur
- 3.1.4 Ähnlichkeiten und Differenzen mit der Orthodoxie
- 3.1.5 Die systematische Einordnung der Ökumene
- 3.2. Die Historisierung der Tradition und deren Kontinuität
- 3.2.1 Unitatis redintegratio: Die Kirche muss einen neuen Weg der Ökumene finden
- 3.2.2 Bruch von Traditionen und Kontinuität im Heiligen Geist
- 3.2.3 Christus Herr der Kirche und der Geschichte als einendes Element
- 3.3. Der Herr der Geschichte und die Einheit der Christen
- 3.3.1 Das Lesen kirchlicher Dokumente in seiner Performativität
- 3.3.2 Das Vorwort von „Unitatis redintegratio“ – eine Betrachtung
- 3.3.3 Die Gewichtung der katholischen Dogmen
- 3.4. Eine neue Grundlegung des Ökumenismus durch die römische Kirche
- 3.4.1 Der Heilige Geist als Prinzip der Einheit
- 3.4.2 Ein „Türöffner“ zur vollen kirchlichen Gemeinschaft mit den getrennten Christen
- 3.5. Die Aporie ökumenischer Handlungsmuster
- 3.5.1 Papst Franziskus setzt neue Zeichen der Ökumene
- 3.5.2 Das Zusammenfinden der getrennten Christen als „Imperativ des Handelns”
- 3.5.3 Das pilgernde Volk Gottes in einer Theologie des Mysteriums
- 3.6. Differenzen und Lehrverurteilungen
- 3.6.1 Die Lehrverwerfungsstudie als primärer Kontext
- 3.6.2 Traditionsdynamik
- 3.7. Ein gemeinsames Verständnis der Rechtfertigungsfrage
- 3.7.1 Die Herausforderung der Rechtfertigungsfrage für die Kontroverstheologie
- 3.7.2 Die Kontroverse der Rechtfertigungslehre im Rahmen von Werk und Gnade
- 3.7.3 Eine neuekklesiologische Basis der Ökumene
- 3.8. Das Verhältnis von Sünde und Rechtfertigung
- 3.8.1 Sündenvergebung und Freiheit - das Wesen der Rechtfertigung
- 3.8.2 Heilsgewissheit angesichts der Konkupiszenz als gemeinsamer Konsens
- 3.1. Der Begriff der Ökumene und ihr Ziel
- Die Scholastik im Mittelalter: Ihre Entstehung, ihre Entwicklung und ihre Bedeutung für das theologische Denken
- Die Reformation: Ihre Ursprünge, ihre Hauptvertreter und ihre Auswirkungen auf die christliche Welt
- Die Aufklärung: Ihre Einflussnahme auf den Religionsbegriff und die Entstehung neuer theologischer Strömungen
- Die Ökumene: Ihre Ziele, ihre Herausforderungen und ihre aktuelle Bedeutung für die Einheit der Christen
- Die Bedeutung der Rechtfertigungsfrage für die Entwicklung der Theologie und die Suche nach Einheit in der christlichen Welt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Werk widmet sich der Erforschung der Geschichte der Theologie und beleuchtet dabei die Entwicklung von Akteuren und Diskursen. Es zeichnet einen Bogen vom zehnten Jahrhundert bis in die Gegenwart und analysiert wichtige Denker und Strömungen, die die Entwicklung der Theologie prägten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit der Bedeutung der Theologie und der Analyse ihrer geschichtlichen Entwicklung. Teil I widmet sich dem Mittelalter und betrachtet die Scholastik als einflussreiches Lehrsystem. Es werden wichtige Denker wie Anselm von Canterbury, Petrus Abaelard, Johannes Scottus Eriugena, Mechthild von Magdeburg, Johannes Duns Scotus und Wilhelm von Ockham vorgestellt. Teil II behandelt die Neuzeit und fokussiert auf die Reformation, ihre wichtigsten Akteure und Strömungen. Martin Luther, Johannes Calvin, Melchior Cano und Friedrich Schleiermacher werden analysiert und ihre Bedeutung für die Weiterentwicklung des theologischen Diskurses beleuchtet. Auch die Aufklärung und die Neuscholastik werden in diesem Teil thematisiert. Teil III befasst sich mit der Gegenwart und dem Begriff der Ökumene, ihrer Geschichte, ihren Zielen und ihren Herausforderungen. Die Bedeutung der Rechtfertigungsfrage und das Verhältnis von Sünde und Rechtfertigung werden ausführlich diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselbegriffe des Buches sind: Theologie, Geschichte, Akteure, Diskurse, Scholastik, Reformation, Aufklärung, Ökumene, Rechtfertigungsfrage, Sünde, Heilsgewissheit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Skizzierung der Theologiegeschichte?
Sie soll die Entwicklung römischer und reformatorischer Traditionen vom 10. Jahrhundert bis heute aufzeigen und Lösungen für Differenzen nachvollziehen.
Was war die Scholastik im Mittelalter?
Ein einheitliches Lehrsystem, das Vernunft und Glauben verbinden wollte, vertreten durch Denker wie Anselm von Canterbury oder Thomas von Aquin.
Welchen Kerninhalt hat Martin Luthers Theologie?
Zentral ist die Lehre der Rechtfertigung allein aus dem Glauben (sola fide), die zur Spaltung der Kirche im 16. Jahrhundert führte.
Was bedeutet "Ökumene" in der Gegenwart?
Es ist das Bemühen um die Einheit der christlichen Kirchen, basierend auf gemeinsamen Wurzeln und dem Dialog über theologische Differenzen.
Wer war Friedrich Schleiermacher?
Ein bedeutender Theologe der Neuzeit, der Religion als "Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit" definierte.
Was ist die "dialektische Theologie"?
Ein von Karl Barth begründeter Ansatz, der den absoluten Gegensatz zwischen Gott und Mensch betont und Gott als den "Ganz Anderen" sieht.
- Quote paper
- Maximilian Bekmann (Author), 2018, Etappen der Theologiegeschichte. Akteure und Diskurse vom 10. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/435395