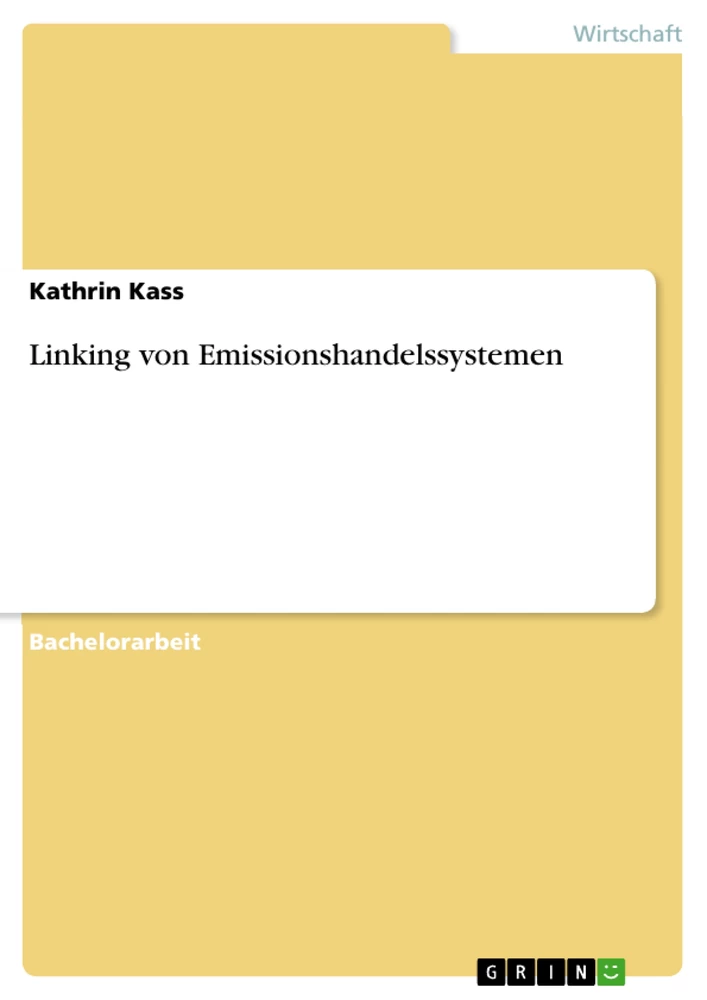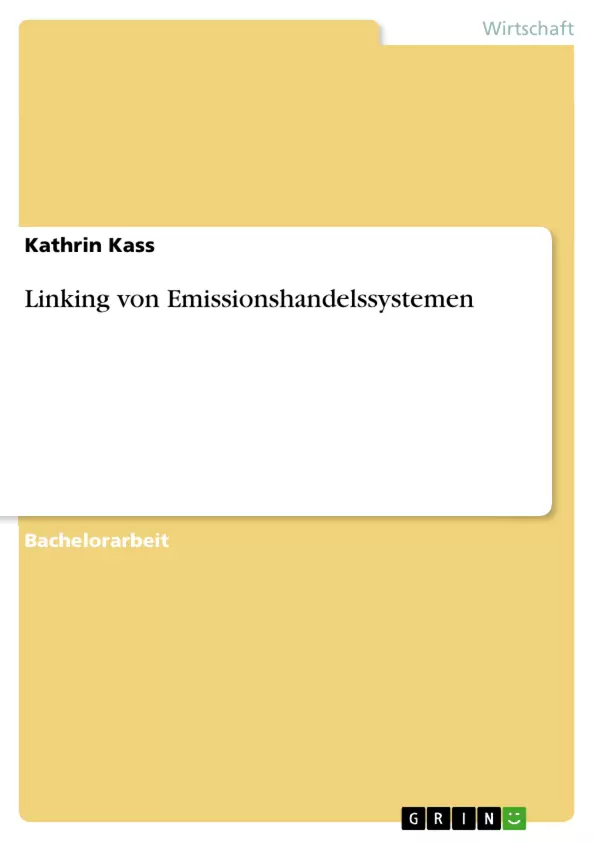Der Anstieg der anthropogenen Emissionen des letzten Jahrhunderts wird für den drohenden Klimawandel verantwortlich gemacht. Um diesen und die damit verbundenen, irreversiblen Konsequenzen für Umwelt, Gesellschaft und Ökonomie zu verhindern, fordern Wissenschaftler die Vermeidung einer globalen Erderwärmung über 2°C im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter.
Die ökonomische Theorie bezeichnet die Auswirkungen von Treibhausgasemissionen als externe Effekte, die durch die kostenlose Nutzung der Umwelt auftreten. Klimapolitische Bemühungen zielen darauf ab, dass Individuen die Nutzung der Umwelt in ihre Nutzen- bzw. Produktionsfunktion einbeziehen. Dem Gut Umwelt soll ein monetärer Wert beigemessen werden.
Der Emissionshandel als marktbasiertes umweltpolitisches Instrument gilt als effizienteste Form, um eine Internalisierung der externen Effekte herbeizuführen. Mit Inkrafttreten des Kyoto Protokolls als erstes völkerrechtliches Übereinkommen über verbindliche Emissionsziele wurde der Emissionshandel auf Staatenebene eingeführt. Mittlerweile existieren weltweit einige Systeme handelbarer Emissionsberechtigungen, deren Vorreiter das European Emissions Trading Scheme (EU ETS) darstellt.
Der ökonomischen Theorie folgend würde Linking von Emissionshandelssystemen, im besten Falle zu einem globalen Emissionshandelssystem, zusätzliche Effizienzgewinne ermöglichen, sodass klimapolitische Ziele zu den geringstmöglichen Kosten erreicht würden. Um eine Verbindung von Emissionshandelssystemen zu erreichen, müssten existierende und geplante Emissionshandelssysteme bezüglich wichtiger Designmerkmale kompatibel sein.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist zum einen aus einer Top–Down–Perspektive, durch die Erläuterung der ökonomischen Zulammenhänge hinter dem Emissionshandel, dessen theoretische Überlegenheit gegenüber alternativen Umweltpolitiken darzustellen. Zum anderen soll durch die Analyse möglicher Designmerkmale und der sich daraus ergebenden Handlungsanreize für Marktakteure eine Bottom–Up–Perspektive eingenommen werden, um den Status Quo der wichtigsten Entwicklungen in diesem Bereich darzustellen und mögliche Konsequenzen und Hindernisse im Hinblick auf das Linking der dargestellten Emissionshandelssystemen zu ermitteln.
Weiterhin werden Chancen und Tradoffs, Systemunterschiede und deren Implikationen für Links, die Möglichkeiten zur Implementierung von Links sowie Szenarien über die Zertifikatspreisentwicklung unter Links dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Emissionshandel
- 2.1 Ökonomische Theorie des Emissionshandels
- 2.2 Kyoto Protokoll
- 2.2.1 Assigned Amount
- 2.2.2 Flexible Mechanismen
- 2.2.3 Überwachung, Berichterstattung und Verifizierung
- 2.3 European Emissions Trading Scheme
- 2.3.1 European Emissions Trading Scheme Phase I & II
- 2.3.2 European Emissions Trading Scheme Phase III
- 2.3.3 Handel von Emissionsberechtigungen
- 2.4 Weitere existierende und geplante EHS
- 2.4.1 Japanese Voluntary Emissions Trading Scheme
- 2.4.2 Emissionshandel in der Schweiz
- 2.4.3 New Zealand Emissions Trading Scheme
- 2.4.4 New South Wales Greenhouse Gas Reduktion Schemes
- 2.4.5 Carbon Pollution Reduction Scheme
- 2.4.6 Kanadisches EHS
- 2.4.7 Emissionshandel in den USA
- 3 Linking von Emissionshandelssystemen
- 3.1 Formen von Links
- 3.2 Zertifikatspreisentwicklung unter Links
- 3.2.1 Unilateraler Link
- 3.2.2 Bilateraler Link
- 3.2.3 Bilateraler Link mit Preisbegrenzungsmechanismus
- 3.2.4 Allgemeines Gleichgewichtsmodell
- 3.3 Chancen und Trade-Offs durch Linking
- 3.3.1 Verteilungseffekte des Linkings
- 3.3.2 Politische und regulatorische Implikationen des Linkings
- 3.4 Systemunterschiede und deren Implikationen für Links
- 3.5 Implementierung von Links
- 4 Zusammenfassung und Fazit
- Die ökonomische Theorie des Emissionshandels
- Das Kyoto-Protokoll und seine flexiblen Mechanismen
- Das European Emissions Trading Scheme (EU ETS)
- Verschiedene Formen des Linkings von EHS
- Chancen und Trade-Offs des Linkings
- Kapitel 1: Einleitung: Das Kapitel führt in die Thematik des Emissionshandels und des Linkings von EHS ein. Es wird die Relevanz des Themas im Kontext des Klimawandels und der internationalen Zusammenarbeit zur Reduktion von Treibhausgasemissionen herausgestellt.
- Kapitel 2: Emissionshandel: Dieses Kapitel beleuchtet die ökonomische Theorie des Emissionshandels, das Kyoto-Protokoll und das EU ETS. Es werden die verschiedenen Instrumente des Emissionshandels, wie z.B. die Assigned Amount, die flexiblen Mechanismen und die Überwachung, Berichterstattung und Verifizierung (MRV) erläutert. Zudem werden weitere existierende und geplante EHS weltweit vorgestellt.
- Kapitel 3: Linking von Emissionshandelssystemen: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Analyse verschiedener Linking-Formen, wie dem unilateralen, bilateralen und multilateralen Linking. Es wird die Zertifikatspreisentwicklung unter den unterschiedlichen Links sowie die Chancen und Trade-Offs des Linkings untersucht. Zusätzlich werden die Systemunterschiede und deren Implikationen für die Implementierung von Links beleuchtet.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Verknüpfung von Emissionshandelssystemen (EHS). Ziel ist es, die verschiedenen Formen von Links zu analysieren und deren Auswirkungen auf die Zertifikatspreisentwicklung und die Effizienz des Emissionshandels zu untersuchen. Dabei werden sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen des Linkings beleuchtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Emissionshandel, Kyoto-Protokoll, EU ETS, Linking von Emissionshandelssystemen, Zertifikatspreisentwicklung, Effizienz, Chancen, Trade-Offs, Systemunterschiede, Implementierung, Klimawandel, Treibhausgasemissionen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Linking" im Kontext von Emissionshandelssystemen?
Linking bezeichnet die Verknüpfung verschiedener regionaler oder nationaler Emissionshandelssysteme (EHS), um Zertifikate gegenseitig anzuerkennen und den Handel zu erweitern.
Welche ökonomischen Vorteile bietet die Verknüpfung von EHS?
Durch Linking können Effizienzgewinne erzielt werden, da Klimaziele dort erreicht werden können, wo die Vermeidungskosten am geringsten sind, was zu niedrigeren Gesamtkosten führt.
Welche Formen des Linkings gibt es?
Es wird zwischen unilateralem (einseitigem), bilateralem (beidseitigem) und multilateralem Linking unterschieden.
Was ist das EU ETS?
Das European Emissions Trading Scheme (EU ETS) ist das weltweit führende System für den Handel mit Treibhausgasemissionsberechtigungen und dient als Vorreiter für andere Systeme.
Welche Hindernisse gibt es beim Linking?
Unterschiede im Systemdesign, wie Preisobergrenzen, Überwachungsstandards (MRV) und Zuteilungsregeln, können die Kompatibilität und Implementierung von Links erschweren.
- Quote paper
- Kathrin Kass (Author), 2010, Linking von Emissionshandelssystemen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/435612