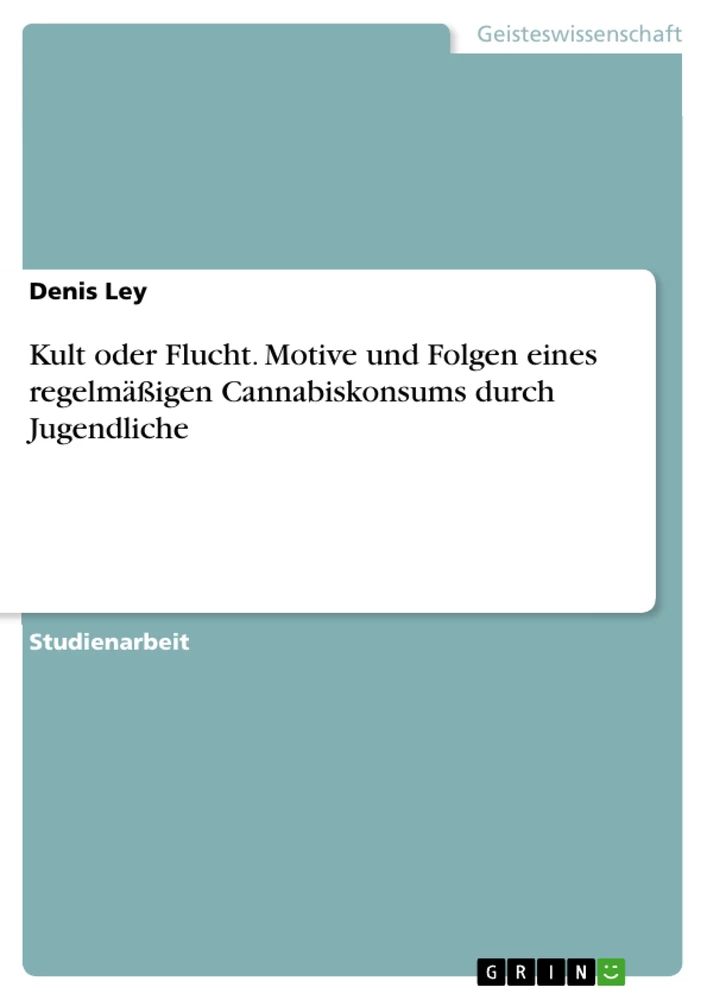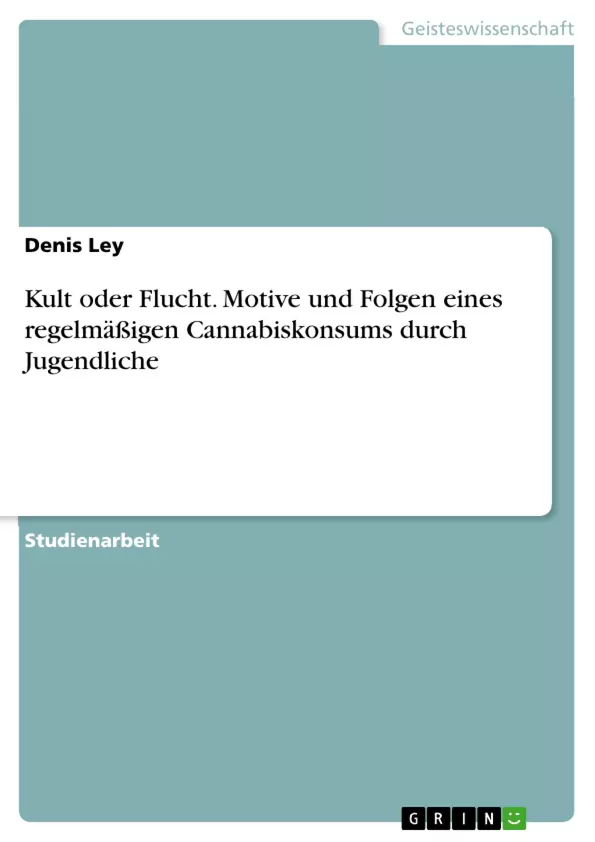In letzter Zeit wird das Thema Cannabis immer lauter, der Aufschrei nach Legalisierung ist so groß wie nie zuvor. Cannabis spielt seit Jahrtausenden eine wichtige Rolle in der Geschichte der Menschheit. Egal ob als Handelsgut, Nahrung, Medizin, Faserlieferant für Stoffe oder auch nur als Rauschdroge. Keine illegale Droge ist so weit verbreitet wie Cannabis, wobei auch sie eine gesonderte Stelle der illegalen Drogen einnimmt. In vielen Regionen gilt Cannabis als Kulturgut.
So ist es nicht weiter verwunderlich, dass viele Jugendliche in den Kontakt mit dem Rauschmittel kommen. Diese Studienarbeit bietet deswegen einen gesonderten Blick auf den Konsum von Jugendlichen, denn Drogenkonsum ist eines der bekanntesten und größten Risiken für eine altersgerechte Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Es wird ein kurzer Einblick gewährt, um was es sich bei Cannabis handelt, was Jugendliche dazu verleitet Cannabis zu konsumieren und welche Folgen der Konsum dieser Droge mit sich zieht. Anhand dieser Ausarbeitung wird ein kurzer Blick auf die Frage der Legalisierung geworfen in Bezug auf die Motive und Folgen des Konsums.
Der medizinische Aspekt der Droge wird in dieser nicht bis kaum behandelt, auch wenn dieser mittlerweile unumstritten ist, so würde eine Betrachtung des medizinischen Nutzens an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Ebenso wird kein näherer Einblick auf die psychiatrische Relevanz von Cannabis gewährt. Ziel dieser Arbeit ist es einen konzentrierten und fachlichen Überblick über Motive und Folgen von Cannabiskonsum dem/der Fachleser_in zu bieten, ihn im Allgemeinen über das Thema Cannabis aufzuklären und ihm/ihr erleichtern eine Position bezüglich der Legalisierungsdebatte zu finden, welche fachlich belegt ist.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Wenn von Cannabis die Rede ist
- Die Wirkung des psychoaktiven Stoffes
- Das Problem am Cannabis
- Warum Jugendliche zu Cannabis greifen
- Ursachen und Motive des Konsums
- Folgen eines regelmäßigen Konsums im Jugendalter
- Physische und psychische Folgen
- Kurzzeitfolgen
- Langzeitfolgen
- Strafrechtliche Folgen
- Die Frage nach der Legalisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Motive und Folgen des Cannabiskonsums bei Jugendlichen. Sie beleuchtet die Wirkung von Cannabis, die Gründe für seinen Konsum unter Jugendlichen und die daraus resultierenden physischen, psychischen und strafrechtlichen Folgen. Die Arbeit strebt einen fachlich fundierten Überblick an und trägt zur Diskussion um die Legalisierung bei.
- Wirkung von Cannabis auf den Körper und Geist
- Motive für den Cannabiskonsum bei Jugendlichen
- Physische und psychische Folgen des Cannabiskonsums
- Strafrechtliche Implikationen des Cannabiskonsums
- Diskussion der Legalisierung von Cannabis
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort führt in das Thema Cannabis und die aktuelle Debatte um seine Legalisierung ein. Es hebt die Bedeutung des Themas für die Entwicklung von Jugendlichen hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf die Motive und Folgen des Cannabiskonsums konzentriert. Der medizinische und psychiatrische Aspekt wird aus Gründen der Fokussierung nur am Rande erwähnt. Die Arbeit soll einen konzentrierten Überblick bieten und den Leser bei der Auseinandersetzung mit der Legalisierungsdebatte unterstützen.
Wenn von Cannabis die Rede ist: Dieses Kapitel beschreibt Cannabis botanisch und seine verschiedenen Zubereitungsformen (Haschisch und Marihuana). Es werden die wichtigsten Inhaltsstoffe, insbesondere Delta-9-THC und Cannabidiol (CBD), erläutert und ihre Wirkung auf den Körper und das Gehirn beschrieben. Der Text hebt die Bedeutung des Endocannabinoidsystems hervor und erklärt, wie THC im Gegensatz zu körpereigenen Cannabinoiden wirkt. Schließlich werden die vielseitigen Wirkungen von Cannabis – stimulierend, dämpfend und halluzinogen – erläutert und der Einfluss von "Set" und "Setting" auf die Wirkung hervorgehoben.
Warum Jugendliche zu Cannabis greifen: Dieses Kapitel würde sich mit den Ursachen und Motiven des Cannabiskonsums bei Jugendlichen auseinandersetzen. Es wäre zu erwarten, dass soziale, psychologische und umweltbedingte Faktoren beleuchtet werden, die Jugendliche zum Konsum von Cannabis führen. Die genauen Inhalte dieses Kapitels sind der vorliegenden Textvorlage nicht zu entnehmen.
Folgen eines regelmäßigen Konsums im Jugendalter: Dieses Kapitel beschreibt die Folgen regelmäßigen Cannabiskonsums im Jugendalter. Es würde sowohl die kurz- als auch die langfristigen physischen und psychischen Auswirkungen behandeln, wobei der Text auf die Bedeutung des Alters hinweisen dürfte, da die Folgen für die noch nicht vollständig entwickelte Gehirnentwicklung besonders schwerwiegend sein können. Zusätzlich werden hier wahrscheinlich die strafrechtlichen Folgen des Cannabiskonsums erläutert. Die genauen Inhalte dieses Kapitels sind der vorliegenden Textvorlage nicht zu entnehmen.
Schlüsselwörter
Cannabis, Cannabiskonsum, Jugendliche, Drogenkonsum, Folgen, Motive, Legalisierung, THC, CBD, Endocannabinoidsystem, Abhängigkeit, Strafrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studienarbeit: Cannabis und Jugendliche
Was ist der Gegenstand dieser Studienarbeit?
Die Studienarbeit untersucht die Motive und Folgen des Cannabiskonsums bei Jugendlichen. Sie beleuchtet die Wirkung von Cannabis, die Gründe für seinen Konsum unter Jugendlichen und die daraus resultierenden physischen, psychischen und strafrechtlichen Folgen. Die Arbeit strebt einen fachlich fundierten Überblick an und trägt zur Diskussion um die Legalisierung bei.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Wirkung von Cannabis auf Körper und Geist, Motive für den Cannabiskonsum bei Jugendlichen, physische und psychische Folgen des Cannabiskonsums, strafrechtliche Implikationen des Cannabiskonsums und die Diskussion der Legalisierung von Cannabis.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet die Kapitel: Vorwort, Wenn von Cannabis die Rede ist (Wirkung und Problematik), Warum Jugendliche zu Cannabis greifen (Ursachen und Motive), Folgen eines regelmäßigen Konsums im Jugendalter (physische, psychische und strafrechtliche Folgen) und Die Frage nach der Legalisierung.
Was wird im Kapitel "Wenn von Cannabis die Rede ist" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt Cannabis botanisch und seine verschiedenen Zubereitungsformen (Haschisch und Marihuana). Es werden die wichtigsten Inhaltsstoffe (Delta-9-THC und CBD) erläutert und ihre Wirkung auf Körper und Gehirn beschrieben. Die Bedeutung des Endocannabinoidsystems und der Einfluss von "Set" und "Setting" auf die Wirkung werden hervorgehoben.
Welche Informationen enthält das Kapitel "Warum Jugendliche zu Cannabis greifen"?
Dieses Kapitel behandelt die Ursachen und Motive des Cannabiskonsums bei Jugendlichen. Es werden soziale, psychologische und umweltbedingte Faktoren beleuchtet, die Jugendliche zum Konsum führen (genaue Inhalte sind in der vorliegenden Vorlage nicht detailliert).
Was wird im Kapitel "Folgen eines regelmäßigen Konsums im Jugendalter" beschrieben?
Dieses Kapitel beschreibt die kurz- und langfristigen physischen und psychischen Auswirkungen regelmäßigen Cannabiskonsums im Jugendalter, unter besonderer Berücksichtigung der noch nicht vollständig entwickelten Gehirnentwicklung. Zusätzlich werden die strafrechtlichen Folgen erläutert (genaue Inhalte sind in der vorliegenden Vorlage nicht detailliert).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Cannabis, Cannabiskonsum, Jugendliche, Drogenkonsum, Folgen, Motive, Legalisierung, THC, CBD, Endocannabinoidsystem, Abhängigkeit, Strafrecht.
Welchen Zweck verfolgt das Vorwort?
Das Vorwort führt in das Thema Cannabis und die aktuelle Legalisierungsdebatte ein. Es betont die Bedeutung des Themas für die Entwicklung von Jugendlichen und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der medizinische und psychiatrische Aspekt wird nur am Rande erwähnt. Die Arbeit soll einen konzentrierten Überblick bieten und die Auseinandersetzung mit der Legalisierungsdebatte unterstützen.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die deren jeweilige Inhalte kurz und prägnant beschreibt.
- Quote paper
- Denis Ley (Author), 2018, Kult oder Flucht. Motive und Folgen eines regelmäßigen Cannabiskonsums durch Jugendliche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/435616