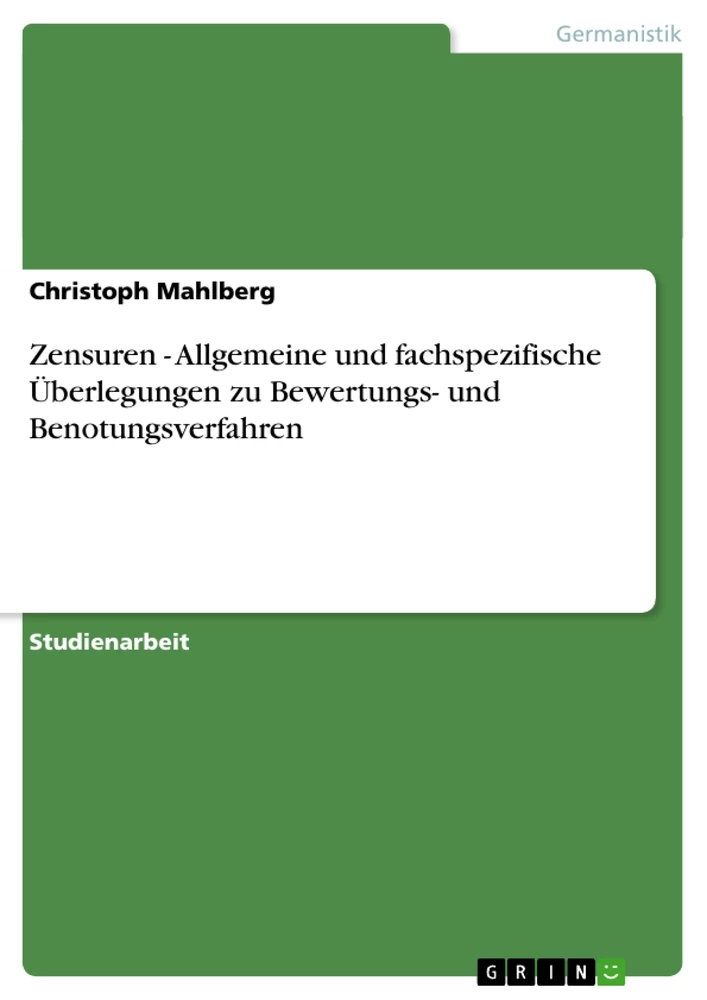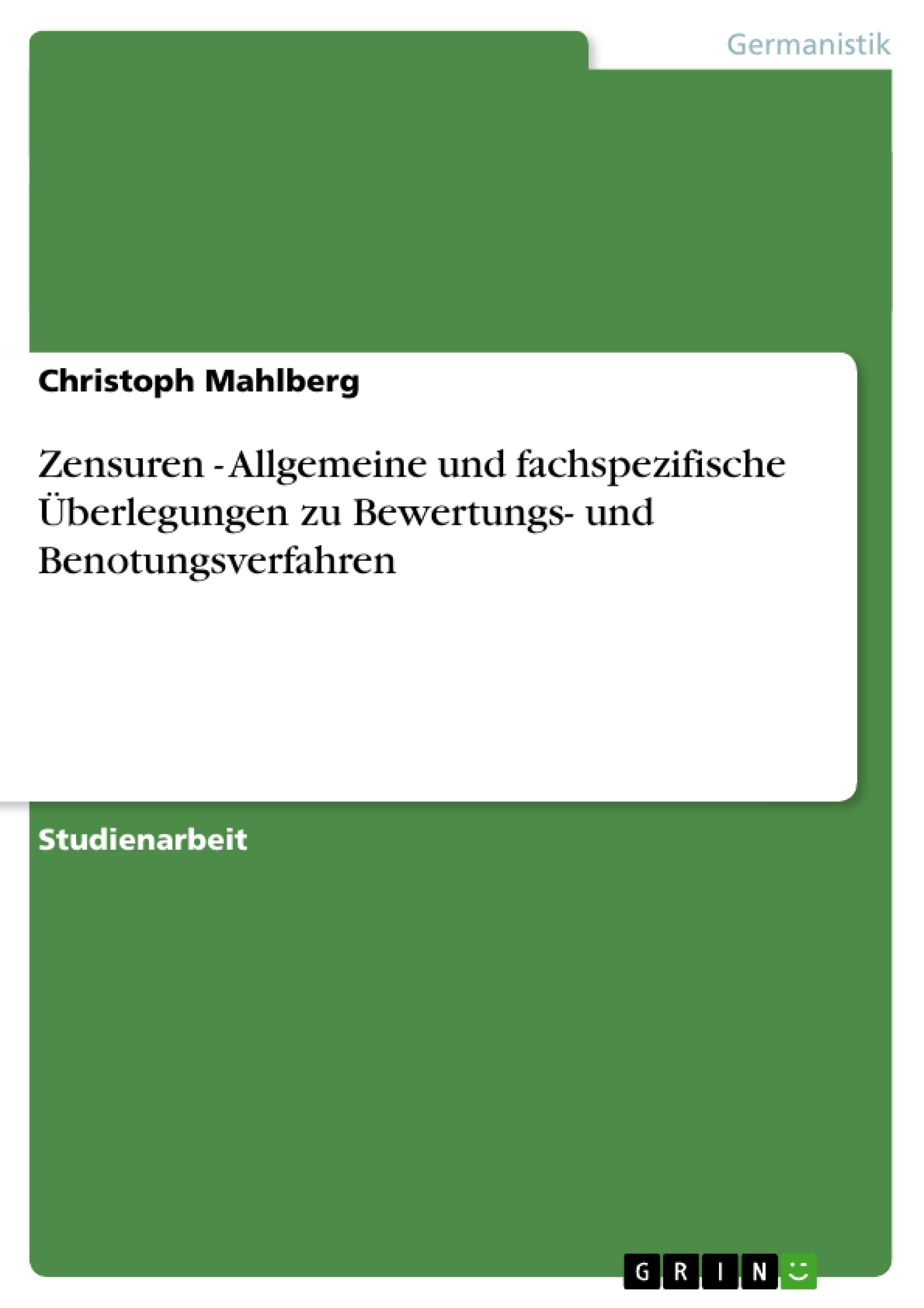Kredit auf Schulnoten? Diese Information aus Fernost löst bei den meisten wohl Kopfschütteln und Unverständnis aus. Dieses vielleicht abstruse Extrembeispiel zeigt, wie Notengebung realisiert werden kann. Zwar handelt es sich hierbei nicht um Artikel einer pädagogischen Fachzeitschrift, aber der Grundgedanke „Notengebung“ wird auf glossenartige Weise dem Leser vor Auge geführt. Aber auch in Deutschland steht die Notengebung schon seit Jahren im Brennpunkt der Kritik. Hierbei gehen die Meinungen der Pädagogen teilweise weit auseinander. Auf der einen Seite praktizieren reformpädagogische Schulen, wie z.B. Waldorfschulen einen eher offenen Umgang mit Noten, andererseits wird eine strenge, klassische Notengebung gefordert.
Was ist eine Note? Wie kommt eine Note zustande? Wo liegen Probleme und wie kann man diese Probleme, die bei einer Bewertung (die dann zu einer Note führt) entstehen, verringern? Diese Fragen sind in etwa die Leitgedanken, mit deren Hilfe ich diese Arbeit verfasst habe.
Zu Beginn der Arbeit stelle ich allgemeine Themen in den Mittelpunkt, die sich mit dem Diagnostizieren und der damit verbundenen Notengebung befassen. Dieser Teil der Arbeit ist allgemeiner Natur, das heißt, ich werde zu Beginn die Thematik noch nicht fachspezifisch erläutern um vorerst Grundlagen zu legen, die für das „Notenverständnis“ notwendig sind.
Anhand von Beispielen werde ich dann spezifische Überlegungen zum Fach Deutsch anstellen. Ich beziehe mich auf Überlegungen der Fachliteratur, die Vorschläge zur Verbesserung von Bewertungs- und Benotungspraktiken macht.
Mit dieser Arbeit wollte ich einen, sowohl allgemeinen, als auch fachspezifischen Überblick geben. Dies ist also nur ein „Ausschnitt“ vieler Überlegungen, die mittlerweile im pädagogischen Kontext diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort / Einleitung
- Leistungsbeurteilung durch Lehrer
- Zwei Arten des Diagnostizierens
- Die Beeinflussung einer Leistungsmessung
- Die Note
- Die Grundfunktion der Schulzensur
- Inhalte einer Zensur
- Probleme der Notengebung
- Notengebung – Ein Beispiel
- Bewertungsmöglichkeiten - Bedeutung und Probleme
- Das Diktat
- Der Aufsatz
- Sorgenkind Aufsatz
- Ein taugliches Prüfungsinstrument?
- Möglichkeiten der Aufsatzkorrektur
- Veröffentlichung und prozessorientiertes Korrigieren von Schüleraufsätzen
- Der Kriterienkatalog – Eine Möglichkeit der Bewertung
- Bewertung einer Fantasieerzählung
- Abschließende Bemerkung des Verfassers
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bewertung und Benotung von Schülerleistungen, sowohl allgemein als auch spezifisch im Fach Deutsch. Ziel ist es, einen Überblick über die verschiedenen Aspekte der Notengebung zu geben und Probleme aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Bewertungsansätze und diskutiert mögliche Verbesserungen.
- Allgemeine und fachspezifische Überlegungen zur Leistungsbeurteilung
- Analyse verschiedener Bewertungsverfahren und deren Vor- und Nachteile
- Probleme der Notengebung und deren Auswirkungen auf Schüler
- Möglichkeiten zur Verbesserung der Bewertungspraxis
- Der Aufsatz als Beispiel für eine komplexe Bewertungsaufgabe
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort / Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Beispiel aus China, wo Schüler Schulnoten als Hypotheken verwenden, um die Problematik der Notengebung und deren unterschiedliche Ausprägungen in verschiedenen Systemen zu illustrieren. Die Arbeit zielt darauf ab, die Frage nach dem Wesen der Note, ihrer Entstehung und möglichen Problemen zu beantworten und Lösungsansätze aufzuzeigen. Sie beginnt mit allgemeinen Überlegungen zum Diagnostizieren und zur Notengebung, bevor sie fachspezifische Aspekte im Deutschunterricht behandelt.
Leistungsbeurteilung durch Lehrer: Dieses Kapitel betont die zentrale Rolle der Leistungsbeurteilung im Lehrerberuf. Es differenziert zwischen expliziten und impliziten Urteilen. Explizite Urteile basieren auf konkreten Daten (z.B. Klassenarbeiten), während implizite Urteile intuitive Einschätzungen während des Unterrichts darstellen. Der Einfluss verschiedener Faktoren auf die Objektivität der Beurteilung wird ebenfalls diskutiert.
Die Note: Dieses Kapitel befasst sich mit der Grundfunktion und den Inhalten einer Schulnote. Es wird die Mehrdeutigkeit der Note als Ausdruck von Leistung, aber auch von anderen Faktoren, beleuchtet. Die Diskussion legt den Grundstein für die folgenden Kapitel, die sich mit den Herausforderungen der Notengebung auseinandersetzen.
Probleme der Notengebung: Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen bei der Notengebung anhand von Beispielen. Es wird gezeigt, wie verschiedene Faktoren zu Verzerrungen führen können, und es werden die Grenzen der Objektivität und Fairness von Noten verdeutlicht. Ein konkretes Beispiel aus der Praxis veranschaulicht die Problematik.
Bewertungsmöglichkeiten - Bedeutung und Probleme: Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung und die Probleme bei der Bewertung von Diktat und Aufsatz. Der Aufsatz wird als besonders problematisches Beispiel für die Notengebung dargestellt, da er subjektiven Interpretationen unterliegt. Die Schwierigkeiten bei der objektiven Bewertung von kreativen Leistungen werden hervorgehoben.
Möglichkeiten der Aufsatzkorrektur: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Ansätze zur Aufsatzkorrektur, darunter die Veröffentlichung und das prozessorientierte Korrigieren. Ein besonderer Fokus liegt auf der Verwendung von Kriterienkatalogen zur Verbesserung der Objektivität und Transparenz der Bewertung. Ein Beispiel zur Bewertung einer Fantasieerzählung wird dargelegt.
Schlüsselwörter
Notengebung, Leistungsbeurteilung, Diagnostizieren, explizite und implizite Urteile, Bewertung, Benotung, Aufsatz, Diktat, Kriterienkatalog, Schulzensur, Objektivität, Fairness, Deutschunterricht, pädagogische Praxis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit "Leistungsbeurteilung im Deutschunterricht"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit befasst sich umfassend mit der Leistungsbeurteilung und Notengebung im Deutschunterricht, beleuchtet allgemeine Prinzipien und geht auf spezifische Herausforderungen bei der Bewertung von Schülerleistungen ein. Sie analysiert verschiedene Bewertungsansätze, zeigt Probleme auf und diskutiert mögliche Verbesserungen der Bewertungspraxis.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie die verschiedenen Arten des Diagnostizierens, die Funktion und die Probleme der Schulnote, die Bewertung von Diktat und Aufsatz, die Objektivität und Fairness von Noten, verschiedene Aufsatzkorrekturmethoden (prozessorientiertes Korrigieren, Kriterienkataloge) und die Bedeutung expliziter und impliziter Urteile bei der Leistungsbeurteilung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Schwierigkeiten bei der objektiven Bewertung kreativer Leistungen wie dem Aufsatz.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Vorwort/Einleitung, Leistungsbeurteilung durch Lehrer, Die Note, Probleme der Notengebung, Bewertungsmöglichkeiten - Bedeutung und Probleme, Möglichkeiten der Aufsatzkorrektur und Abschließende Bemerkung des Verfassers. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Leistungsbeurteilung und Notengebung.
Welche Probleme der Notengebung werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Mehrdeutigkeit von Noten, die Schwierigkeiten bei der objektiven Bewertung, insbesondere von Aufsätzen, den Einfluss subjektiver Faktoren auf die Benotung und die potenziellen Auswirkungen ungerechter oder intransparenter Bewertung auf Schüler. Konkrete Beispiele illustrieren die beschriebenen Probleme.
Welche Lösungsansätze oder Verbesserungsvorschläge werden angeboten?
Die Arbeit schlägt verschiedene Lösungsansätze vor, darunter die Verwendung von Kriterienkatalogen zur Verbesserung der Objektivität und Transparenz der Bewertung, die Anwendung prozessorientierter Korrekturmethoden bei Aufsätzen und eine kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen der Notengebung als alleiniges Messinstrument für Schülerleistungen.
Welche Rolle spielt der Aufsatz in der Arbeit?
Der Aufsatz dient als Beispiel für eine komplexe Bewertungsaufgabe, die besonders anfällig für subjektive Interpretationen ist. Die Arbeit analysiert die Schwierigkeiten bei der objektiven Bewertung von Aufsätzen und diskutiert verschiedene Methoden zur Verbesserung der Fairness und Transparenz der Bewertung.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an Lehrer, Dozenten und alle, die sich mit der Thematik der Leistungsbeurteilung und Notengebung auseinandersetzen. Sie bietet wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Möglichkeiten der Bewertungspraxis.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Notengebung, Leistungsbeurteilung, Diagnostizieren, explizite und implizite Urteile, Bewertung, Benotung, Aufsatz, Diktat, Kriterienkatalog, Schulzensur, Objektivität, Fairness, Deutschunterricht, pädagogische Praxis.
- Quote paper
- Christoph Mahlberg (Author), 2004, Zensuren - Allgemeine und fachspezifische Überlegungen zu Bewertungs- und Benotungsverfahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43581