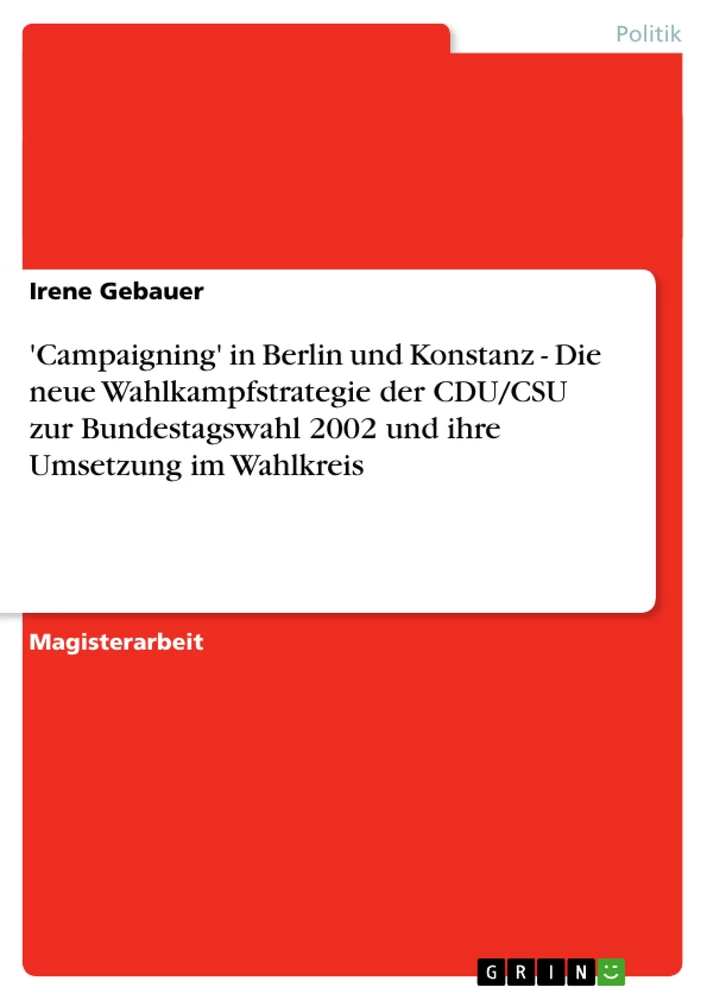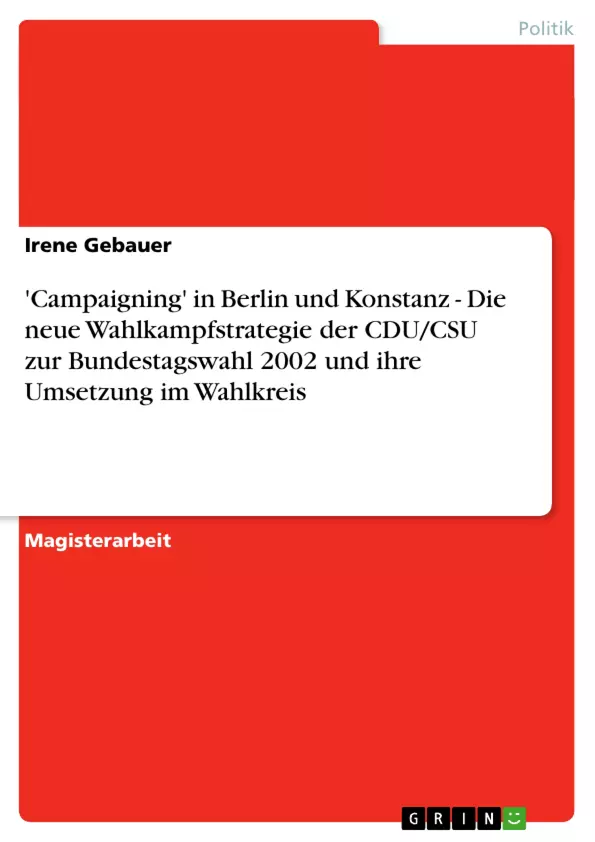„Berlin, 13. September 2002. Die Uhr im Deutschen Bundestag steht auf zwei Minuten nach neun. Edmund Stoiber steht hinter dem Rednerpult. Vor ihm liegt sein Manuskript. Es hat 26 Seiten. Es ist seine letzte große Rede vor der Wahl. Vielleicht ist es seine wichtigste Rede der letzten neun Monate. Er redet fast 40 Minuten lang. Über Zahlen, über Statistiken, über Bilanzen. Vom Krieg, vom Niedriglohnsektor, vom Weltwirtschaftsforum und von der Tabaksteuer. Dann geht Gerhard Schröder an das Pult. Er stopft eine Hand in die Hosentasche, er dreht den Kopf zum Kandidaten und sagt: ‚Herr Stoiber, Ihre Rede hat eines deutlich gemacht: Sie wollen vielleicht Kanzler werden, aber Sie haben nicht die Fähigkeiten dazu’“1.
Diese Impression aus den letzten Wochen des Bundestagswahlkampfes 2002 symbolisiert für CDU/CSU einen dramatischen Wendepunkt, der sich schon zuvor angedeutet hatte: Nach einem erfolgreich verlaufenen Wahlkampf war die Stimmung durch kurzfristige und unvorhergesehene Ereignisse umgeschlagen, die Umfragen signalisierten zum ersten Mal seit Monaten wieder einen knappen Vorsprung der rot-grünen Regierung, und der bereits sicher geglaubte Sieg der Union schien erstmalig gefährdet. Einige Tage später drückte sich dieser Umschwung im knappsten Wahlergebnis aller bisherigen Wahlen zum Deutschen Bundestag aus. Edmund Stoiber hatte es nicht geschafft.
Was sind die Fähigkeiten, die man braucht, um Kanzler zu werden? Diese Frage enthält eine gewisse Doppeldeutigkeit. Ungeachtet dessen, ob Gerhard Schröders Satz Edmund Stoiber die Fähigkeit absprechen sollte, Kanzler zu sein, oder auch nur, Kanzler zu werden, befasst sich die vorliegende Arbeit mit letzterem: dem Weg von Politikern durch die stürmische Zeit der Wahlkämpfe, und damit auch mit den Veränderungen, die diese direkteste Form der Bewerbung für ein politisches Amt in ihrer Geschichte und besonders in jüngster Zeit durchlaufen hat. Welche Rolle spielt der Wahlkampf im politischen Konzert und wie ist ein moderner Wahlkampf aufgebaut?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wahlen, Wahlkampf und Wahlkampfkommunikation in Deutschland
- Politische Kommunikation und Wahlkampf
- Wahlen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland
- Begriff und Funktion von Wahlen
- Strukturmerkmale und Grundlagen des deutschen Wahlsystems
- Der Wahlkampf: Definition, Stellenwert und Funktion
- Politischer, medialer und gesellschaftlicher Wandel
- Parteien im Wandel
- Medien im Wandel
- Wählerschaft im Wandel
- Die Wahlkampfkommunikation
- Funktionen von Wahlkampfkommunikation
- Die symbolische Dimension von Wahlkampfkommunikation
- Die Wahlkampagne
- Aufgabe und Ziel
- Wahlkampfplanung
- Analyse der Ausgangssituation
- Targeting
- Opposition Research
- Strategie und Botschaft
- Analyse der Ausgangssituation
- Zentrale Kampagnenformen
- Die Leitkampagne
- Die Themenkampagne
- Die Personen- und Imagekampagne
- Die Negativkampagne
- Die Internetkampagne
- Die Kampagne in den Massenmedien
- Die Mobilisierungskampagne
- Die Werbekampagne
- Wahlkampf und Wahlkampfkommunikation in den USA
- Das politische System der USA
- Präsidentielles Regierungssystem, Mehrheitswahlrecht und Rolle der Parteien
- Das Mediensystem der USA
- Campaigning “à l'américain” – US-amerikanische Wahlkämpfe in historischer Perspektive
- Vormodernes, modernes und professionalisiertes Campaigning
- Postmodern Campaigning – Innovationen in US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkämpfen 1988-2000
- Trends im Präsidentschaftswahlkampf von 1988
- Trends im Präsidentschaftswahlkampf von 1992
- Trends im Präsidentschaftswahlkampf von 1996
- Trends im Präsidentschaftswahlkampf von 2000
- Das politische System der USA
- Die These von der Amerikanisierung des Wahlkampfes
- Die Grundzüge und Merkmale der Amerikanisierungsdebatte
- Ausgangspunkt der Amerikanisierungsthese
- Amerikanisierung als Kulturtransfer
- Die Amerikanisierung der politischen Kommunikation
- Deutung der verschiedenen Amerikanisierungskonzepte: Amerikanisierung oder Modernisierung?
- Die Amerikanisierung des Wahlkampfes
- Die Merkmale der Amerikanisierung
- Die Professionalisierung als Hauptmerkmal der Amerikanisierung von Wahlkämpfen
- Die Personalisierung der Wahlkämpfe
- Die Mediatisierung der Wahlkämpfe
- Die Grundzüge und Merkmale der Amerikanisierungsdebatte
- Der Wahlkampf von CDU/CSU zur Bundestagswahl 2002
- Rückblick und Ausgangslage
- Die Niederlage: CDU/CSU und die Bundestagswahl 1998
- Die Phase der Neuorientierung: CDU/CSU vor der Bundestagswahl 2002
- Die gemeinsame Kampagnenstruktur von CDU/CSU zur Bundestagswahl 2002
- Wahlkampfbudget und Wahlkampfzentrale
- Kampagnen
- Die Kompetenzkampagne
- Die Angriffskampagne
- Die Negativkampagne
- Die Online-Kampagne
- Der Kanzlerkandidat
- Der Kandidat als „Mann ohne Eigenschaften“?
- Der Kandidat zwischen Oder-Flut und Irak-Frage
- Der Medienberater
- Die Umsetzung der Wahlkampfstrategie im Wahlkreis Konstanz: „Politik für Menschen“
- Die Organisation und die inhaltliche Ausrichtung der Wahlkampagne
- Die Bewertung der Wahlkampagne
- Die Bilanz der Bundestagswahl 2002 und die Bewertung der Wahlkampfstrategie von CDU/CSU
- Rückblick und Ausgangslage
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Wahlkampfstrategie der CDU/CSU zur Bundestagswahl 2002 und ihre Umsetzung im Wahlkreis Konstanz. Sie befasst sich mit den Veränderungen, die der Wahlkampf in seiner Geschichte durchlaufen hat und insbesondere mit der These von der „Amerikanisierung“ des Wahlkampfes. Die Arbeit analysiert die Strategie und die Umsetzung des Wahlkampfes von CDU/CSU und setzt ihn in den Kontext der aktuellen Entwicklungen in der politischen Kommunikation in Deutschland und den USA.
- Wahlkampfstrategie der CDU/CSU zur Bundestagswahl 2002
- Die These von der „Amerikanisierung“ des Wahlkampfes
- Veränderungen im Wahlkampf in Deutschland und den USA
- Politische Kommunikation in Deutschland und den USA
- Die Rolle des Wahlkampfes im politischen System
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Arbeit stellt die Problematik des Wahlkampfes im Kontext der Bundestagswahl 2002 und der „Amerikanisierung“ des Wahlkampfes vor.
- Kapitel 2: Wahlen, Wahlkampf und Wahlkampfkommunikation in Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Wahlen und Wahlkampf im deutschen politischen System und die Entwicklung der Wahlkampfkommunikation.
- Kapitel 3: Die Wahlkampagne: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Formen von Wahlkampagnen, ihre Planung und Umsetzung.
- Kapitel 4: Wahlkampf und Wahlkampfkommunikation in den USA: Dieses Kapitel beschreibt das politische System der USA und die Entwicklung der Wahlkampagnen in den USA.
- Kapitel 5: Die These von der Amerikanisierung des Wahlkampfes: Dieses Kapitel untersucht die Debatte um die „Amerikanisierung“ des Wahlkampfes und ihre Auswirkungen auf die politische Kommunikation in Deutschland.
- Kapitel 6: Der Wahlkampf von CDU/CSU zur Bundestagswahl 2002: Dieses Kapitel analysiert die Strategie und die Umsetzung des Wahlkampfes von CDU/CSU zur Bundestagswahl 2002 und setzt ihn in den Kontext der aktuellen Entwicklungen in der politischen Kommunikation in Deutschland und den USA.
Schlüsselwörter
Wahlkampf, Wahlkampfkommunikation, Politische Kommunikation, Amerikanisierung, CDU/CSU, Bundestagswahl 2002, Strategie, Umsetzung, Targeting, Opposition Research, Medien, Wählerschaft, politische System, USA, Deutschland, Professionalität, Personalisierung, Mediatisierung, Konstanz, Wahlkreis.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Besonderheit des CDU/CSU-Wahlkampfes 2002?
Der Wahlkampf war geprägt von neuen Strategien wie „Campaigning“ und einer zunehmenden Professionalisierung, scheiterte aber letztlich knapp gegen die rot-grüne Regierung.
Was versteht man unter der „Amerikanisierung“ des Wahlkampfes?
Dieser Begriff beschreibt den Transfer von US-Wahlkampfmethoden wie Personalisierung, Mediatisierung und dem Einsatz von professionellen Medienberatern nach Deutschland.
Welche Rolle spielten unvorhergesehene Ereignisse im Jahr 2002?
Ereignisse wie die Oder-Flut und die Debatte um den Irak-Krieg führten zu einem Stimmungsumschwung kurz vor dem Wahltag.
Was ist „Opposition Research“?
Es ist die systematische Analyse der Schwächen des politischen Gegners, um diese gezielt im Wahlkampf (z.B. in Negativkampagnen) einzusetzen.
Wie wurde die Strategie im Wahlkreis Konstanz umgesetzt?
Die Arbeit analysiert die lokale Kampagne „Politik für Menschen“ und wie die zentralen Vorgaben aus Berlin auf die regionale Ebene übertragen wurden.
- Quote paper
- Irene Gebauer (Author), 2004, 'Campaigning' in Berlin und Konstanz - Die neue Wahlkampfstrategie der CDU/CSU zur Bundestagswahl 2002 und ihre Umsetzung im Wahlkreis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43585