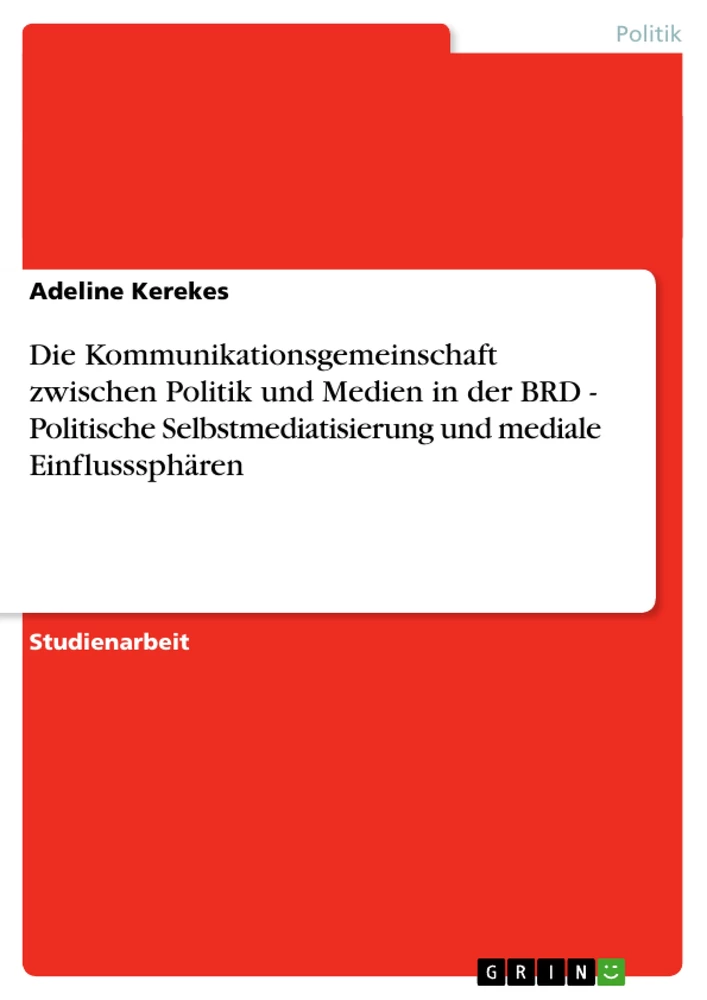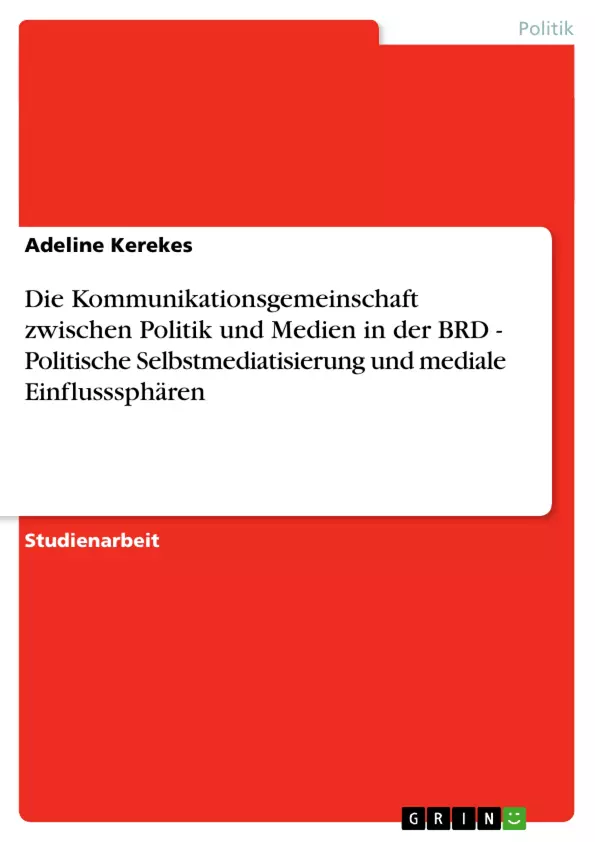Das Verhältnis zwischen Politik und Medien stellt nicht nur in der Bundesrepublik einen zentralen Punkt der wissenschaftlichen Betrachtung dar, sondern auch in allen anderen Demokratien. Öffentlichkeit, Legitimation, der Akt der demokratischen Willensbildung durch das Volk stellen in der sich ausdifferenzierenden Gesellschaft eine besondere Herausforderung für die politische Sphäre dar. Massenmedien werden unumgänglicher und gewichtiger Akteur bei der Verteilung von Aufmerksamkeits- und damit Legitimationskriterien. Das Massenmedium ist daher nicht von vornherein als ‚Störfaktor’ für die Kommunikation zwischen Volksvertretern und Staatsbürgern zu betrachten, sondern als Determinante für das Funktionieren einer jeden Demokratie. Natürlich kommt es zu konflikthaften und konsensbedürftigen Spannungen; ob sie jedoch in einem unausweichlichen Dilemma für die Demokratie resultieren bleibt ein erörterungsbedürftiger Punkt meiner Hausarbeit.
Dafür gehe ich einleitend auf die Wichtigkeit von Öffentlichkeit in der Demokratie ein. Was bedeutet Öffentlichkeit für das Funktionieren einer jeden Demokratie? Und kann man von einem Übergang von der Parteiendemokratie in eine Mediokratie, wie es Thomas Meyer (2002, S.7-14) in seinem Aufsatz beschreibt, überhaupt sprechen? Dass Medien zunehmend meinungsbildende und -bestimmende Funktionen wahrnehmen, scheint eine Begleiterscheinung des Mediatisierungsprozesses zu sein, doch auch nach der Legitimation dieser Rollenwahrnehmung muss gefragt werden.
Daher ist weiterer Punkt dieser Abhandlung die Anpassung der Politik an diese neuen Tendenzen: Zentrale Fragen sind hierbei der Grund für die neue Öffentlichkeitsbedürftigkeit und Politkvermittlung, Art und Weise der Anpassung, sowie die Ausprägung der neuartigen Politikvermittlung.
Auch die Massenmedien verdienen einen näheren Blick auf ihre scheinbar gewachsenen Machtpotentiale, Einflusssphären und Funktionen. Wichtig erscheint es mir ebenfalls, die Ausprägung des Verantwortungsbewusstseins der Medienakteure bezüglich ihrer Vermittlungsrolle und -gewalt kritisch zu hinterfragen und zu beleuchten. Wie nahe liegt also die Vermutung, dass die gewachsene Gewalt auch sinnbringend zum Einsatz kommt?
In einer Synthese im weiteren Punkt werden die Überlegungen bezüglich der Öffentlichkeitsbedürftigkeit, der neuen Rolle der Politik und Medien bezugnehmend auf meine Fragestellung zusammengeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Öffentlichkeit und Demokratie
- Bedeutung des Begriffes „Öffentlichkeit“
- Parteiendemokratie oder Mediokratie? Problematisierung des Verhältnisses zwischen Politik und Medien
- Selbstmediatisierung der Politik
- Politikvermittlung als Legitimationsgrundlage
- Zwischen Images, Theatralisierung und Inszenierung
- Politik als Kommunikationsprozess: Die Rolle der Sprache
- Einfluss der Medien
- Funktion und Rolle der Massenmedien
- Massenmedien als vierte Gewalt?
- Medienpflichten und Medienverantwortung
- Symbiotische Kommunikationsgemeinschaft zwischen Politik und Medien
- Gegenseitige Einflusssphären
- Spannungsfelder und Probleme für die Demokratie
- Chancen Ausblick
- Zusammenfassung
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Politik und Medien in der Bundesrepublik Deutschland. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der gegenseitigen Einflusssphären und der daraus resultierenden Spannungsfelder für die Demokratie.
- Die Bedeutung von Öffentlichkeit für die Funktionsweise der Demokratie
- Die Rolle der Massenmedien in der politischen Willensbildung
- Die Selbstmediatisierung der Politik und ihre Auswirkungen auf die Medienlandschaft
- Die Frage der Medienmacht und die Verantwortung der Medienakteure
- Die Herausforderungen und Chancen für die Demokratie im Zeitalter der Medien
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung liefert einen Überblick über das Thema der Arbeit und die wichtigsten Forschungsfragen. Sie betont die Relevanz des Themas und stellt die zentralen Punkte der Argumentation vor.
- Öffentlichkeit und Demokratie: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung des Begriffs "Öffentlichkeit" für die Funktionsweise der Demokratie. Es werden verschiedene Aspekte der öffentlichen Meinungsbildung und des Verhältnisses zwischen Politik und Öffentlichkeit beleuchtet. Zudem wird die Frage nach einem möglichen Übergang von der Parteiendemokratie zur Mediokratie diskutiert.
- Selbstmediatisierung der Politik: Dieses Kapitel widmet sich der Anpassung der Politik an die neuen Bedingungen der medialen Öffentlichkeit. Es werden die Motive, Formen und Auswirkungen der Selbstmediatisierung der Politik untersucht.
- Einfluss der Medien: Dieses Kapitel analysiert die Macht und den Einfluss der Medien in der Gesellschaft. Es beleuchtet die Funktionen der Massenmedien, die Frage der vierten Gewalt und die Rolle der Medienverantwortung.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit lassen sich mit den folgenden Begriffen zusammenfassen: Öffentlichkeit, Demokratie, Medien, Politik, Selbstmediatisierung, Macht, Einfluss, Verantwortung, Spannungsfelder, Kommunikation, Willensbildung, Legitimation.
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Verhältnis zwischen Politik und Medien in Deutschland?
Das Verhältnis ist durch eine symbiotische Kommunikationsgemeinschaft geprägt. Medien sind unumgängliche Akteure für die politische Legitimation, während die Politik versucht, mediale Aufmerksamkeitsregeln für sich zu nutzen.
Was bedeutet der Begriff "Selbstmediatisierung der Politik"?
Politik passt sich zunehmend den Logiken der Massenmedien an. Dies äußert sich in der Inszenierung von Themen, der Theatralisierung von Ereignissen und einer gezielten Imagepflege durch Politiker.
Was ist der Unterschied zwischen Parteiendemokratie und Mediokratie?
In der Parteiendemokratie findet die Willensbildung primär innerhalb politischer Organisationen statt. In einer Mediokratie (nach Thomas Meyer) übernehmen Medien die zentrale Rolle bei der Bestimmung politischer Themen und der öffentlichen Meinung.
Können Massenmedien als "vierte Gewalt" bezeichnet werden?
Medien haben eine Kontrollfunktion und beeinflussen die politische Agenda massiv. Ob sie jedoch als vierte Gewalt agieren, hängt stark von ihrem Verantwortungsbewusstsein und ihrer Unabhängigkeit ab.
Welche Gefahren birgt die Mediatisierung für die Demokratie?
Spannungsfelder entstehen, wenn Inszenierung wichtiger wird als Sachpolitik. Dies kann zu einem Verlust an politischer Substanz führen und die demokratische Willensbildung durch populistische Tendenzen verzerren.
- Quote paper
- Adeline Kerekes (Author), 2005, Die Kommunikationsgemeinschaft zwischen Politik und Medien in der BRD - Politische Selbstmediatisierung und mediale Einflusssphären, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43590