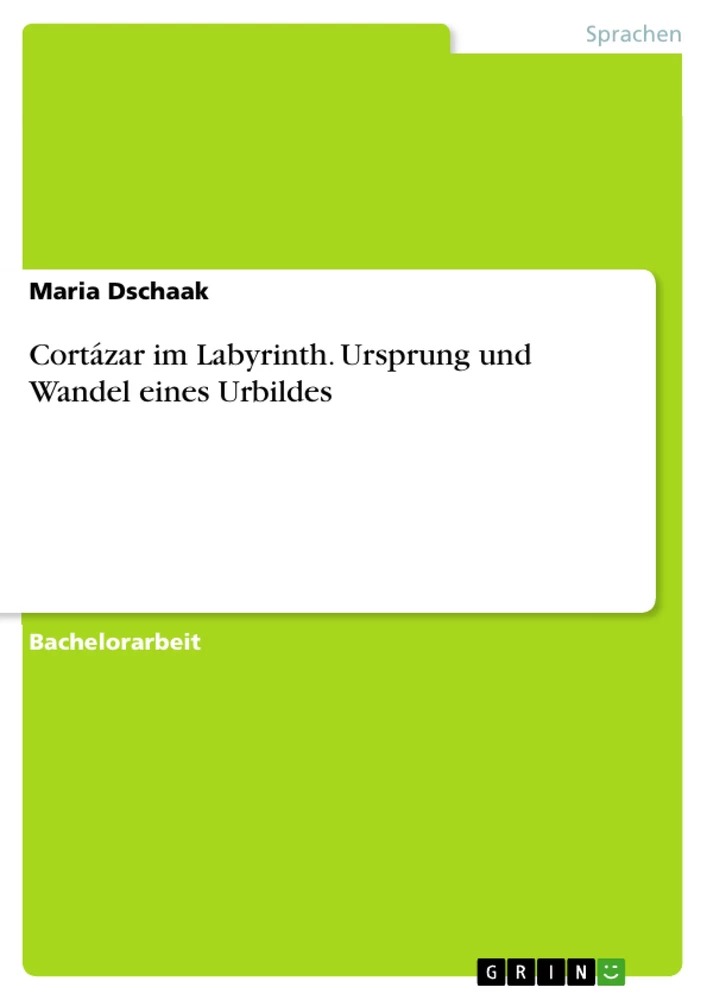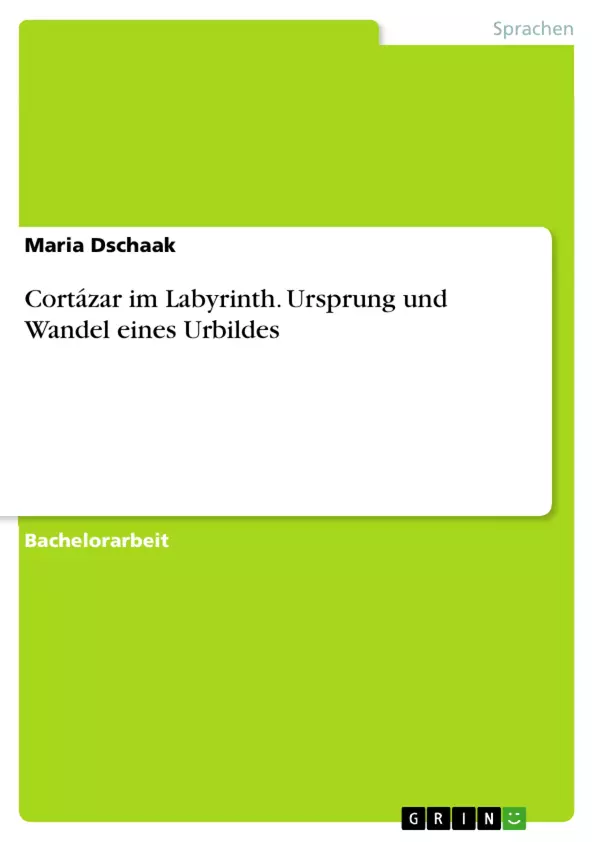Da in der deutschsprachigen Literaturwissenschaft literarische Hypertexte weitestgehend ignoriert werden, wird versucht werden, das Phänomen Hypertext an dem 1963 veröffentlichtem Roman Rayuela des argentinischen Schriftstellers Julio Cortázar zu reflektieren. Aufgrund des mise-en-abyme – die Figur des Morelli ist Cortázars Alter Ego – wird der Roman von sich selbst reflektiert und thematisiert, weist also eine metatextuelle Ebene auf, die für die Analyse besonders interessant erscheint.
Rayuela ist in drei Teile unterteilt: Der erste Teil namens del lado de allá erzählt von der Hauptfigur Horacio Oliveira, einem aus Argentinien nach Frankreich eingewanderten Intellektuellen, seinem Leben mit seiner Freundin Maga und den Mitgliedern des Clubs de la Serpiente. Nach dem Tod von Magas Sohn Rocamadour kehrt Oliveira zurück nach Buenos Aires und der zweite Teil, del lado de acá, beginnt. Dort geht er wieder eine Beziehung mit seiner damaligen Freundin Gekrepten ein und arbeitet zuerst mit seinen Freunden Traveler und Talita in einem Zirkus und nachher in einer Irrenanstalt. Zu diesen bereits handlungsarmen beiden Teilen, gesellt sich der dritte Teil mit dem irreführenden, selbstironischen Namen de otros lados (capítulos prescindibles). Dieser enthält neben einzelnen Kapiteln zu der Geschichte, Metakommentare der Figur Morelli, die in den ersten beiden Teilen nur als Mann, der einen Autounfall erlitt, präsent ist, im dritten Teil aber zu Wort kommt und eine neue Romanpoetik entwirft. Morelli nimmt eine Sonderstellung im Roman ein, da seine Kommentare den Roman beschreiben, den der Leser soeben vor sich hat. Hinzu kommen eine Fülle von Texten heterogener Herkunft aus Literatur und Presse: Zeitungsausschnitte, Zitate, Songtexte und ähnliches.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der antike Basistext
- Zwei überlieferte Komplexe
- Drei Perspektiven auf das Labyrinth
- Der gewebte Text - Literatur als Labyrinth
- Hypertexte: Ursprung, Definition und Formen
- Merkmale
- Vernetzung
- Grenzenlosigkeit
- Nicht-Linearität
- Dezentriertheit
- Leser und Autor - verloren im Labyrinth?
- Schreiben
- Suche durch das Labyrinth der Zeichen
- Logozentrismus versus Zen-Buddhismus
- Die Sprache
- Suche durch das Labyrinth der Zeichen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Labyrinth als Metapher in der Literatur und insbesondere im Kontext von Hypertexten. Sie untersucht die Entwicklung des Labyrinth-Begriffs von der antiken Mythologie bis hin zur modernen Literatur, wobei der Fokus auf der Verbindung zwischen räumlicher Struktur und metaphysischer Bedeutung liegt.
- Der Labyrinth-Begriff und seine vielschichtigen Interpretationen
- Die Rolle des Labyrinths als Gleichnis für Raum, Handlung und Kunstwerk
- Die Bedeutung von Hypertexten als literarische Form des Labyrinths
- Die Auswirkungen des Hypertextes auf die Positionen von Autor und Leser
- Die Herausforderungen des Schreibens und Lesens in einer hypertextuellen Umgebung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Labyrinth und Hypertext ein, wobei die Ambivalenz des Labyrinth-Begriffs hervorgehoben und verschiedene Typen von Labyrinthen vorgestellt werden.
Der antike Basistext
Dieses Kapitel befasst sich mit den mythologischen Ursprüngen des Labyrinth-Begriffs. Es werden die beiden wichtigsten Erzählkomplexe um Theseus und Dädalus vorgestellt, die sich mit der Erschaffung des Labyrinths, dem Minotaurus und der Flucht des Theseus beschäftigen.
Der gewebte Text - Literatur als Labyrinth
Der Abschnitt beleuchtet den Zusammenhang zwischen Literatur und Labyrinth. Hypertexte werden als moderne Form des Labyrinths vorgestellt und deren Merkmale wie Vernetzung, Grenzenlosigkeit, Nicht-Linearität und Dezentriertheit werden näher erläutert.
Leser und Autor - verloren im Labyrinth?
Dieses Kapitel untersucht die Positionen von Autor und Leser in hypertextuellen Umgebungen. Es stellt die Herausforderungen dar, die sich für den Autor und den Leser durch die veränderte Struktur der Texte ergeben.
Schreiben
Das Kapitel behandelt den Aspekt des Schreibens im Kontext des Labyrinths. Es untersucht die Suche des Autors nach der richtigen Ausdrucksform und die Rolle der Sprache in der Konstruktion von Hypertexten.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind Labyrinth, Hypertext, Mythologie, Literatur, Raum, Metapher, Autor, Leser, Schreiben, Sprache, Vernetzung, Nicht-Linearität, Dezentriertheit.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Julio Cortázars Roman „Rayuela“?
Der Roman erzählt die Geschichte von Horacio Oliveira in Paris und Buenos Aires und bricht dabei mit traditionellen Erzählstrukturen durch ein nicht-lineares Lesesystem.
Was versteht man unter Literatur als „Labyrinth“?
Das Labyrinth dient als Metapher für komplexe Texte, in denen sich Leser und Autor durch Vernetzung und Nicht-Linearität verlieren oder neu finden können.
Was ist ein literarischer Hypertext?
Ein Hypertext ist ein Netzwerk von Textstücken, die nicht in einer festen Reihenfolge gelesen werden müssen. „Rayuela“ gilt als Vorläufer dieser digitalen Textform.
Wer ist die Figur Morelli im Roman?
Morelli ist eine Figur im dritten Teil des Romans, die als Alter Ego Cortázars fungiert und eine neue, revolutionäre Romanpoetik entwirft.
Welche Rolle spielt der antike Mythos des Labyrinths?
Die Arbeit zieht Parallelen zu den Mythen von Theseus und Dädalus, um die räumliche und metaphysische Struktur moderner Literatur zu erklären.
Wie verändert der Hypertext die Rolle des Lesers?
Der Leser wird vom passiven Konsumenten zum aktiven Mitgestalter, da er selbst entscheiden muss, welchen Pfad er durch das Textlabyrinth wählt.
- Quote paper
- Maria Dschaak (Author), 2009, Cortázar im Labyrinth. Ursprung und Wandel eines Urbildes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/436332