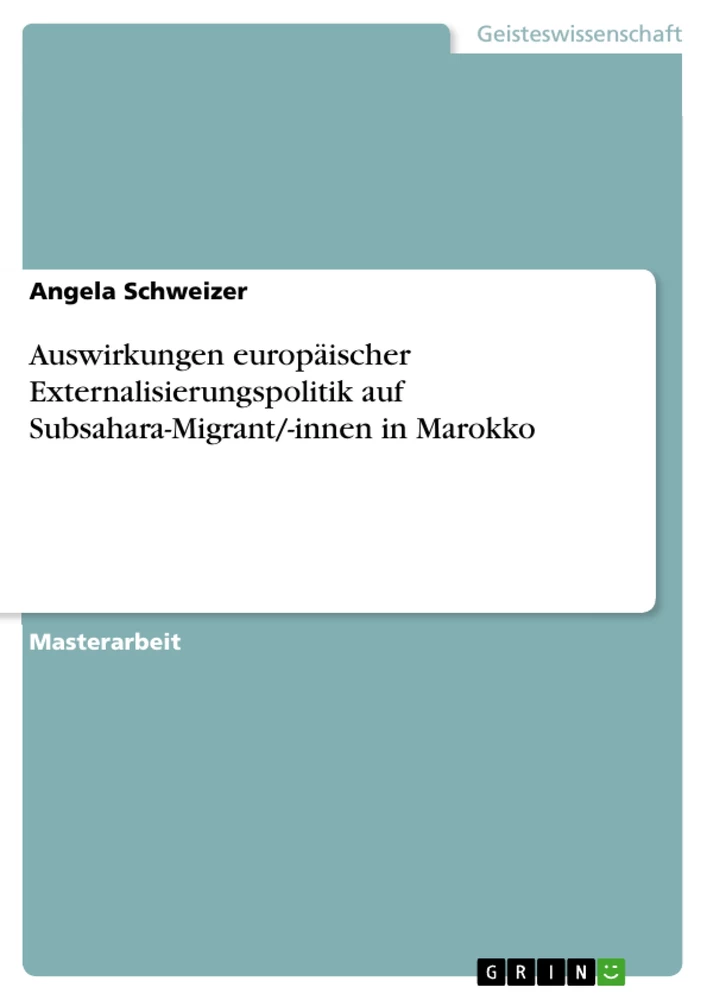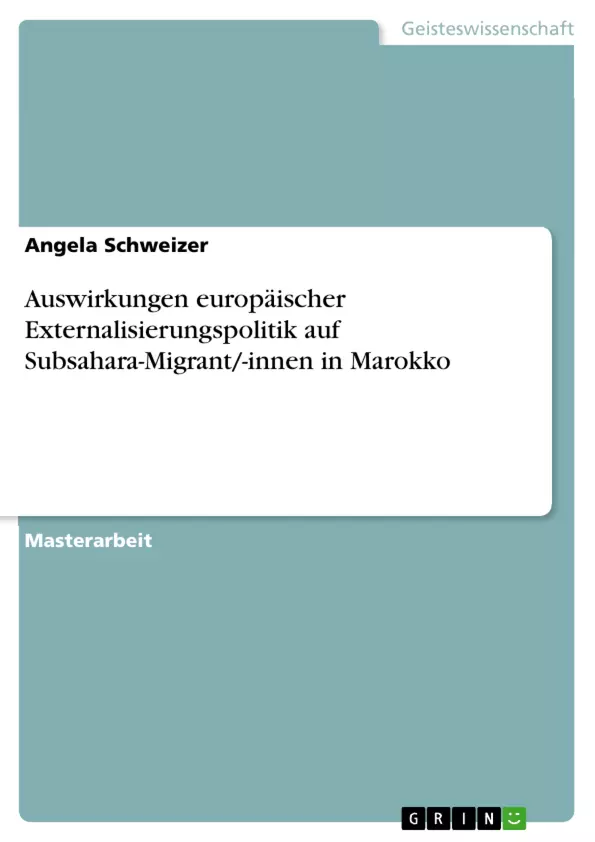Der wirtschaftliche Aufschwung nach Ende des Zweiten Weltkrieges führte in Europa zu einem großen Bedarf an ausländischen Arbeiterinnen, die nicht nur aus Südeuropa, sondern auch aus den ehemaligen Kolonien in millionenfacher Zahl angeworben wurden. Mit Beginn der Ölkrise in den 70er Jahren und den schweren Rezessionen, die diese in den Industriestaaten verursachte, beschlossen viele europäische Regierungen einen „Anwerbestopp“. Die folgenden jahrzehntelangen Anti-Einwanderungs-Diskurse fielen in den europäischen Nationalstaaten auf fruchtbaren Boden. Migrationspolitiken dienen dabei als Projektionsflächen und Austragungsorte „massiver gesellschaftlicher Konflikte“. Dies steht durchaus in einem Widerspruch zu Anwerbungskampagnen und -politiken, da ausländische Arbeitskräfte in der Wirtschaft dringend benötigt werden.
Mit dem Schengener Abkommen in den 90er Jahren fand eine Abschaffung der Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Union statt, was mit einer zunehmenden Abschottung nach „außen“ einherging. Die außereuropäischen Grenzen wurden zunehmend militarisiert, um mithilfe hochtechnologischer Mittel eine unerwünschte und irreguläre Immigration zu verhindern. Immer mehr setzte sich dabei die Politik durch, Flüchtlinge und Migrant_innen so nah wie möglich an ihren Herkunftsländern aufzuhalten. Diese Externalisierung europäischer Migrationspolitik wurde in jüngster Zeit massiv verstärkt. Große mediale Präsenz erhielt das Kooperationsabkommen mit der Türkei im Spätsommer 2015. Weniger beachtet wurden die Meilensteine europäischer Externalisierungspolitik, wie die Konferenz in Rabat im Jahr 2006, die als Folge der Einreiseversuche subsaharischer Migrant_innen in die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla in Marokko initiiert wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kontext der Forschung
- 2.1 Begriffsdefinition und Relevanz der Arbeit
- 2.2 Stand der Forschung
- 2.3 Afrikanische Migration im Spiegel europäischer Grenzpolitiken
- 2.4 Von Emigrations- zu Integrationsland? Geopolitischer und historischer Kontext Marokkos
- 3. Durchführung der Forschung
- 3.1 Selbstpositionierung
- 3.2 Auswahl, Anwendung und kritische Reflexion der Forschungsmethoden
- 3.3 Social-Media-Recherche
- 3.4 Die Migrantinnen und Migranten
- 4. Der Weg beginnt
- 4.1 Aller à l'adventure: Das Selbstverständnis der „Abenteurer“
- 4.2 Strukturelle Ursachen für Migration und Flucht
- 4.3 Tanger, Tor nach Europa: Sehnsuchtsort von Einheimischen und Fremden
- 5. Zwischen Razzia und Regularisierung: Alltag politischer Härte und flexibler Grenzen für Subsahara-Migrant_innen in Marokko
- 5.1 Marokkos neue Immigrationspolitik: Vom Transit- zum Zielland?
- 5.2 Marokko neue Immigrationspolitik aus Sicht der Subsahara-Migrant_innen
- 5.3 Taktiken und Schleusernetzwerke
- 6. (Über)Leben in Marokko: Lohnarbeit und transnationale Netzwerke
- 6.1 „Wer Arbeit sucht, der findet!“
- 6.2 „Tourner la Médina“: Arbeitsverbot und heimliches Arbeiten
- 6.3 „Sogar die Mülleimer leeren sie selbst“
- 6.4 Transnationale Beziehungen und Netzwerke
- 7. Komplizierte Koexistenz: Beziehungen zur marokkanischen Mehrheitsbevölkerung
- 7.1 „Ebola“ und „Azzi“: Der alltägliche Rassismus
- 7.2 Good Muslims like you: „Salem aleikum“ und andere Strategien des täglichen Überlebens
- 8. Grenzregime und Gewalt
- 8.1 Der Dschungel: Das Epizentrum der Krise
- 8.2 Aus den Augen, aus dem Sinn? Die Konstruktion Marokkos als Grenzzone
- 9. Forschungserkenntnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Auswirkungen der europäischen Externalisierungspolitik auf Subsahara-Migrant_innen in Marokko. Ziel ist es, die Lebensrealitäten dieser Migrant_innen im Kontext der europäischen Migrationspolitik zu beleuchten und die Strategien ihres Überlebens zu analysieren.
- Europäische Migrationspolitik und ihre Externalisierung nach Marokko
- Alltagserfahrungen von Subsahara-Migrant_innen in Marokko
- Strategien des Überlebens und der Integration
- Beziehungen zwischen Subsahara-Migrant_innen und der marokkanischen Bevölkerung
- Rolle von Schleusernetzwerken und informeller Wirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der europäischen Externalisierungspolitik und deren Auswirkungen auf Subsahara-Migrant_innen in Marokko ein. Sie skizziert den historischen Kontext der europäischen Migrationspolitik, von der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte bis hin zur zunehmenden Externalisierung der Grenzen. Die Arbeit wird als Beitrag zum Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen europäischer Politik und den Lebensrealitäten der betroffenen Migrant_innen positioniert.
2. Kontext der Forschung: Dieses Kapitel liefert den theoretischen und konzeptionellen Rahmen der Arbeit. Es definiert wichtige Begriffe wie „Externalisierung“ und beleuchtet den Stand der Forschung zum Thema. Der Fokus liegt auf der Darstellung des marokkanischen Kontextes als Transit- und zunehmend auch als Zielland für subsaharische Migrant_innen, unter Berücksichtigung der geopolitischen und historischen Entwicklungen des Landes. Es werden die Herausforderungen und Chancen für die Migrant_innen in diesem Kontext beleuchtet.
3. Durchführung der Forschung: Hier beschreibt die Autorin die Methodik ihrer Forschung. Die Selbstpositionierung der Forscherin wird erläutert, gefolgt von einer detaillierten Beschreibung der angewendeten Methoden, einschliesslich der Social-Media-Recherche und der Durchführung von Interviews mit Subsahara-Migrant_innen. Die Kapitel beschreibt kritische Reflexionen über die gewählten Methoden und deren Stärken und Schwächen.
4. Der Weg beginnt: Dieses Kapitel beleuchtet die Migrationsgeschichten der befragten Personen, fokussiert auf die individuellen Motive und die Herausforderungen der Reise nach Marokko. Der Abschnitt analysiert die strukturellen Ursachen von Migration und Flucht aus den Herkunftsländern der Migrant_innen und beschreibt Tanger als wichtigen Transitpunkt auf ihrem Weg.
5. Zwischen Razzia und Regularisierung: Alltag politischer Härte und flexibler Grenzen für Subsahara-Migrant_innen in Marokko: Dieses Kapitel analysiert die Lebensbedingungen von Subsahara-Migrant_innen in Marokko im Kontext der marokkanischen Immigrationspolitik. Es beschreibt die Erfahrungen der Migrant_innen mit staatlichen Maßnahmen, von Razzien bis hin zu Regularisierungsmöglichkeiten, und untersucht, wie diese Politik von den Betroffenen wahrgenommen und erlebt wird. Die Rolle von Schleusernetzwerken und deren Strategien wird ebenfalls beleuchtet.
6. (Über)Leben in Marokko: Lohnarbeit und transnationale Netzwerke: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Arbeitsbedingungen und die Bedeutung transnationaler Netzwerke für das Überleben der Subsahara-Migrant_innen in Marokko. Es beschreibt die Schwierigkeiten, legale Arbeit zu finden, die Verbreitung von informeller Beschäftigung und die Rolle von familiären und sozialen Netzwerken für die Unterstützung der Migrant_innen.
7. Komplizierte Koexistenz: Beziehungen zur marokkanischen Mehrheitsbevölkerung: Das Kapitel untersucht die Beziehungen zwischen Subsahara-Migrant_innen und der marokkanischen Mehrheitsbevölkerung, beleuchtet alltäglichen Rassismus und beschreibt Strategien der Migrant_innen, um im Alltag zu überleben und zu interagieren. Es analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten der Koexistenz.
8. Grenzregime und Gewalt: Dieser Abschnitt analysiert die Rolle von Gewalt und Grenzregime im Leben der Subsahara-Migrant_innen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der schwierigen Lage der Migrant_innen und der Rolle Marokkos als Grenzzone im Kontext der europäischen Externalisierungspolitik. Der Begriff „Dschungel“ wird als Metapher für die Krisensituation der Migrant_innen verwendet.
Schlüsselwörter
Europäische Externalisierungspolitik, Subsahara-Migration, Marokko, Immigrationspolitik, Transitmigration, informeller Sektor, transnationale Netzwerke, Rassismus, Grenzkontrolle, Schleusernetzwerke, Lebensbedingungen von Migrant_innen.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Auswirkungen der europäischen Externalisierungspolitik auf Subsahara-Migrant*innen in Marokko
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Auswirkungen der europäischen Externalisierungspolitik auf die Lebensrealitäten von Subsahara-Migrant*innen in Marokko. Sie analysiert deren Überlebensstrategien im Kontext der europäischen Migrationspolitik und beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen europäischer Politik und den Erfahrungen der betroffenen Migrant*innen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt diverse Themen, darunter die europäische Migrationspolitik und ihre Externalisierung nach Marokko, die Alltagserfahrungen von Subsahara-Migrant*innen, ihre Strategien zur Integration und zum Überleben, die Beziehungen zu der marokkanischen Bevölkerung, die Rolle von Schleusernetzwerken und der informellen Wirtschaft, sowie die Herausforderungen durch Grenzregime und Gewalt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Einleitung, Kontext der Forschung (Begriffsdefinitionen, Stand der Forschung, marokkanischer Kontext), Durchführung der Forschung (Methodologie, Selbstpositionierung), Der Weg beginnt (Migrationsgeschichten, strukturelle Ursachen), Zwischen Razzia und Regularisierung (marokkanische Immigrationspolitik, Erfahrungen der Migrant*innen), (Über)Leben in Marokko (Arbeitsbedingungen, transnationale Netzwerke), Komplizierte Koexistenz (Beziehungen zur marokkanischen Bevölkerung, Rassismus), Grenzregime und Gewalt (Dschungel als Metapher, Marokko als Grenzzone), und Forschungserkenntnisse.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Autorin verwendet qualitative Methoden, einschließlich Social-Media-Recherche und Interviews mit Subsahara-Migrant*innen. Die Arbeit enthält eine kritische Reflexion der angewendeten Methoden und deren Stärken und Schwächen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der empirischen Forschung in Bezug auf die Lebensbedingungen, Überlebensstrategien und Herausforderungen, denen Subsahara-Migrant*innen in Marokko gegenüberstehen. Sie analysiert die Auswirkungen der europäischen Externalisierungspolitik auf diese Gruppe und beleuchtet die komplexen Beziehungen zwischen den Migrant*innen und der marokkanischen Bevölkerung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Europäische Externalisierungspolitik, Subsahara-Migration, Marokko, Immigrationspolitik, Transitmigration, informeller Sektor, transnationale Netzwerke, Rassismus, Grenzkontrolle, Schleusernetzwerke, Lebensbedingungen von Migrant*innen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Lebensrealitäten von Subsahara-Migrant*innen in Marokko im Kontext der europäischen Migrationspolitik zu beleuchten und deren Überlebensstrategien zu analysieren. Sie soll einen Beitrag zum Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen europäischer Politik und den Lebensbedingungen der betroffenen Migrant*innen leisten.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Das Inhaltsverzeichnis der Arbeit bietet eine detaillierte Übersicht der Kapitel und ihrer Unterpunkte. Die Zusammenfassung der Kapitel liefert zudem eine kurze Beschreibung des Inhalts jedes Kapitels.
- Arbeit zitieren
- Angela Schweizer (Autor:in), 2017, Auswirkungen europäischer Externalisierungspolitik auf Subsahara-Migrant/-innen in Marokko, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/436367