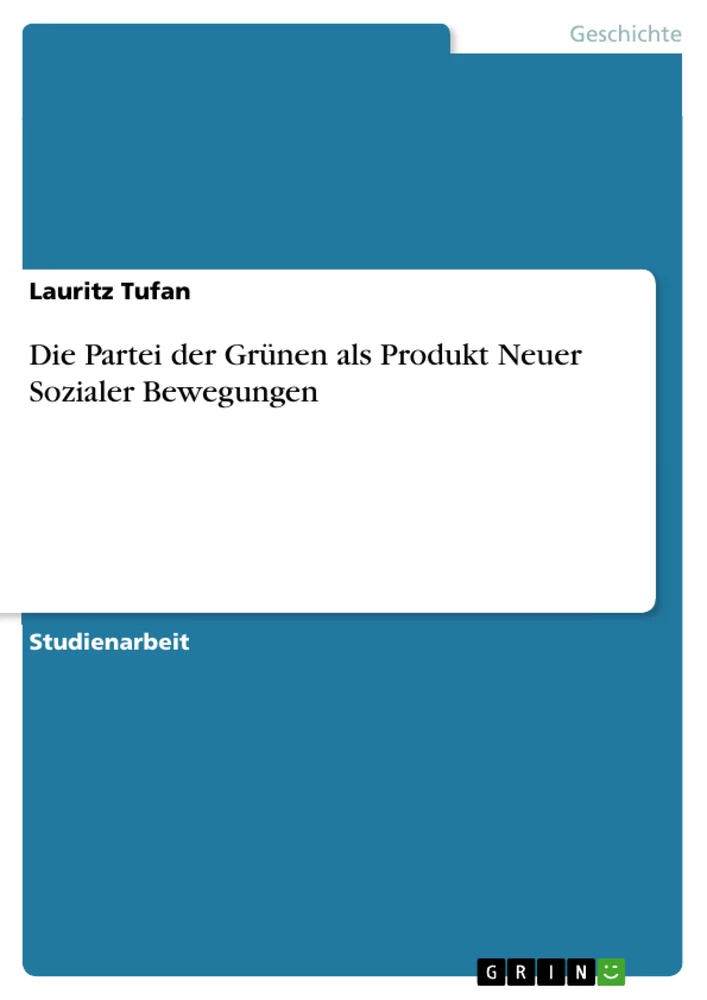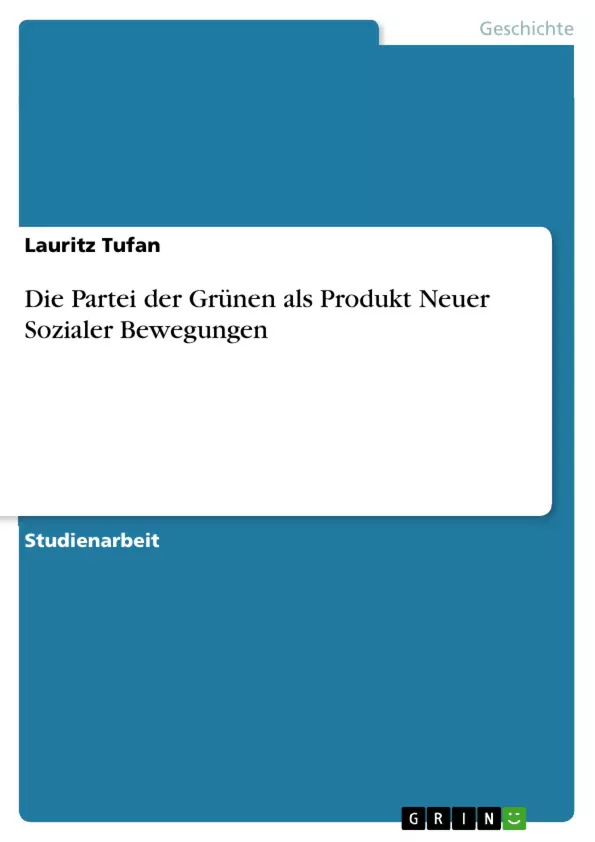Während der 1970er bis 1980er Jahre erlebte die Bundesrepublik Deutschland einen Wertewandel, der sich in der Entwicklung von neuen Denkansätzen und der Entstehung eines außerparlamentarischen Protests manifestierte, welche den bisherigen Vorstellungen der Sozialliberalen Koalition und der darauffolgenden Koalition aus CDU/CSU und FDP in kontrovers diskutierten Themen scharf gegenüberstanden. Eine Gruppierung etablierte sich als neue politische Partei aus Bürgerinitiativen und Neuen Sozialen Bewegungen (NSB) der 1970er und 1980er Jahre. Es handelt sich um die Partei der Grünen, die sich als politische Alternative gegenüber den anderen Parteien verstand und eine Veränderung der politischen Leitkultur herbeiführen wollte.
In dieser Arbeit soll demzufolge die Frage geklärt werden, welche Merkmale NSB aufwiesen, welche dieser Charakteristika die Partei der Grünen im Übergangsschritt zur Partei besaß und ob sie abschließend eher als NSB oder als politische Partei zu beurteilen war. Wie äußerte sich das Protestverhalten der Partei im Parlamentarismus?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Neue Soziale Bewegungen- Die Anfänge der Grünen
- Historische und politische Voraussetzungen des Wertewandels
- Merkmale Neuer Sozialer Bewegungen gegen den Staat
- Die grünen Listen der Gründungsgrünen- Zwischen Protest und Partei
- Gründungsgeschichte der grünen Partei
- Grundsatzprogramm...
- Selbstbild und Wahrnehmung anderer Parteien
- Die Grünen in Hessen als etablierter parlamentarischer Grundpfeiler...
- Entstehung des hessischen Landesverbandes der Grünen
- Analyse des Ausrichtungsprozesses der Grünen..
- Fazit: Die grüne Partei: Bewegung oder Partei in den 1970er-1980er Jahren?...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Entstehung der Grünen Partei aus dem Kontext der Neuen Sozialen Bewegungen (NSB) in den 1970er und 1980er Jahren. Sie untersucht den Einfluss des Wertewandels auf die Entwicklung der Partei und analysiert die Merkmale der NSB, die in der Partei wiederzufinden sind. Darüber hinaus wird untersucht, ob die Grünen im Verlauf ihres Entstehungs- und Etablierungsprozesses eher als NSB oder als politische Partei zu betrachten sind.
- Der Einfluss des Wertewandels der 1970er und 1980er Jahre auf die Entstehung der Grünen
- Merkmale der Neuen Sozialen Bewegungen und ihre Relevanz für die Partei der Grünen
- Der Übergangsprozess der Grünen von einer Protestbewegung zu einer etablierten politischen Partei
- Die Rolle der Grünen im Parlament und die Auswirkungen auf die politische Kultur
- Die Frage, ob die Grünen im Wesentlichen eine politische Partei oder ein Produkt der Neuen Sozialen Bewegungen darstellen
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel werden die historischen und politischen Voraussetzungen des Wertewandels der 1970er und 1980er Jahre beleuchtet, die zur Entstehung der Neuen Sozialen Bewegungen führten. Es werden die Merkmale dieser Bewegungen und ihre Abgrenzung vom etablierten politischen System betrachtet.
Das zweite Kapitel widmet sich der Gründungsgeschichte der Grünen und analysiert die grüne Liste als Übergang von NSB zur politischen Partei. Das Selbst- und Fremdbild der Grünen als "Anti-Parteien-Partei" wird anhand von Quellen aus der Zeit untersucht.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Grünen in Hessen und analysiert ihre Rolle als etablierte politische Partei. Insbesondere wird untersucht, wie sie sich trotz ihrer Protesttradition als glaubwürdige und regierungsfähige Alternative im Landtag etablieren konnten.
Schlüsselwörter
Neue Soziale Bewegungen, Wertewandel, Partei der Grünen, Protest, Politik, Parlament, Etablierung, Protestkultur, Bürgerinitiativen, grüne Liste, Hessen, Umweltbewegungen, politische Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Wie sind die Grünen entstanden?
Die Partei entstand in den 1970er und 1980er Jahren aus verschiedenen Bürgerinitiativen und den sogenannten Neuen Sozialen Bewegungen (NSB) als politische Alternative zum etablierten System.
Was zeichnete die „Neuen Sozialen Bewegungen“ aus?
NSB waren geprägt durch außerparlamentarischen Protest, flache Hierarchien und Themen wie Umweltschutz, Friedenspolitik und Frauenrechte, die in den etablierten Parteien vernachlässigt wurden.
Waren die frühen Grünen eher eine Bewegung oder eine Partei?
Die Arbeit untersucht diesen Übergangsprozess und zeigt auf, dass sich die Grünen anfangs als „Anti-Parteien-Partei“ verstanden, bevor sie sich im Parlamentarismus etablierten.
Welche Rolle spielte der Landesverband Hessen?
Hessen dient als Beispiel für die Etablierung der Grünen als parlamentarischer Grundpfeiler und die Entwicklung hin zur Regierungsfähigkeit.
Was war der „Wertewandel“ der 1970er Jahre?
Der Wertewandel beschreibt den Übergang von materiellen Sicherheitswerten hin zu postmateriellen Werten wie Selbstverwirklichung, Mitbestimmung und ökologischem Bewusstsein.
- Citar trabajo
- Lauritz Tufan (Autor), 2018, Die Partei der Grünen als Produkt Neuer Sozialer Bewegungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/436436