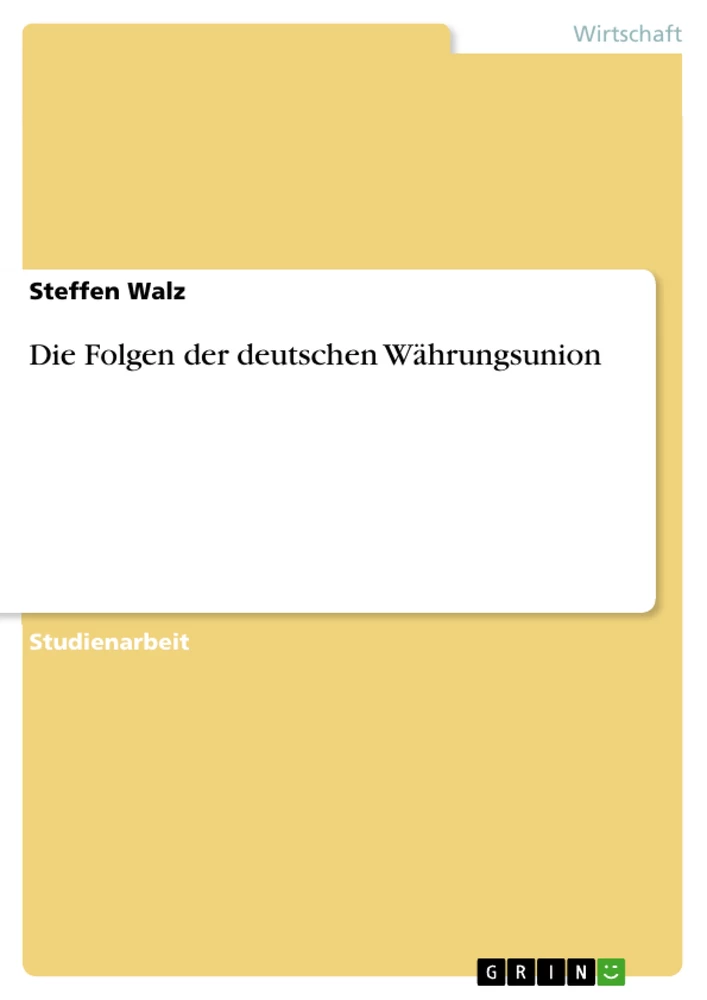Durch die vom damaligen russischen Präsidenten Gorbatschow eingeleitete Reformpolitik und der Öffnung der Grenzen der DDR am 09.11.1989, flohen immer Menschen aus dem Land.
Dies wirkte sich unumgänglich auf die politische und wirtschaftliche Situation aus, welche rasch zu ersten Gesprächen mit der Regierung der Bundesrepublik, unter Kanzler Helmut Kohl, führte.
Zwischen Oktober 1989 und Januar 1990 verließen über 300.000 Menschen die DDR.1 Eine schnelle Lösung für die Stabilisierung der Wirtschaft und zur Bekämpfung der Fluchtursachen wurde gesucht. Eine starke Währung, in Form der D-Mark, sollte den Menschen in Ostdeutschland wieder Vertrauen in die Politik und Wirtschaft geben. Unter Zeitdruck wurde ein Vertrag für die Bedingungen der Währungsunion aufgestellt, in dem nicht alle Regelungen ausreichend überdacht waren und weitreichende Folgen für die DDR und die BRD hatten, die teilweise bis heute Deutschland belasten.
In den folgenden Kapiteln wird aufgezeigt, wie die monetäre Lage der DDR und deren Bürgern war, wie die Verhandlungen zwischen der BRD und der DDR abliefen, welche Folgen daraus resultierten und welche Punkte für die Währungsunion besser hätten gelöst werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Währung der DDR und die Beziehung zur BRD
- Die Binnenwährung der DDR
- Die D-Mark als Parallelwährung der DDR
- Der innerdeutsche Handel
- Die deutsche Währungsunion
- Festlegung der Wechselkurse
- Einigung und Vorbereitung auf die Währungsunion
- Die Folgen der deutschen Währungsunion
- Umlauf der Geldmengen nach der Währungsunion
- Lage der Unternehmen der DDR
- Gefahr einer möglichen Inflation
- Auswirkungen auf die Europäische Gemeinschaft
- Kosten der Währungsunion und der deutschen Einheit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Folgen der deutschen Währungsunion aus wirtschaftlicher Sicht, die durch die politische und wirtschaftliche Situation in der DDR nach der Öffnung der Grenzen im Jahr 1989 notwendig wurde. Die Analyse beleuchtet den Einfluss der Währungsunion auf die Wirtschaft der DDR, das Verhalten der Unternehmen und die Gefahr einer Inflation. Darüber hinaus werden die Auswirkungen auf die Europäische Gemeinschaft und die Kosten der deutschen Einheit untersucht.
- Die Rolle der D-Mark als Parallelwährung in der DDR
- Die Auswirkungen der Währungsunion auf die Wirtschaft der DDR
- Die Folgen für Unternehmen und die Gefahr einer Inflation
- Die Kosten der Währungsunion und der deutschen Einheit
- Die Auswirkungen auf die Europäische Gemeinschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den historischen Kontext der deutschen Währungsunion dar und erklärt die Notwendigkeit einer schnellen Lösung für die wirtschaftliche Stabilisierung der DDR.
- Die Währung der DDR und die Beziehung zur BRD: Dieses Kapitel beschreibt die Binnenwährung der DDR, den Einfluss der D-Mark als Parallelwährung und die Bedeutung des innerdeutschen Handels.
- Die deutsche Währungsunion: In diesem Kapitel werden die Festlegung der Wechselkurse und die Verhandlungen zur Vorbereitung der Währungsunion erläutert.
- Die Folgen der deutschen Währungsunion: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der Währungsunion auf den Geldumlauf, die Lage der DDR-Unternehmen, die Gefahr einer Inflation, die Folgen für die Europäische Gemeinschaft und die Kosten der deutschen Einheit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Währungsunion, deutsche Einheit, DDR-Wirtschaft, D-Mark, Inflation, Europäische Gemeinschaft, Kosten der Einheit und der Einfluss von Angebot und Nachfrage auf die Währung.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde die deutsche Währungsunion so schnell eingeführt?
Die massenhafte Flucht aus der DDR (über 300.000 Menschen Ende 1989) erforderte eine schnelle wirtschaftliche Stabilisierung und die Schaffung von Vertrauen durch die D-Mark.
Wie wurden die Wechselkurse zwischen DDR-Mark und D-Mark festgelegt?
Die Festlegung der Wechselkurse war ein zentraler Verhandlungspunkt, der unter hohem Zeitdruck stattfand und weitreichende Folgen für Sparguthaben und Schulden hatte.
Welche Folgen hatte die Währungsunion für DDR-Unternehmen?
Viele Betriebe waren dem plötzlichen Wettbewerb und der harten Währung nicht gewachsen, was zu massiven wirtschaftlichen Problemen und Werksschließungen führte.
Bestand nach der Währungsunion die Gefahr einer Inflation?
Die Arbeit analysiert den Umlauf der Geldmengen und die potenziellen inflationären Risiken, die durch die plötzliche Ausweitung des D-Mark-Währungsraums entstanden.
Wie hoch waren die Kosten der deutschen Einheit?
Die Währungsunion und die anschließende Einheit verursachten enorme Transferzahlungen, die den Bundeshaushalt teilweise bis heute belasten.
Was war die Rolle der D-Mark als Parallelwährung in der DDR?
Schon vor der offiziellen Union fungierte die D-Mark in der DDR als inoffizielle Parallelwährung, was die Instabilität der DDR-Binnenwährung verstärkte.
- Citation du texte
- Steffen Walz (Auteur), 2018, Die Folgen der deutschen Währungsunion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/436464