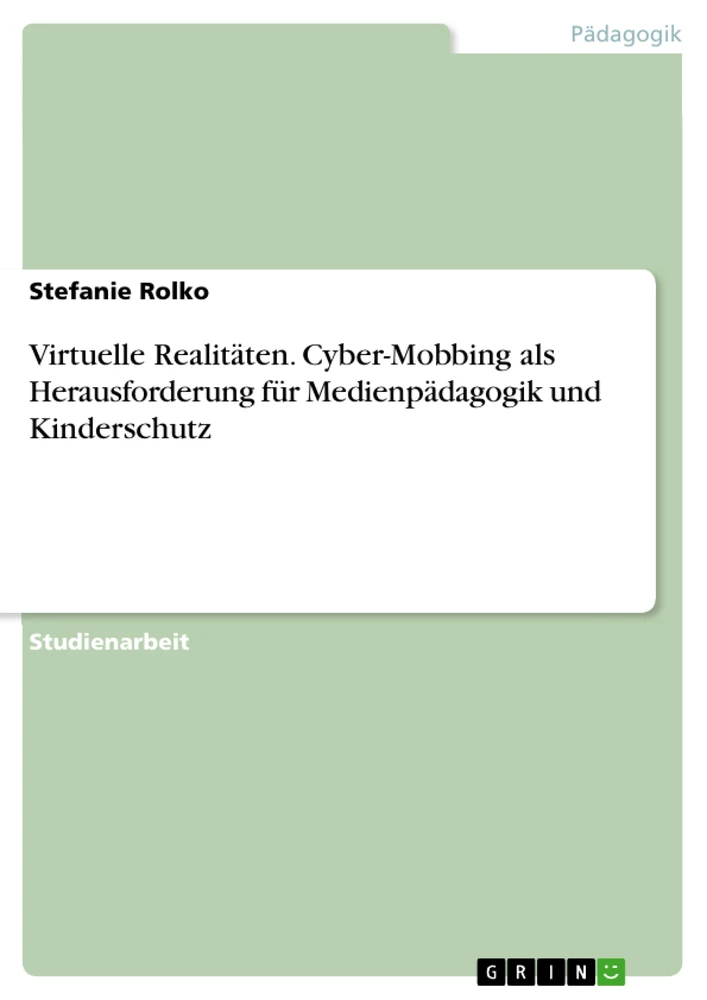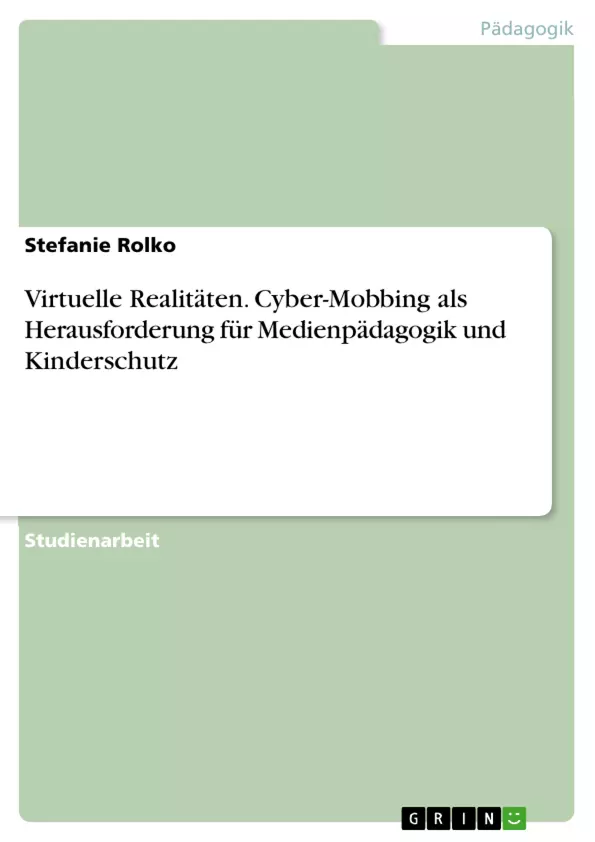Die Digitalisierung kann im weiteren Sinne als Prozess verstanden werden, in dem digitale Medien und Werkzeuge allmählich an die Stelle analoger Verfahren treten. Sie erschließen damit neue Perspektiven in allen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Bereichen, werfen aber auch neue Fragen zum Beispiel zum Schutz der Privatsphäre auf. Die Digitalisierung unserer Welt ist für den gesamten Bildungsbereich Chance und Herausforderung zugleich. Sie kann einerseits dazu beitragen, formale Bildungsprozesse hinsichtlich individueller Förderung zu verbessern, andererseits gilt es infrastrukturelle, rechtliche und personelle Rahmenbedingungen zu schaffen.
Die Berücksichtigung des digitalen Wandels dient dem Ziel, die aktuelle bildungspolitische Leitlinien zu ergänzen und durch Veränderungen bei der inhaltlichen und formalen Gestaltung von Lernprozessen die Stärkung der Selbstständigkeit zu fördern und individuelle Potenziale innerhalb einer inklusiven Bildung auch durch Nutzung digitaler Lernumgebungen besser zur Entfaltung bringen zu können. Digitale Medien und die ständige Verfügbarkeit haben zur Folge, dass sich die Kommunikation zwischen Menschen teilweise in den digitalen Raum verschoben hat. In dieser digitalen Lebenswelt tragen gerade Kinder und Jugendliche ihre Konflikte aus. Das noch junge Phänomen Cyber-Mobbing tritt ebenfalls in dieser digitalen Lebenswelt auf.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie Cyber-Mobbing, Medienpädagogik und Kinderschutz aus frühpädagogischer Sicht im Zusammenhang stehen und in der pädagogischen Arbeit präventiv mitgedacht werden müssen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Cyber-Mobbing
- Abgrenzung der Begrifflichkeit und die Auswirkungen des Phänomens
- 1.1 Mobbing Definition, Systematik und die Folgen
- 1.2 Cyber-Mobbing – Definition, Problematik, Unterschied zu traditionellem Mobbing und rechtliche Grundlagen
- 2 Mobbing-Prävention
- 2.1 Prävention am Beispiel von Resilienzförderung
- 3 Virtualität und Mobbing im frühpädagogischen Kontext
- 3.1 Anforderungen an die Fachkraft
- 3.2 Medienkompetenz - Bewusster, selbstbestimmter Umgang mit Medien und digitale Lebenswelt
- 3.3 Medienbildung in der Kita
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beleuchtet die Problematik von Cyber-Mobbing aus frühpädagogischer Sicht. Sie untersucht die Beziehung zwischen Cyber-Mobbing, Medienpädagogik und Kinderschutz und beleuchtet die Notwendigkeit, präventive Maßnahmen in der pädagogischen Arbeit zu implementieren.
- Definition und Abgrenzung von Cyber-Mobbing im Vergleich zu traditionellem Mobbing
- Auswirkungen von Cyber-Mobbing auf Kinder und Jugendliche
- Möglichkeiten der Prävention von Mobbing durch Resilienzförderung
- Bedeutung von Medienpädagogik und Medienkompetenz im Kontext von Cyber-Mobbing
- Anforderungen an Fachkräfte in der frühpädagogischen Arbeit im Hinblick auf Cyber-Mobbing und Kinderschutz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Cyber-Mobbing im Kontext der Digitalisierung dar und führt die Ziele und den Aufbau der Arbeit aus. Kapitel 1 widmet sich der Definition und Abgrenzung des Begriffs Cyber-Mobbing sowie der Auswirkungen des Phänomens. Es wird dabei auf die Unterscheidung zwischen traditionellem und Cyber-Mobbing sowie die rechtlichen Grundlagen eingegangen.
In Kapitel 2 werden Möglichkeiten der Prävention von Mobbing anhand des Konzepts der Resilienzförderung bei Kindern vorgestellt. Kapitel 3 beleuchtet den frühpädagogischen Kontext und thematisiert die Herausforderungen im Umgang mit Virtualität und Mobbing. Es werden Anforderungen an Fachkräfte, die Bedeutung von Medienkompetenz und Medienbildung in Kindertagesstätten beleuchtet.
Schlüsselwörter
Cyber-Mobbing, Medienpädagogik, Kinderschutz, Resilienz, Medienkompetenz, digitale Lebenswelt, frühpädagogische Arbeit, Kindertagesstätten.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich Cyber-Mobbing von traditionellem Mobbing?
Cyber-Mobbing findet im digitalen Raum statt, ist rund um die Uhr möglich, erreicht ein riesiges Publikum und die Täter agieren oft anonym.
Welche Auswirkungen hat Cyber-Mobbing auf Kinder?
Die Folgen können gravierend sein und von sozialem Rückzug und Leistungsabfall bis hin zu Depressionen und Angststörungen reichen.
Wie kann Resilienzförderung gegen Mobbing helfen?
Resilienz stärkt die psychische Widerstandskraft von Kindern. Ein gesundes Selbstbewusstsein und soziale Kompetenzen helfen ihnen, besser mit Konflikten umzugehen und sich Hilfe zu suchen.
Welche Aufgabe hat die Medienpädagogik im Kinderschutz?
Medienpädagogik vermittelt Medienkompetenz, also den kritischen und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Geräten, um Kinder vor Gefahren im Netz zu schützen.
Was müssen Fachkräfte in Kitas über Cyber-Mobbing wissen?
Sie müssen für das Thema sensibilisiert sein, da digitale Lebenswelten bereits im Vorschulalter eine Rolle spielen, und präventive Medienbildung in den Alltag integrieren.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Rolko (Autor:in), 2018, Virtuelle Realitäten. Cyber-Mobbing als Herausforderung für Medienpädagogik und Kinderschutz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/436475