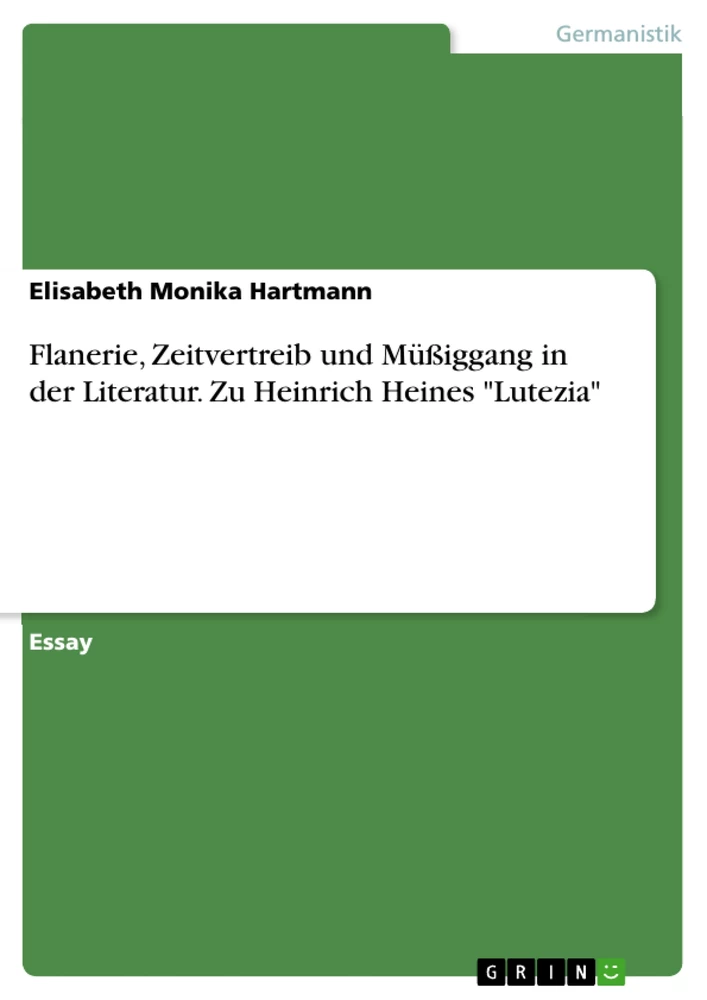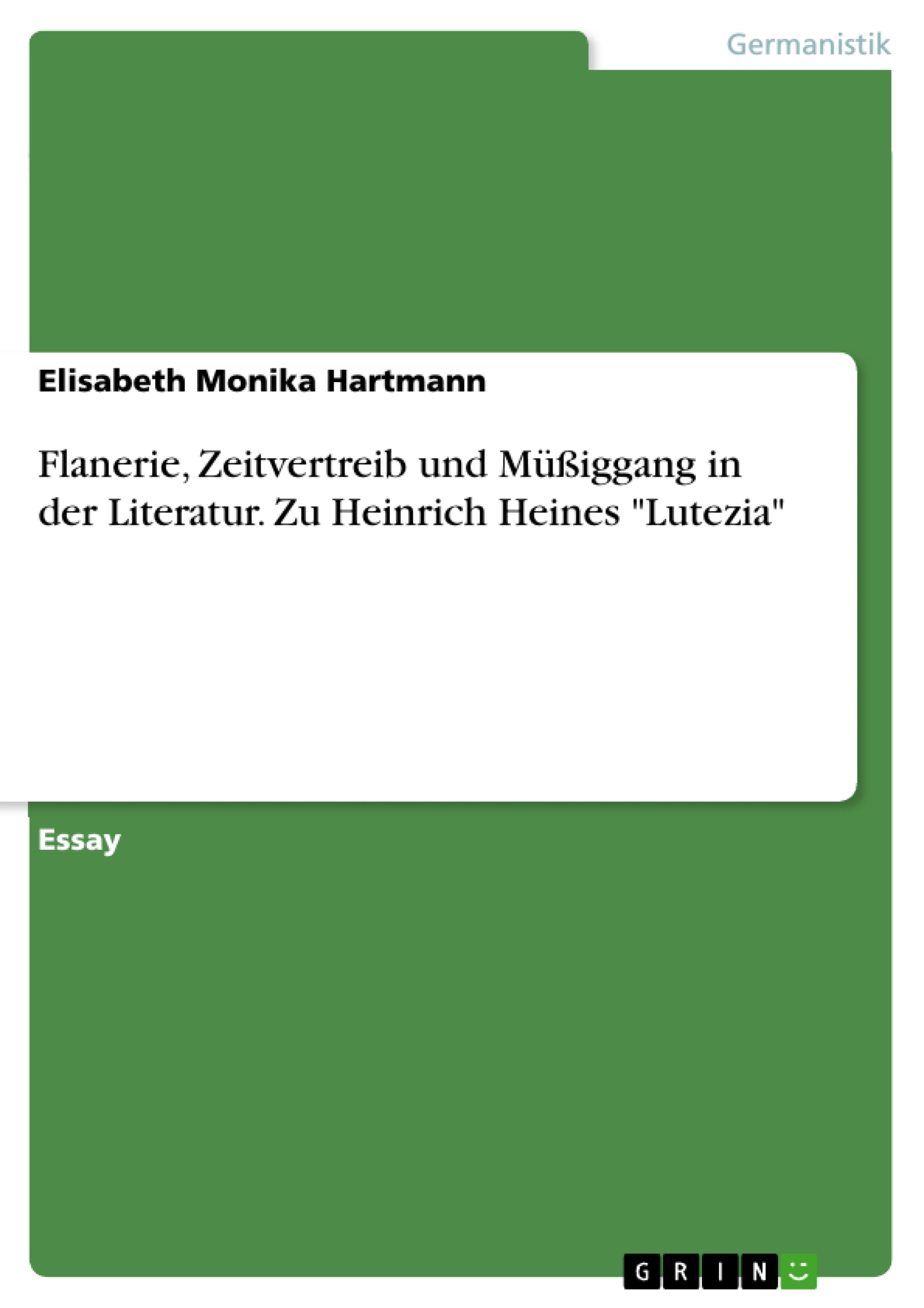„Der Anblick derselben kann dem müßigen Flaneur den angenehmsten Zeitvertreib gewähren; (…)“ (Heine, 1988) In diesem Zitat aus Heinrich Heines „Lutezia“ geht es um den individuellen Flaneur, der sein „elitär-moralisches Überlegenheitsgefühl“ gegenüber der Masse aus dem Bewusstsein zieht, nach schönen (ästhetischen) Werten bei seinen müßigen Spaziergängen durch die Passagen der vorweihnachtlich geschmückten Stadt mit den mannigfaltigen Schaufenstern in den überdachten Geschäftsstraßen und aus seiner Eleganz und Stilsicherheit zu urteilen. Walter Benjamin hat in seinen Fragmenten über Baudelaire darauf hingewiesen, dass die „Flanerie sich zu ihrer Bedeutung schwerlich ohne die Passagen“ hätte entwickeln können. Doch hat dieser freie Müßiggang, der als Zeitvertreib und Inszenierung des Privatlebens in der Öffentlichkeit dient, wirklich eine negative Konnotation und ist mit Zeitvertreib wirklich das sinnlose Totschlagen von Zeit gemeint? Oder wird hier nicht auch eine Art Sinn geschaffen?
Im Folgenden soll dieser Zusammenhang zwischen Flanerie, Zeitvertreib und Müßiggang erörtert werden. Ich beziehe mich dabei hauptsächlich auf Heinrich Heines „Lutezia“.
Inhaltsverzeichnis
- Der Anblick derselben kann dem müßigen Flaneur den angenehmsten Zeitvertreib gewähren; (...)
- Der Flaneur, der sich hier beobachtend durch die Pariser Passagen (Räume) bewegt, kümmert sich scheinbar wenig um die ,, Nuance Dufaure und Passy", sondern um die Miene des anonymen Volkes auf den Gassen zwischen den Kaufmannsläden, die ihre Waren in den Schaufenstern anpreisen, denn auf dieses Volk zumindest als Publikum seiner Selbstinszenierung – ist der Flaneur angewiesen.
- Im oben stehenden Zitat ist die Rede vom „müßigen Flaneur“. Damit ist der müßige¹² Spaziergänger auf den Pariser Boulevards und in den Passagen gemeint, der keiner geregelten Arbeit nachgeht und sich langweilt.
- Ein weiteres Beispiel dafür wäre Marcel Prousts „À la recherche du temps perdu“, in dem die Erinnerung oder Imagination (Einbildungskraft/ Phantasie auch bei Charles Baudelaire) eine große Rolle spielt und in dem das Motiv „Zeit“ mehrere Bedeutungen hat: Die Zeit, die der Erzähler vergeudet hat, die schwermütige Sehnsucht nach vergangenen Zeiten, die vielleicht besser waren und die Erinnerungen, die bestimmte Dinge hervorrufen.
- Auch in Robert Musils Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ sind Muße und Müßiggang wichtige Motive. Der flanierend reflexive Müßiggänger verarbeitet dort seine Eindrücke der Großstadt auf eine melancholische Art und Weise.
- Auch die Muẞe spielt in Bildungsromanen seit Christoph Martin Wielands „Geschichte des Agathon\" (1766/1767) und Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahren“ (1795/1796) eine wichtige Rolle ebenso wie die Spannung zwischen Muße und rationellem und ökonomischem Zeitumgang.
- Der Flaneur bemerkt mit Scharfsinn die aktuellen Tendenzen der Mode (Ästhetik) in den 1840er Jahren in Paris und den Rückbezug auf die „Zeit der Renaissance“.
- Der Flaneur geht in „Lutezia“ auf den Maler Leopold Robert ein, dessen Bild „Der Fischer\"\nder Flaneur auf dem Boulevard Montmartre in Paris entdeckt.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert die Bedeutung von Flanerie, Zeitvertreib und Müßiggang, insbesondere im Kontext von Heinrich Heines „Lutezia“. Der Text erforscht die Rolle des Flaneurs als Beobachter und Inszenierer in der Großstadt, sowie dessen Verhältnis zur Gesellschaft und zur Zeit.
- Der Flaneur als Repräsentant des Müßiggangs und seine soziale Positionierung
- Die Ambivalenz des Zeitvertreibs: Sinnlose Zeitverschwendung oder Quelle der Inspiration?
- Die Rolle der Imagination und Erinnerung im Kontext der Flanerie
- Die Bedeutung des Flaneurs als Beobachter und Kritiker der Gesellschaft
- Der Einfluss der Industrialisierung und der Arbeiterklasse auf die Flanerie
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit einem Zitat aus Heines „Lutezia“, das den individuellen Flaneur als elitär-moralisches Wesen präsentiert. Es wird die Verbindung zwischen Flanerie und Passagen hervorgehoben, jedoch die Frage nach der Konnotation des „freien Müßiggangs“ gestellt.
Der Text analysiert anschließend den Flaneur als Beobachter der Großstadt und dessen Bedürfnis nach Anerkennung. Die soziale Positionierung des Flaneurs wird im Kontext des französischen Bürgertums und der Politik der Zeit beleuchtet, wobei die Ungleichheit der Gesellschaft und die Bedeutung der „Idee der absoluten Gleichheit“ betont werden.
Weiterhin wird der „müßige Flaneur“ als Zeitvertreiber und dessen ambivalente Rolle in der Großstadt betrachtet. Müßiggang wird mit Faulheit und Nichtstun assoziiert, aber auch als „Entschleunigung“ in einer schnelllebigen Welt interpretiert. Der Text greift auf Beispiele wie den „Heiligen Hieronymus“ und die „vita contemplativa“ zurück, um die potenzielle Verbindung zwischen Müßiggang und Bildung aufzuzeigen.
Im weiteren Verlauf wird die Rolle der Imagination und Erinnerung im Kontext der Flanerie anhand von Marcel Prousts „À la recherche du temps perdu“ und Heines „Lutezia“ untersucht. Die Bedeutung des Flaneurs als Beobachter und Kritiker der Gesellschaft wird unter Bezug auf Robert Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“ beleuchtet. Der Essay analysiert schließlich den Einfluss der Industrialisierung und der Arbeiterklasse auf die Flanerie, wobei die Verbindung zwischen Flanerie und Kunst als Gegenpol zur industriellen Gesellschaft dargestellt wird.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieses Essays sind: Flanerie, Zeitvertreib, Müßiggang, Flaneur, Großstadt, Gesellschaft, Politik, Imagination, Erinnerung, Industrialisierung, Arbeiterklasse, Kunst.
Häufig gestellte Fragen zur Flanerie bei Heine
Was charakterisiert einen Flaneur in Heines „Lutezia“?
Der Flaneur ist ein müßiger Beobachter der Großstadt, der sich durch Eleganz auszeichnet und die Masse als Publikum seiner Selbstinszenierung nutzt.
Welche Bedeutung haben die Passagen für die Flanerie?
Laut Walter Benjamin konnte sich die Flanerie erst durch die überdachten Passagen voll entwickeln, da sie den idealen Raum für das geschützte Beobachten bieten.
Ist Müßiggang gleichbedeutend mit Faulheit?
Nein, in der Literatur wird Müßiggang oft als „Entschleunigung“ oder als Voraussetzung für Reflexion, Imagination und Bildung interpretiert.
Wie hängen Flanerie und Industrialisierung zusammen?
Die Flanerie entstand als Gegenpol zur rationellen Zeitnutzung der industriellen Gesellschaft und dient als Inszenierung des Privatlebens im öffentlichen Raum.
Welche Rolle spielt die Erinnerung in diesem Kontext?
Wie bei Marcel Proust spielt auch bei Heine die Imagination und Erinnerung eine Rolle, um dem flüchtigen Zeitvertreib einen tieferen Sinn zu verleihen.
- Arbeit zitieren
- B.A. Elisabeth Monika Hartmann (Autor:in), 2014, Flanerie, Zeitvertreib und Müßiggang in der Literatur. Zu Heinrich Heines "Lutezia", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/436810