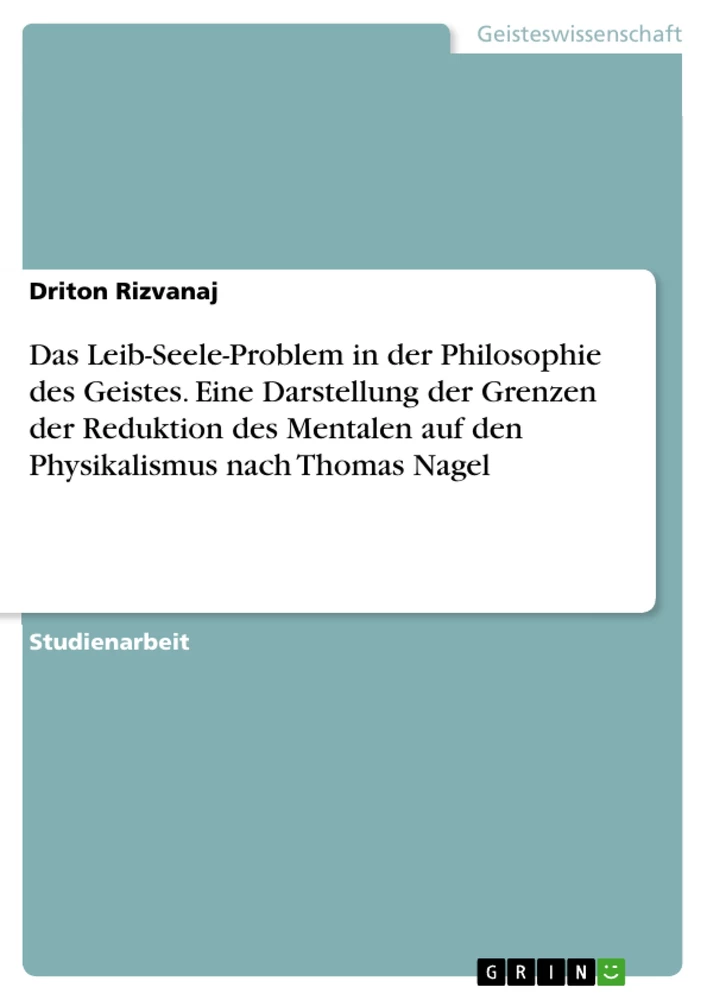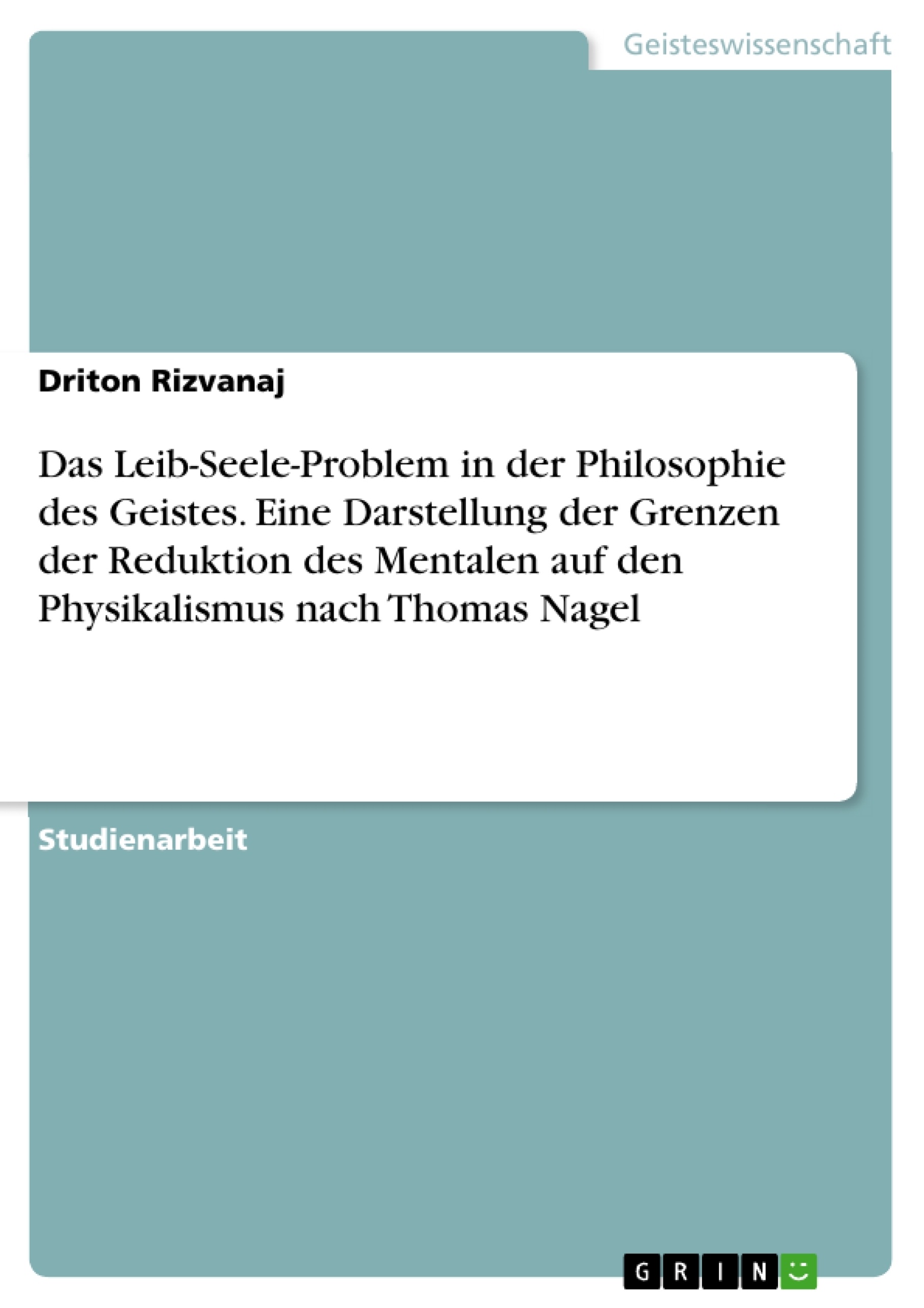Die Auseinandersetzung mit dem Mentalen ist Gegenstand der Philosophie des Geistes, welche zu Anfang dieser Hausarbeit definiert werden muss. Daran anknüpfend werden die typischen Probleme in der Philosophie des Geistes geschildert, welches im Wesentlichen das Leib-Seele Problem tangiert. Da nun das Verständnis der Grundgedanken über das Leib-Seele Problem thematisiert wurde, wird weitergehend im nächsten Kapitel Nagels Kritik am reduktiven Physikalismus dargelegt, was den Kernpunkt dieser Arbeit bildet. Abschließend folgt ein Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eine Definition der Philosophie des Geistes
- Das Leib-Seele-Problem
- Nagels Kritik am reduktiven Physikalismus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Thomas Nagels Kritik am reduktiven Physikalismus im Kontext des Leib-Seele-Problems. Das Ziel ist es, die Grenzen des Physikalismus aufzuzeigen und zu verstehen, warum die Reduktion des Mentalen auf das Physikalische nach Nagel nicht möglich ist.
- Definition der Philosophie des Geistes
- Das Leib-Seele-Problem
- Nagels Kritik am reduktiven Physikalismus
- Die Grenzen des Physikalismus
- Das Problem der subjektiven Erfahrung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in die Philosophie des Geistes und ihre Bedeutung im aktuellen wissenschaftlichen Diskurs. Das zweite Kapitel definiert die Philosophie des Geistes, insbesondere im Kontext des Leib-Seele-Problems, und beschreibt die verschiedenen Ansichten zum Verhältnis von mentalen und physischen Phänomenen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen der Philosophie des Geistes, insbesondere das Leib-Seele-Problem, den reduktiven Physikalismus und die Kritik daran durch Thomas Nagel. Weitere wichtige Begriffe sind mentale Phänomene, Bewusstsein, Subjektivität, und subjektive Erfahrung.
- Arbeit zitieren
- Driton Rizvanaj (Autor:in), 2018, Das Leib-Seele-Problem in der Philosophie des Geistes. Eine Darstellung der Grenzen der Reduktion des Mentalen auf den Physikalismus nach Thomas Nagel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437086