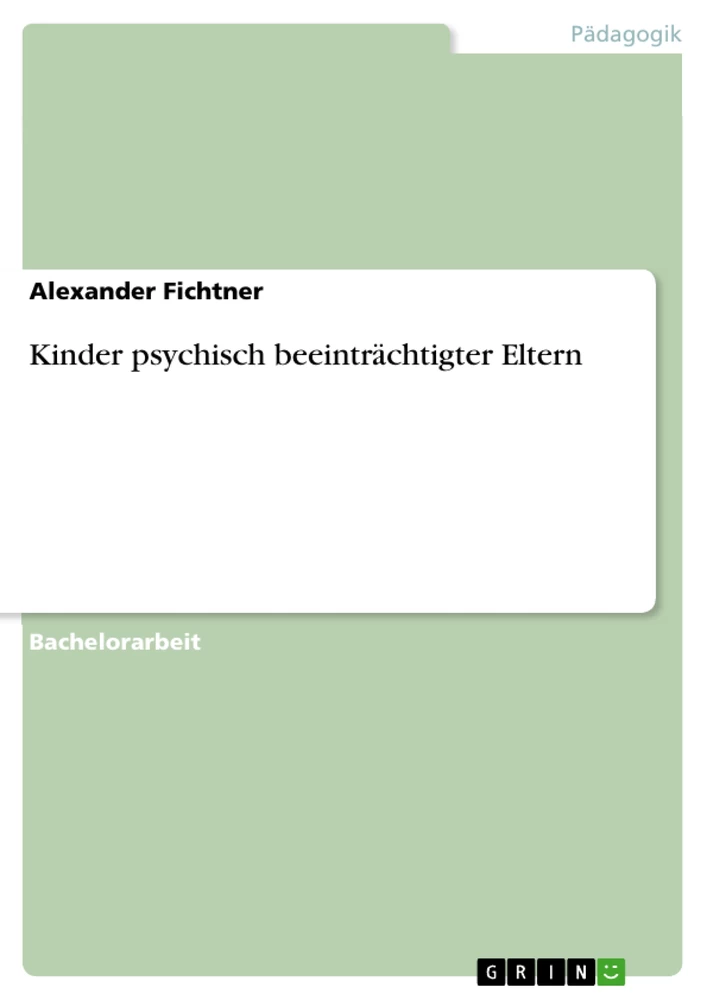Psychische Erkrankungen werden durch die Gesellschaft immer noch stark tabuisiert. Das Thema Kinder psychisch beeinträchtigter bzw. kranker Eltern ist wiederum ein Thema, das bis vor einigen Jahren - selbst in der Psychiatrie und Klinischen Psychologie - kaum wahrgenommen wurde. Dabei sind Kinder, die mit einem oder zwei psychischen beeinträchtigten Elternteilen aufwachsen, starken Belastungen ausgesetzt: Rund ein Drittel der betroffenen Kinder entwickeln im Laufe Ihres Lebens ebenfalls psychische Erkrankungen und ein weiteres Drittel zeigt psychisch auffällige Symptome. Erstaunlicherweise bleibt jedoch ein Teil der Kinder bzw. Jugendlichen - obwohl sie durch die elterliche Erkrankung enormen Stress ausgesetzt sind - resilient (widerstandsfähig) und entwickeln keine nennenswerten psychischen Beeinträchtigungen.
Diese Arbeit umreißt - unter Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstandes - das Thema und gibt wichtige Einblicke in häufige psychischen Erkrankungen. Die Bedeutung der (früh-)kindlichen Bindung und Interventionsmöglichkeiten werden thematisiert. Die anhaltende Tabuisierung psychischer Erkrankungen in der Gesellschaft wird behandelt und ein Rückblick in die Psychiatrie-Geschichte soll heutige Hemmungen und Vorbehalte erklären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Ausgewählte psychische Erkrankungen
- Einführung und Problematik der Diagnostik
- Psychotische Störungen
- Affektive Störungen
- Persönlichkeitsstörungen: Borderline und dissoziale Persönlichkeitsstörung
- Angst- und Zwangsstörungen
- Münchhausen-Stellvertretersyndrom
- Psychische Erkrankungen als Familienerkrankungen bzw. intergenerationale Erkrankungen
- Probleme der Begrifflichkeiten
- Psychische Störung und psychische Erkrankung
- Psychische Beeinträchtigung
- Die subjektiven Belastungen der Kinder psychisch beeinträchtigter Eltern
- Typische Reaktionen und Verhaltensweisen der Kinder
- Risikofaktoren
- Erkenntnisse aus der Resilienzforschung
- Erkenntnisse aus der Bindungsforschung: Die Bedeutung der Beziehung zwischen Bezugsperson und Kind
- Psychische Erkrankungen der Eltern in Zusammenhang mit Kindesmisshandlung
- Körperliche und psychische Misshandlung
- Auswirkungen von Misshandlung auf die psychische Entwicklung von Kindern
- Intervention: Therapieansätze und Prävention
- Die Tabuisierung psychischer Erkrankungen durch die Gesellschaft
- Ausblick in die Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen Kinder psychisch beeinträchtigter Eltern. Ziel ist es, die Auswirkungen psychischer Erkrankungen der Eltern auf die Kinder zu untersuchen und die Herausforderungen, denen diese Kinder ausgesetzt sind, aufzuzeigen. Der Fokus liegt dabei auf den subjektiven Belastungen der Kinder, den typischen Reaktionen und Verhaltensweisen, den Risikofaktoren und den Erkenntnissen aus der Resilienzforschung.
- Auswirkungen psychischer Erkrankungen der Eltern auf die Kinder
- Subjektive Belastungen und typische Reaktionen der Kinder
- Risikofaktoren und Resilienzforschung
- Bedeutung der Bindung zwischen Kind und Bezugsperson
- Zusammenhang zwischen Kindesmisshandlung und elterlichen psychischen Erkrankungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet den Forschungsstand zum Thema Kinder psychisch kranker Eltern und die wichtigsten Erkenntnisse aus der Literatur. In Kapitel 3 werden verschiedene psychische Erkrankungen vorgestellt, die für das Thema relevant sind, sowie deren Auswirkungen auf Kinder. Kapitel 4 widmet sich der Erläuterung und Problematik der verwendeten Begriffe. Kapitel 5 untersucht die subjektiven Belastungen der Kinder psychisch beeinträchtigter Eltern, ihre typischen Reaktionen und Verhaltensweisen sowie Risikofaktoren und Erkenntnisse aus der Resilienzforschung. Kapitel 6 befasst sich mit der Bindungstheorie und ihrer Bedeutung für die psychische Entwicklung von Kindern. In Kapitel 7 wird der Zusammenhang zwischen Kindesmisshandlung und elterlichen psychischen Erkrankungen untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Kinder psychisch beeinträchtigter Eltern, psychische Erkrankungen, subjektive Belastungen, Risikofaktoren, Resilienz, Bindungstheorie, Kindesmisshandlung, Intervention, Tabuisierung und Stigmatisierung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirken sich psychische Erkrankungen der Eltern auf Kinder aus?
Rund ein Drittel der betroffenen Kinder entwickelt selbst eine psychische Erkrankung, ein weiteres Drittel zeigt auffällige Symptome, während das letzte Drittel resilient bleibt.
Was bedeutet Resilienz im Kontext dieser Thematik?
Resilienz bezeichnet die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern, trotz der hohen Belastungen durch erkrankte Eltern keine nennenswerten Beeinträchtigungen zu entwickeln.
Welche psychischen Erkrankungen werden in der Arbeit thematisiert?
Die Arbeit behandelt unter anderem psychotische Störungen, affektive Störungen (wie Depressionen), Persönlichkeitsstörungen (Borderline), Angststörungen sowie das Münchhausen-Stellvertretersyndrom.
Welche Rolle spielt die Bindungsforschung für diese Kinder?
Die (früh-)kindliche Bindung ist entscheidend für die Entwicklung; eine gestörte Beziehung zur primären Bezugsperson gilt als signifikanter Risikofaktor.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen elterlicher Erkrankung und Kindesmisshandlung?
Ja, die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen der Eltern und dem Risiko für körperliche sowie psychische Misshandlung der Kinder.
Warum wird das Thema in der Gesellschaft oft tabuisiert?
Psychische Erkrankungen sind historisch stigmatisiert, was zu Hemmungen führt, Hilfe zu suchen oder offen über die familiäre Belastungssituation zu sprechen.
- Quote paper
- Alexander Fichtner (Author), 2017, Kinder psychisch beeinträchtigter Eltern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437186