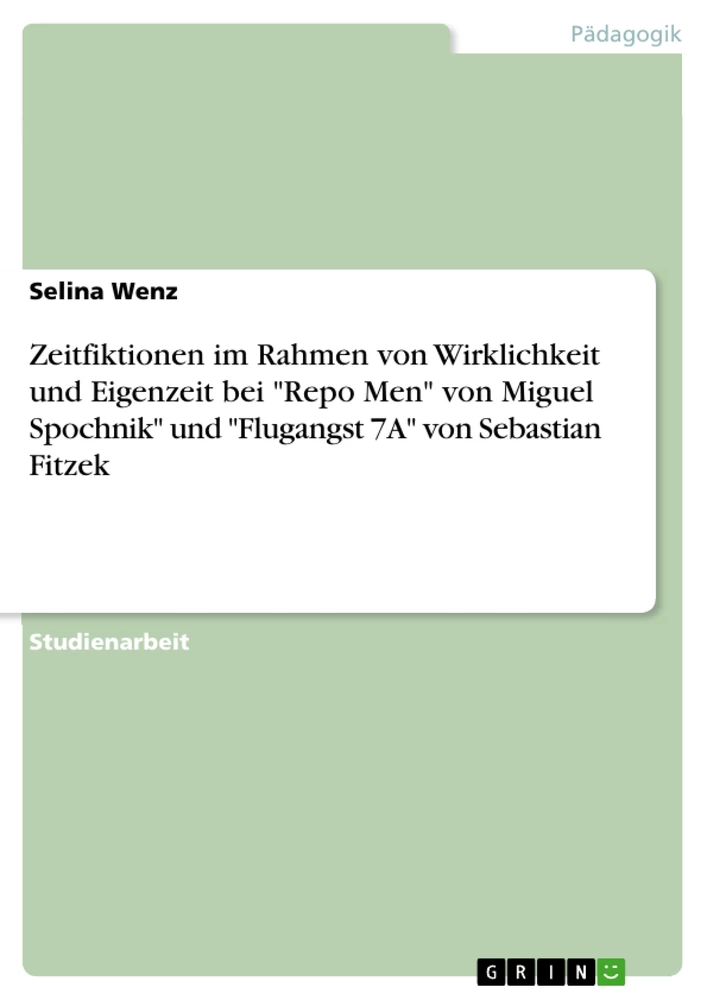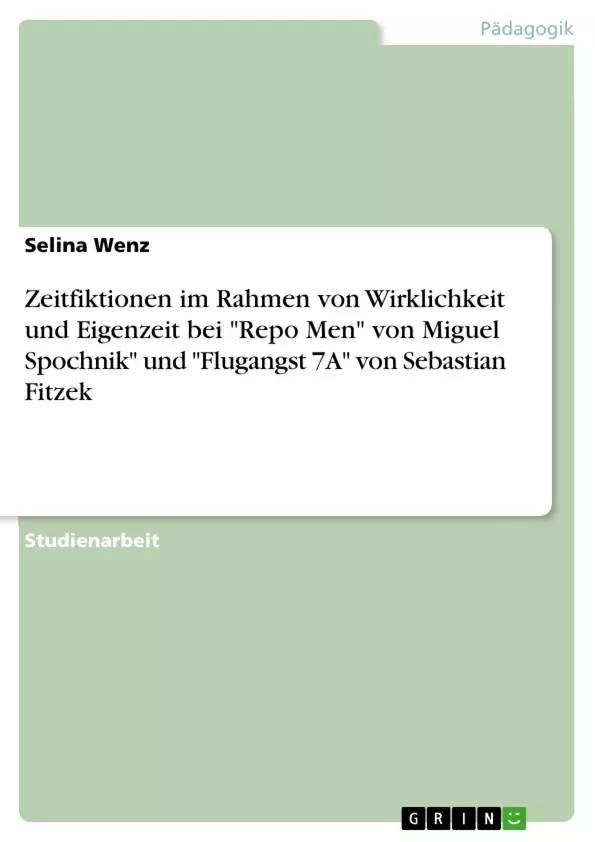Im Seminar wird Zeit innerhalb unterschiedlicher literarischer Werke unter dem speziellen Aspekt der Abweichung von „Normalzeit“ analysiert. Normalzeit bedeutet in diesem Fall, dass die Zeit in der Diegese sich unabhängig von gestalterischen Mitteln unserer physikalisch fassbaren Zeit unterordnet. Im Kontrast dazu stehen als real dargestellte alternative Zeitverläufe, wie beispielsweise Zeitschleifen oder Zeitreisen, ebenso wie das Anhalten oder Modifizieren von Zeit. Physikalische Begründungen der Autoren ergeben häufig Kausalitätsprobleme, die nur zum Teil logisch erklärt werden können. Deswegen wird in anderen Werken häufig der Traum als Lösung für Zeitfiktionen verwendet.
Im Laufe des Seminars stellte sich daher zunehmend die Frage, inwiefern sich Zeitfiktionen, die vom Protagonisten als real wahrgenommen werden, aber rein mental ablaufen, mit den erworbenen Kenntnissen verknüpfen lassen. Konkret handelt es sich hierbei um Arten von Träumen oder Nahtoderlebnissen wie Koma. Welchen Einfluss hat es, wenn eine Person das Leben als real empfindet, obwohl es sich nur in ihrem Kopf abspielt? Und inwiefern kann diese Erfahrung mit einer Zeitfiktion begründet werden? Schließlich beziehen sich die Veränderungen in „echten“ Zeitfiktionen häufig auf die Eigenzeit des Protagonisten, die nicht konform mit der Weltzeit ist.
Eben dieses Phänomen lässt sich auch in den nachfolgenden Werken „Repo Men“ von Miguel Sapochnik und „Flugangst 7A“ von Sebastian Fitzek feststellen, obwohl die beiden unterschiedlichen Genres und Medien angehören.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Wirklichkeit?
- Eigenzeit und psychologische Zeit
- Miguel Sapochniks „Repo Men“
- Analyse der Traumsequenz von Remy in „Repo Men“
- Zeitfiktion in „Repo Men“
- Sebastian Fitzeks „Flugangst 7A“
- Zeitfiktion in „Flugangst 7A“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Zeit in literarischen und filmischen Werken, insbesondere die Abweichung von der "Normalzeit", also der unabhängigen Unterordnung der Diegesezeit zur physikalisch fassbaren Zeit. Im Fokus stehen alternative Zeitverläufe wie Zeitschleifen oder Träume, die als real wahrgenommen werden, aber rein mental ablaufen. Die Arbeit analysiert den Einfluss der Eigenzeit des Protagonisten auf die Wahrnehmung und Gestaltung der Zeitfiktion.
- Die Definition und Wahrnehmung von Wirklichkeit in Bezug auf Zeitfiktionen
- Der Unterschied zwischen Weltzeit und Eigenzeit des Protagonisten
- Die Rolle von Träumen und mentalen Zuständen als Form der Zeitfiktion
- Analyse der Zeitgestaltung in Science-Fiction und Thriller
- Psychologische Aspekte des Zeiterlebens und ihre Auswirkungen auf die narrative Struktur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Zeitdarstellung in literarischen Werken ein und erläutert den Fokus auf Abweichungen von der "Normalzeit". Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Verknüpfung von als real wahrgenommenen, aber mental ablaufenden Zeitfiktionen (wie Träume oder Komazustände) mit den im Seminar erworbenen Kenntnissen. Die Analyse von "Repo Men" und "Flugangst 7A" dient als Fallbeispiel für die Untersuchung dieses Phänomens, wobei die unterschiedlichen Genres und Medien berücksichtigt werden.
Was ist Wirklichkeit?: Dieses Kapitel befasst sich mit der zentralen Frage nach der Definition von Wirklichkeit im Kontext von Zeitfiktionen. Der Fokus liegt auf der subjektiven Wahrnehmung der Protagonisten. Anhand von Beispielen wie Placebowirkungen und Scheinoperationen wird gezeigt, wie stark die Überzeugung von der Realität einer Situation deren physische Auswirkung beeinflusst. Studien zu Träumen und der Gehirnaktivität untermauern die These, dass das Gehirn ständig mögliche Versionen der Wirklichkeit simuliert, wobei die daraus resultierenden Emotionen echten Erlebnissen ähneln und Träume als eine Form von Realität wahrgenommen werden können.
Eigenzeit und psychologische Zeit: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Zeitbegriffe, die zur Analyse von Zeitfiktionen notwendig sind. Es wird zwischen Weltzeit und Eigenzeit des Protagonisten unterschieden, wobei die Eigenzeit als eine Art "Parzellierung der Zeit" definiert wird. Das Kapitel erläutert den Einfluss psychologischer Faktoren, wie Emotionen, auf das Zeiterleben und die gefühlte Zeitdehnung, die insbesondere in Action- und Thrillerfilmen zu finden ist. Die Konzepte von Zeitperspektive und Zeiterleben werden eingeführt und ihre Relevanz für die literarische Analyse hervorgehoben.
Miguel Sapochniks „Repo Men“: Der Science-Fiction-Thriller "Repo Men" schildert eine dystopische Zukunft, in der künstliche Organe allgegenwärtig sind. Der Protagonist Remy, ein "Repo Man", der nicht bezahlte Organe eintreiben muss, gerät selbst in Zahlungsschwierigkeiten, nachdem er ein künstliches Herz erhält. Seine moralischen Bedenken und die damit verbundenen Schwierigkeiten führen zur Eskalation. Ein entscheidender Punkt des Films ist die Traumsequenz, in der Remy eine Flucht mit einer Frau plant und scheinbar sein Leben neu beginnt. Der Film endet mit der Auflösung, dass diese Ereignisse nur ein Traum waren, der durch Remys kritischen Zustand ausgelöst wurde. Der Film nutzt die Traumsequenz als Mittel, um die Grenzen zwischen Realität und Fiktion zu verwischen und die psychologischen Folgen von Remys Situation darzustellen.
Schlüsselwörter
Zeitfiktion, Eigenzeit, Weltzeit, Wirklichkeit, Traum, Wahrnehmung, Psychologische Zeit, Science-Fiction, Thriller, "Repo Men", "Flugangst 7A", Realität und Fiktion, narratologische Zeitstrukturen.
Häufig gestellte Fragen zu: Zeitdarstellung in literarischen und filmischen Werken
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Zeit in literarischen und filmischen Werken, insbesondere Abweichungen von der "Normalzeit" (unabhängige Unterordnung der Diegesezeit zur physikalisch fassbaren Zeit). Der Fokus liegt auf alternativen Zeitverläufen wie Träumen oder Zeitschleifen, die als real wahrgenommen werden, aber mental ablaufen. Die Arbeit untersucht den Einfluss der Eigenzeit des Protagonisten auf die Wahrnehmung und Gestaltung der Zeitfiktion.
Welche Werke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert den Film "Repo Men" von Miguel Sapochnik und den Roman "Flugangst 7A" von Sebastian Fitzek als Fallbeispiele für die Untersuchung der Zeitfiktion in unterschiedlichen Genres und Medien.
Welche zentralen Fragen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Definition von Wirklichkeit im Kontext von Zeitfiktionen, dem Unterschied zwischen Weltzeit und Eigenzeit, der Rolle von Träumen als Form der Zeitfiktion, der Zeitgestaltung in Science-Fiction und Thriller sowie den psychologischen Aspekten des Zeiterlebens und deren Auswirkungen auf die narrative Struktur.
Wie wird die Zeit in "Repo Men" dargestellt?
In "Repo Men" wird die Traumsequenz des Protagonisten Remy als zentrales Element der Zeitfiktion analysiert. Der Film verwischt die Grenzen zwischen Realität und Fiktion und zeigt die psychologischen Folgen von Remys Situation durch die Traumsequenz auf.
Welche Rolle spielt die Eigenzeit?
Die Eigenzeit des Protagonisten wird als "Parzellierung der Zeit" definiert und ihr Einfluss auf die Wahrnehmung und Gestaltung der Zeitfiktion wird untersucht. Psychologische Faktoren wie Emotionen und die gefühlte Zeitdehnung werden in Bezug auf die Eigenzeit diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Zeitfiktion, Eigenzeit, Weltzeit, Wirklichkeit, Traum, Wahrnehmung, Psychologische Zeit, Science-Fiction, Thriller, "Repo Men", "Flugangst 7A", Realität und Fiktion, narratologische Zeitstrukturen.
Wie wird die Wirklichkeit definiert?
Das Kapitel "Was ist Wirklichkeit?" untersucht die subjektive Wahrnehmung von Wirklichkeit im Kontext von Zeitfiktionen. Anhand von Beispielen wie Placebowirkungen wird gezeigt, wie stark die Überzeugung von der Realität einer Situation deren physische Auswirkung beeinflusst. Studien zu Träumen und Gehirnaktivität untermauern die These, dass das Gehirn ständig mögliche Versionen der Wirklichkeit simuliert.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu "Was ist Wirklichkeit?", "Eigenzeit und psychologische Zeit", Analysen von "Repo Men" und "Flugangst 7A" sowie ein Fazit.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist nicht explizit in der bereitgestellten Zusammenfassung enthalten. Es lässt sich jedoch vermuten, dass das Fazit die Ergebnisse der Analysen von "Repo Men" und "Flugangst 7A" zusammenfasst und die Erkenntnisse zur Darstellung von Zeitfiktionen in den jeweiligen Medien präsentiert.)
- Quote paper
- Selina Wenz (Author), 2018, Zeitfiktionen im Rahmen von Wirklichkeit und Eigenzeit bei "Repo Men" von Miguel Spochnik" und "Flugangst 7A" von Sebastian Fitzek, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437200