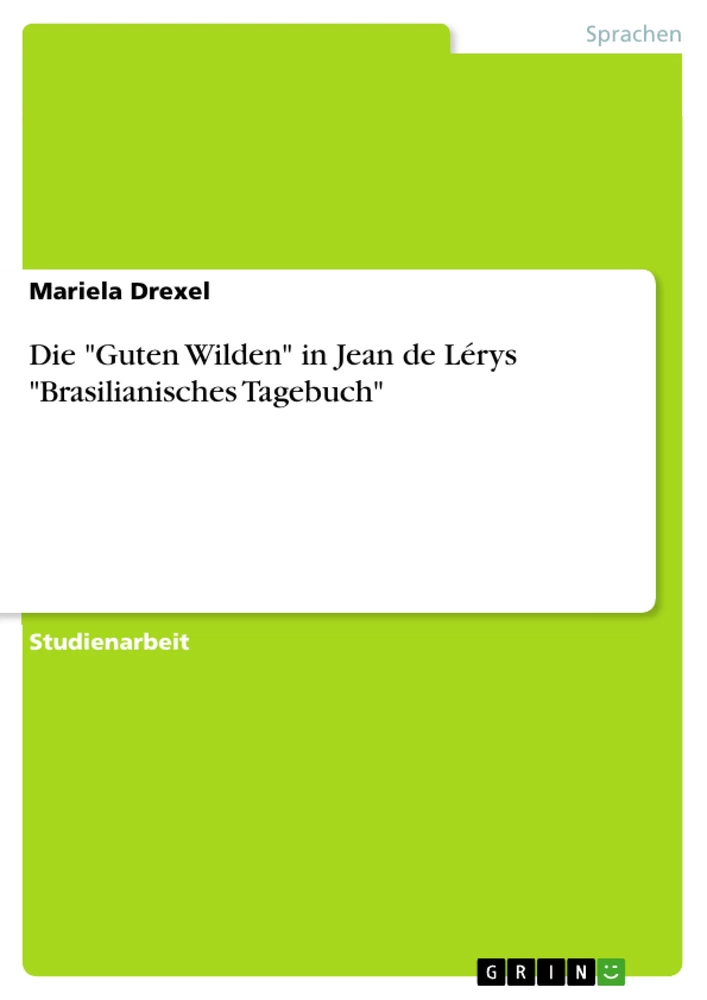Seit der Entdeckung Amerikas im Jahr 1492 erschienen in Europa zahlreiche Reiseberichte über die Entdeckungen, Eroberungen und die Begegnungen mit den fremden und andersartigen Urbevölkerungen der neuen Welt. Dabei prägten über viele Jahrhunderte sowohl Berichte über monströse, grausame und unzivilisierte „Barbaren“ als auch paradiesische Schilderungen von glücklichen, friedlichen und guten „Wilden“ das Denken der Europäer. Vor allem die Vorstellung von den schönen, exotischen „Wilden“, die glücklich und unverdorben von den Begleiterscheinungen der Zivilisation in den Tag hineinleben und keine Sorgen zu haben scheinen, entwickelte sich nach und nach zu einem der beliebtesten Motive in der Literatur. Einer der wichtigsten und frühesten Reiseautoren in diesem Zusammenhang ist der calvinistische Prediger Jean de Léry, der zwischen 1556 und 1558 an der ersten französischen Koloniegründung in Brasilien beteiligt war. Jean de Léry verfasste zwanzig Jahre nach seiner Reise einen ausführlichen Reisebericht, in dem der Schwerpunkt auf der detaillierten Beschreibung der von ihm beobachteten indigenen Kultur und Lebensweise der kannibalischen Tupinambá liegt, denen er in der Kolonie in Brasilien begegnete. Jean de Lérys Reisebericht gilt unter Literaturwissenschaftlern als einer der frühesten Verfechter des Mythos vom „Guten“ bzw. „Edlen Wilden“. Manche sehen in ihm sogar den Erfinder des Topos.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Bild der brasilianischen Ureinwohner, dass Jean de Léry in seinem Reisebericht entwirft und untersucht, inwieweit es der Figur des „Guten“ bzw. „Edlen Wilden“ entspricht. Um die Darstellungsweise und Hintergründe des Reiseberichts besser verstehen zu können, wird zunächst der historische Kontext der Brasilienreise erläutert und in Grundzügen die Biografie des Autors skizziert. Außerdem werden einige Besonderheiten und die Bedeutung des Werks von Jean de Léry dargelegt. Im Anschluss wird die Entstehungsgeschichte des Mythos vom „Guten“ bzw. „Edlen Wilden“ behandelt. Hierzu werden einige der wichtigsten Vertreter und ihr Einfluss aufgezeigt und die Funktion und Bedeutung dieser Vorstellung herausgearbeitet. Im letzten Kapitel wird schließlich anhand des Textes analysiert, wie Jean de Lérys Bild der „Wilden“ Brasiliens konkret aussieht und inwieweit seine Beschreibungen der idealisierten Vorstellung des „Guten Wilden“ entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Kontext des Reiseberichts
- Die Reise und der Aufenthalt in Brasilien
- Der Autor: Jean de Léry
- Besonderheiten und Bedeutung des Reiseberichts
- Entstehung des Mythos vom „Guten“ und vom „Edlen Wilden“
- Das Bild der brasilianischen Ureinwohner bei Jean de Léry
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Bild der brasilianischen Ureinwohner, das Jean de Léry in seinem Reisebericht entwirft und analysiert, inwieweit es der Figur des „Guten“ bzw. „Edlen Wilden“ entspricht. Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext der Brasilienreise, skizziert die Biografie des Autors und beleuchtet Besonderheiten und die Bedeutung seines Werks. Darüber hinaus wird die Entstehungsgeschichte des Mythos vom „Guten“ bzw. „Edlen Wilden“ untersucht.
- Der historische Kontext der Brasilienreise
- Die Biografie des Autors Jean de Léry
- Die Bedeutung des Werks von Jean de Léry
- Die Entstehung des Mythos vom „Guten“ bzw. „Edlen Wilden“
- Das Bild der brasilianischen Ureinwohner in Jean de Lérys Reisebericht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einführung in das Thema und stellt die Forschungsfrage vor. Im zweiten Kapitel wird der historische Kontext der Brasilienreise beleuchtet. Es werden die Gründe für die französischen Kolonisationsversuche und die Beziehung zwischen den Franzosen und den Tupinambá-Indianern beschrieben. Das dritte Kapitel widmet sich der Biografie von Jean de Léry und seinen Motiven für die Brasilienreise. Außerdem werden Besonderheiten und die Bedeutung seines Reiseberichts hervorgehoben. Das vierte Kapitel behandelt die Entstehung des Mythos vom „Guten“ bzw. „Edlen Wilden“ und zeigt die wichtigsten Vertreter und ihren Einfluss auf. Das fünfte Kapitel analysiert schließlich, wie Jean de Léry die brasilianischen Ureinwohner in seinem Reisebericht darstellt und inwieweit seine Beschreibungen der idealisierten Vorstellung des „Guten Wilden“ entsprechen.
Schlüsselwörter
Reisebericht, Jean de Léry, Brasilien, Tupinambá, „Guter Wilder“, „Edler Wilder“, Ethnologe, Kolonialgeschichte, Kannibalismus, Zivilisationskritik, Religion, Kulturvergleich.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Jean de Léry?
Jean de Léry war ein calvinistischer Prediger, der zwischen 1556 und 1558 an einer französischen Koloniegründung in Brasilien teilnahm und später einen berühmten Reisebericht verfasste.
Was bedeutet der Mythos vom „Guten Wilden“?
Es ist die Vorstellung von Ureinwohnern als unverdorbenen, glücklichen Menschen, die im Einklang mit der Natur leben und den negativen Einflüssen der Zivilisation fernbleiben.
Wie stellte Léry die Tupinambá-Indianer dar?
Er beschrieb ihre Kultur, Lebensweise und sogar ihren Kannibalismus detailliert, wobei er sie oft als moralisch überlegen gegenüber den „zivilisierten“ Europäern darstellte.
Gilt Jean de Léry als Erfinder des „Edlen Wilden“?
Viele Literaturwissenschaftler sehen in ihm einen der frühesten Verfechter oder sogar den Erfinder dieses literarischen Topos.
Welche Rolle spielt die Zivilisationskritik in seinem Werk?
Léry nutzt den Vergleich mit den brasilianischen Ureinwohnern, um die Grausamkeiten und religiösen Konflikte im damaligen Europa (z. B. während der Religionskriege) scharf zu kritisieren.
- Arbeit zitieren
- Mariela Drexel (Autor:in), 2015, Die "Guten Wilden" in Jean de Lérys "Brasilianisches Tagebuch", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437290