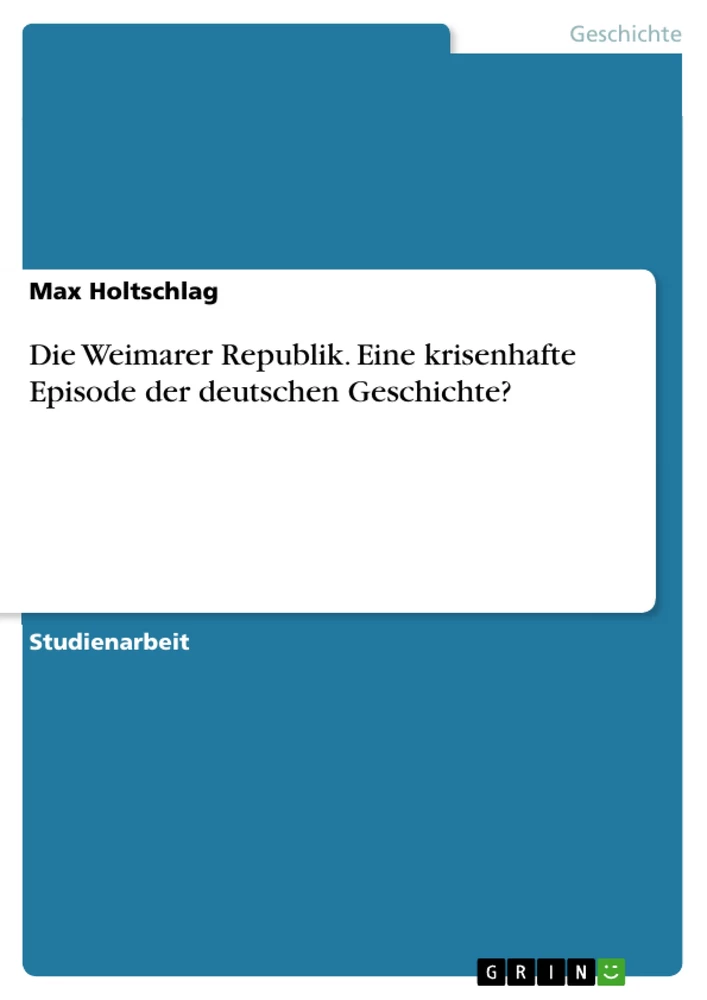Die Arbeit widmet sich der Frage, inwiefern man bei der Weimarer Republik von einer krisenhaften Episode der deutschen Geschichte sprechen kann. Die Krisenhaftigkeit wird hierbei - soweit es denn überhaupt möglich ist - losgelöst von deren Scheitern und dem damit verbundenen Übergang zum Nationalsozialismus untersucht.
Die Beurteilung der Weimarer Republik als politische Krise scheint äußerst etabliert zu sein. Hierfür gibt es unterschiedliche Gründe: die ungelösten Strukturprobleme des Kaiserreichs, die Hypothek des verlorenen Ersten Weltkriegs, das Scheitern und die anscheinende Wehrlosigkeit gegen den Einbruch der nationalsozialistischen Diktatur sowie insbesondere die Unterlegenheit im Vergleich zum Paradebeispiel einer vermeintlich funktionierenden Demokratie - der Bundesrepublik Deutschland.
Das Ziel der Arbeit liegt darin, den Fokus bei der Untersuchung der Krisenaspekte gänzlich auf die Weimarer Republik und ihre politischen sowie gesellschaftlichen Elemente zu lenken, ohne dabei zu sehr - wie in zahlreichen anderen Forschungsarbeiten - auf den Beginn oder das Ende der Republik einzugehen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Krisenfaktoren im politischen System der Weimarer Republik
2.1 Die Weimarer Verfassung
2.2 Der Weimarer Parlamentarismus und das Parteiensystem
3. Gesellschaftliche Krisenfaktoren in der Weimarer Republik
3.1 Stimmungen und Politische Kultur
3.2 Der Einfluss des Ersten Weltkriegs
4. Fortschrittliche Perspektiven der Weimarer Republik
5. Fazit
Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Max Holtschlag (Author), 2016, Die Weimarer Republik. Eine krisenhafte Episode der deutschen Geschichte?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437338
-
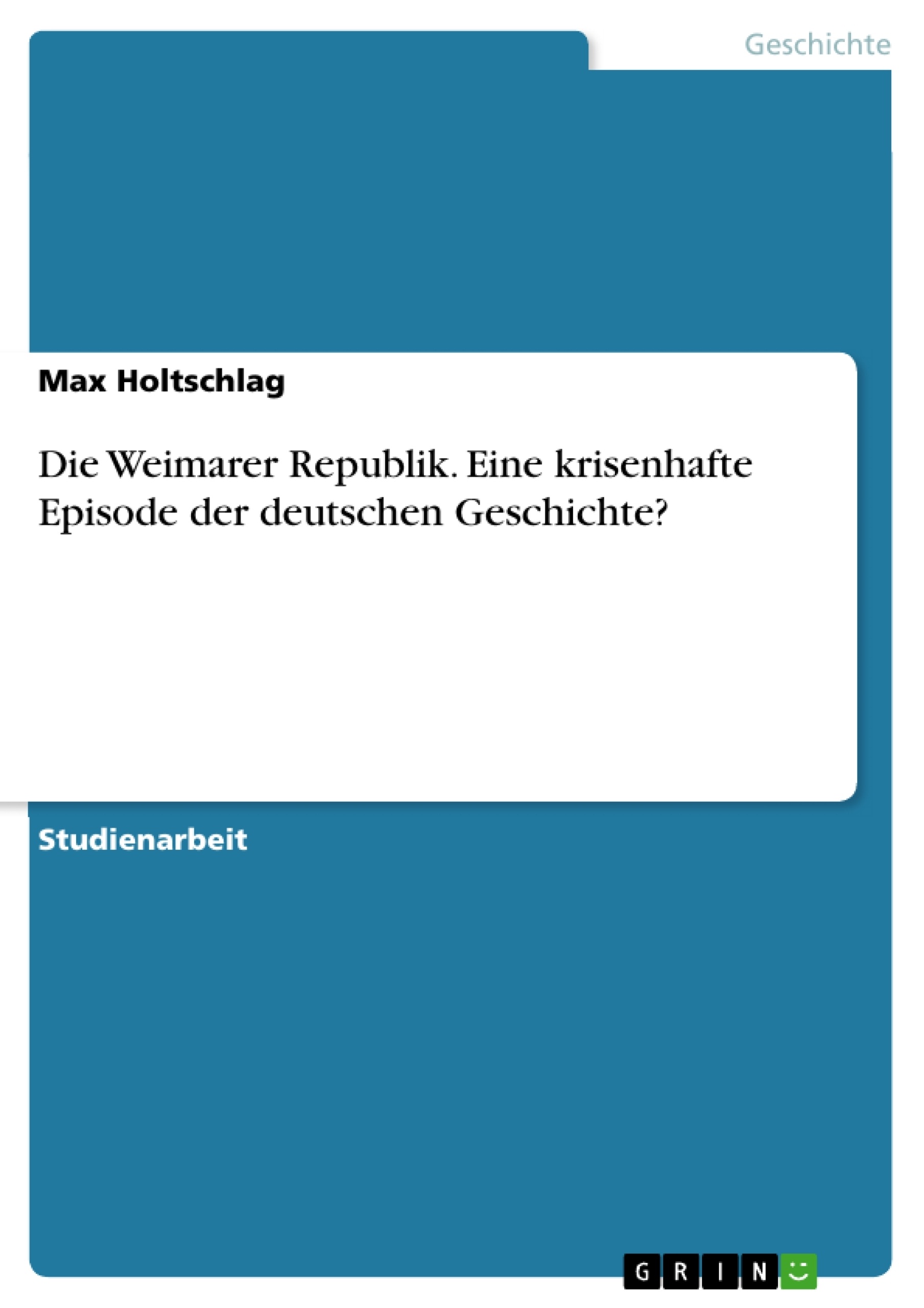
-

-

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X.