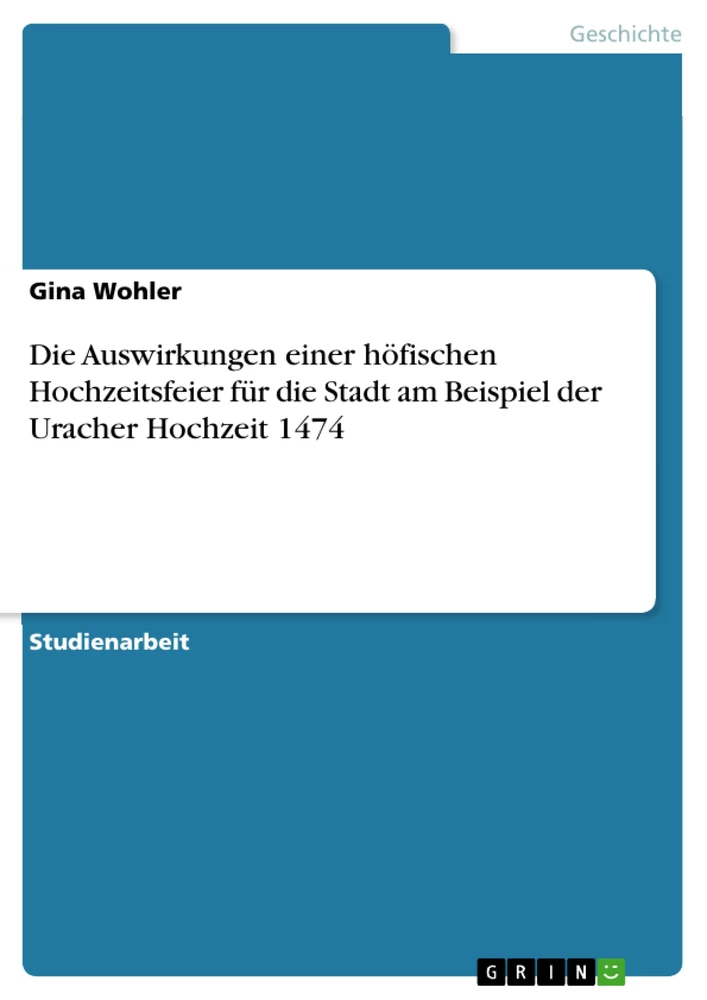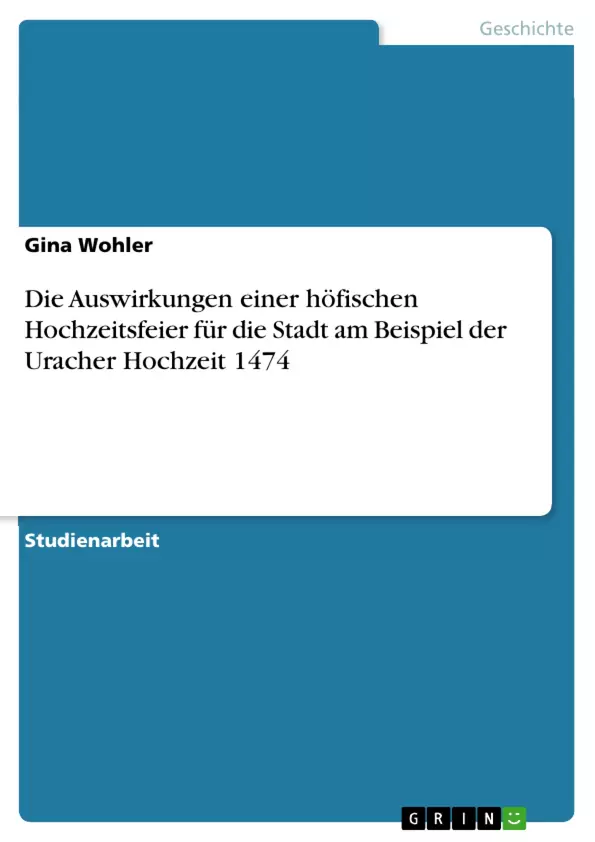Im Folgenden wird die Uracher Hochzeit aus dem Jahre 1474 von Graf Eberhard V. von Württemberg und der Markgräfin Barbara Gonzaga von Mantua dargestellt. Die Grafenhochzeit fand am 4. Juli des Jahres 1474 statt und ließ die Residenzstadt Urach, während des viertägigen Festes, in höfischem Glanz erstrahlen. Dafür hatte Eberhard einen enorm großen Aufwand auf sich genommen, was sich wohl einerseits in der Tatsache begründen lässt, dass er seiner fürstlichen Gemahlin eine standesgemäße Hochzeit bieten wollte, andererseits aber auch darin, dass er, wenn er schon kein Fürst, sondern nur ein Graf war, wenigstens wie ein Fürst feiern wollte; so war Eberhards Hochzeit, rein von seinem zeitgenössischen Status her gesehen, zwar nur eine Grafenhochzeit, die aber in Qualität und Quantität einer Fürstenhochzeit gleichkam. Denn Grafenhochzeiten hatten im Allgemeinen einen vergleichsweise kleinen und schlichten Umfang im Gegensatz zu den fürstlichen Hochzeiten, die immer wieder aufs Neue durch ihre enormen Mengen von versammelten Adligen, die sich prachtvoll in Turnier und Tanz präsentierten, und verbrauchten Ressourcen beeindruckten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung.
- II. Graf Eberhard V. von Württemberg und Barbara Gonzaga von Mantua
- II.1 Graf Eberhard V. von Württemberg:
- II.2 Barbara Gonzaga von Mantua:
- II.3 Graf Eberhard V. und Barbara Gonzaga:
- III. Die Uracher Hochzeit 1474 und die Stadt.
- III.1 Die Vorbereitungen:
- III.2 Die Gäste:
- III.3 Das Fest:
- IV. Fazit....
- V. Quellen- und Literaturverzeichnis.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Uracher Hochzeit von 1474 auf die Stadt Urach. Die Hochzeit von Graf Eberhard V. von Württemberg und Barbara Gonzaga von Mantua war ein großes Fest, das die Residenzstadt in höfischem Glanz erstrahlen ließ. Die Arbeit analysiert die Vorbereitungen, die Gäste und das Fest selbst, um die Auswirkungen des Festes auf die Stadt zu erforschen.
- Die Organisation und der Aufwand von Fürstenhochzeiten im 15. Jahrhundert
- Die Rolle der Stadt Urach als Residenzstadt
- Die Auswirkungen des Festes auf die Stadt Urach, einschließlich der Infrastruktur und der Wirtschaft
- Die Darstellung der Macht und des Prestiges von Graf Eberhard V. durch die Hochzeit
- Die Bedeutung der Hochzeit als politisches und soziales Ereignis
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Einleitung: Die Einleitung stellt die Uracher Hochzeit 1474 und ihre Bedeutung im Kontext höfischer Festlichkeiten im 15. Jahrhundert vor. Die Arbeit befasst sich mit der Frage nach den Auswirkungen der Hochzeit auf die Stadt Urach.
- Kapitel II: Graf Eberhard V. von Württemberg und Barbara Gonzaga von Mantua: Dieses Kapitel stellt die beiden Hochzeitspaare einzeln vor und geht auf ihre Persönlichkeit und ihre Rolle in der Geschichte ein.
- Kapitel III: Die Uracher Hochzeit 1474 und die Stadt: Dieser Abschnitt beleuchtet die Vorbereitungen, die Gäste und das Fest selbst, um die Auswirkungen der Hochzeit auf die Stadt Urach zu analysieren. Dabei wird besonders auf die Infrastruktur und die Wirtschaft der Stadt eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Themen Hochzeitsfeiern, höfische Rituale, Residenzstädte, Städteentwicklung, Graf Eberhard V. von Württemberg, Barbara Gonzaga von Mantua und die Stadt Urach im 15. Jahrhundert. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Auswirkungen einer großen höfischen Veranstaltung auf eine Stadt und ihre Bevölkerung.
Häufig gestellte Fragen
Wer heiratete bei der berühmten Uracher Hochzeit von 1474?
Die Hochzeit fand zwischen Graf Eberhard V. von Württemberg und der Markgräfin Barbara Gonzaga von Mantua statt.
Warum war der Aufwand für diese Grafenhochzeit so außergewöhnlich hoch?
Obwohl Eberhard nur ein Graf war, wollte er durch den Prunk einer Fürstenhochzeit seinen Status und seine Macht gegenüber dem Adel demonstrieren.
Welche Auswirkungen hatte das Fest auf die Stadt Urach?
Das viertägige Fest beeinflusste die städtische Infrastruktur, die Wirtschaft und ließ die Residenzstadt in kurzzeitigem höfischem Glanz erstrahlen.
Wie unterschied sich diese Feier von gewöhnlichen Grafenhochzeiten?
Gewöhnliche Grafenhochzeiten waren schlichter; die Uracher Hochzeit beeindruckte jedoch durch enorme Mengen an Gästen, Turnierdarbietungen und Ressourcenverbrauch.
Welche Quellen wurden für die Untersuchung herangezogen?
Die Arbeit basiert auf einem umfassenden Quellen- und Literaturverzeichnis, das die historischen Details der Vorbereitungen und des Festverlaufs belegt.
- Arbeit zitieren
- Gina Wohler (Autor:in), 2014, Die Auswirkungen einer höfischen Hochzeitsfeier für die Stadt am Beispiel der Uracher Hochzeit 1474, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437406