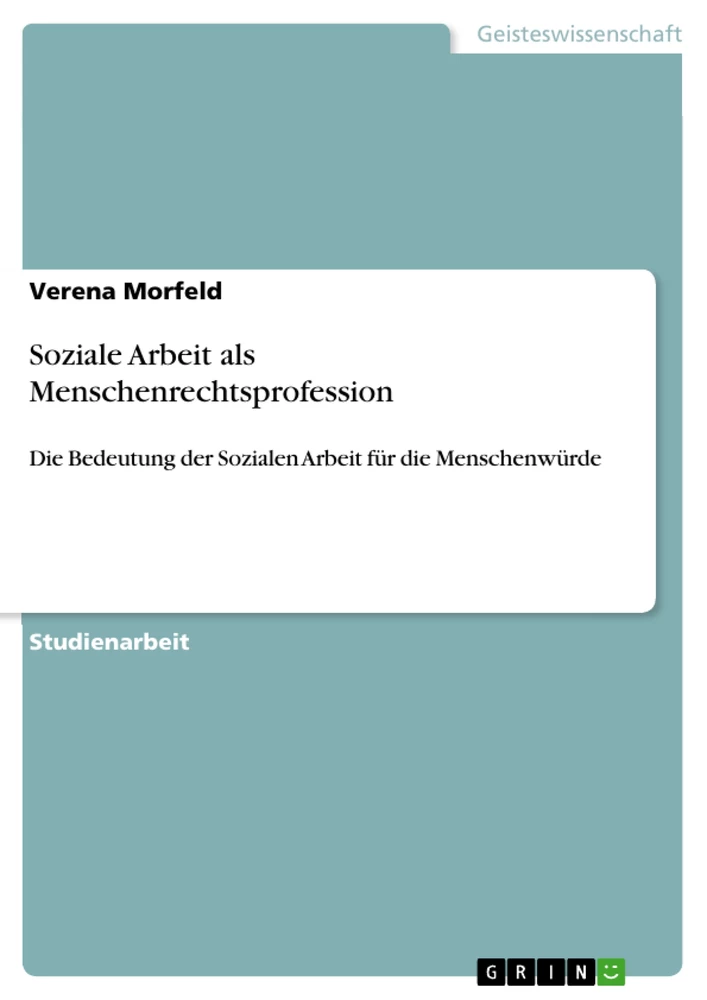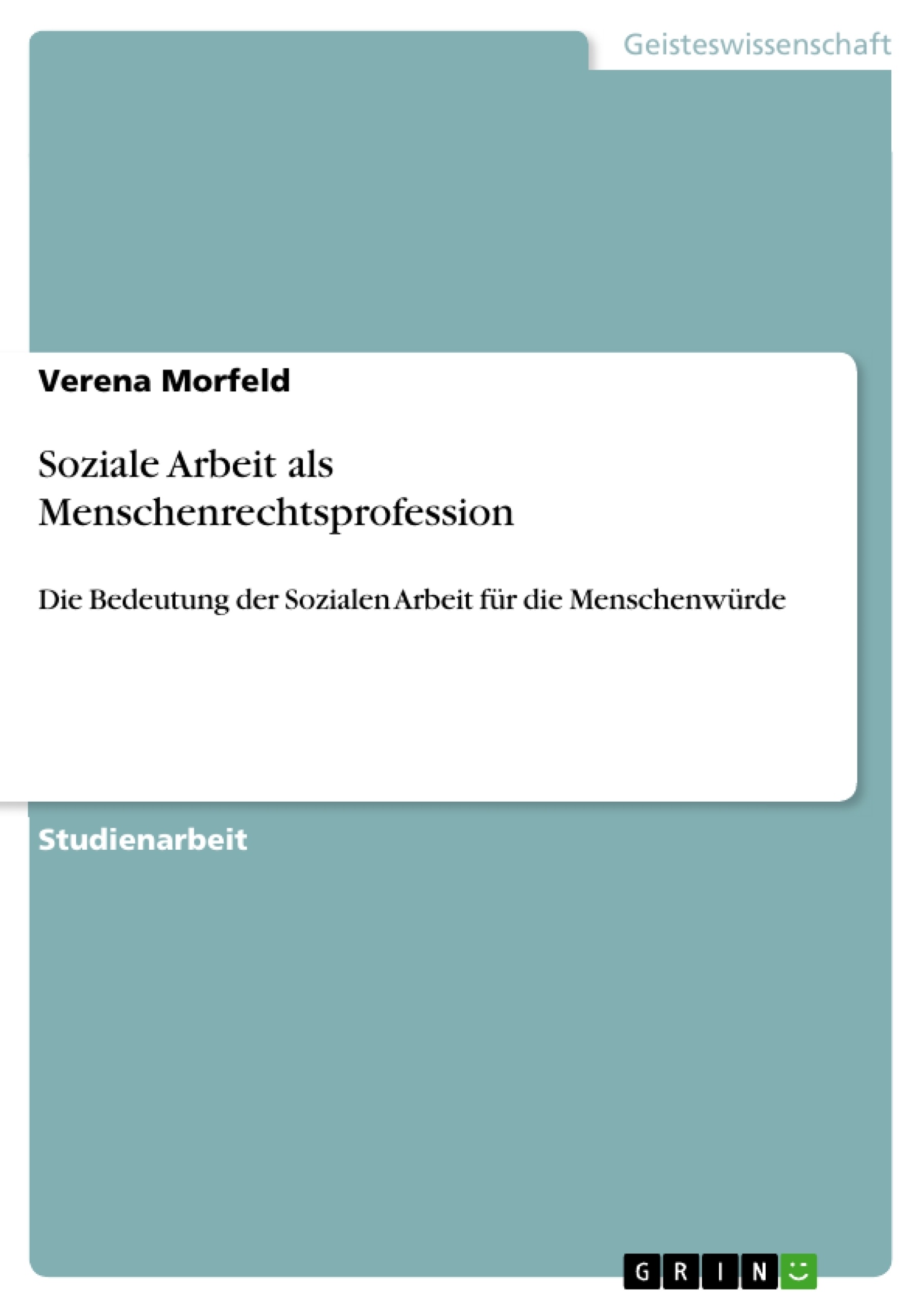Die Thematik um die Menschenrechte ist heutzutage in zahlreichen internationalen, sowie nationalen und politischen Diskursen vertreten und hat eine tiefgreifende Bedeutung für viele Lebensbereiche. Dabei hat die Entstehung der Menschenrechte eine lange Geschichte, in der insbesondere die Menschenwürde einen wichtigen Bezugspunkt darstellt. Auch für die Soziale Arbeit sind die Menschenrechte ein wichtiger Bezugsrahmen. Dahingehend beschäftigt sich die vorliegende Arbeit damit, in wie weit Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession verstanden werden kann. Die zentrale Fragestellung bezieht sich weiterhin auf die Frage was die Bedeutung der Sozialen Arbeit für die Menschenwürde ist.
Im Hinblick darauf wird im Folgenden zunächst auf die Menschenrechte und ihre Merkmale eingegangen. Für das weitere Verständnis wird überdies Bezug auf die Geschichte des heutigen Menschenrechtsverständnisses genommen, um weiterhin Soziale Arbeit in Bezug zu diesen zu setzen. Im Rahmen dessen wird aufgeklärt in wie weit sich Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession verstehen lässt. Weiterhin wird auf das Tripelmandat eingegangen, welches die Soziale Arbeit als Profession und als Menschenrechtsprofession mit sich trägt.
Nachdem aufgeklärt wurde in wie weit sich die Soziale Arbeit als solche versteht, wird im zweiten Teil der Arbeit zentral auf die Menschenwürde eingegangen, die eng mit den Menschenrechten in Verbindung steht. Dazu werden in Anlehnung an die Darstellungen von zwei Autoren insgesamt vier philosophische „Grundpositionen der gegenwärtigen Würdedebatte“ (Menke/Pollmann, 2008) dargestellt, um darauf bezogen nachfolgend den Inhalt der Menschenwürde genauer zu definieren. Anknüpfend wird der Zusammenhang zwischen Menschenrechten und Menschenwürde erläutert. Auf Basis der theoretischen Annahmen, wird daraufhin die Fragestellung der vorliegenden Arbeit diskutiert, die sich mit der Bedeutung der Sozialen Arbeit für die Menschenwürde beschäftigt. In einem Fazit werden die gewonnenen Ergebnisse abschließend noch einmal pointiert dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession
2.1 Menschenrechte und ihre Merkmale
2.2 Geschichte des heutigen Menschenrechtsverständnisses
2.3 Menschenrechte als Bezugsrahmen der Profession Sozialer Arbeit
2.4 Das Tripelmandat
3 Die Menschenwürde als Basis der Menschenrechte
3.1 Vier Grundpositionen des Würdebegriffes
3.1.1 Die Position der Würde als Mitgift
3.1.2 Die Position der Würde als Potenzial
3.1.3 Die Position der Würde als Fähigkeit
3.1.4 Die Position der Würde als Leistung
3.2 Zwischenfazit - Die Relevanz von Selbstachtung und der Unterschied zwischen Würdeschutz und Würdebesitz
3.3 Der Zusammenhang zwischen den Menschenrechten und der Menschenwürde
4 Diskussion - Die Bedeutung der Menschenwürde in der Sozialen Arbeit
5 Fazit
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Anhang
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession bezeichnet?
Weil Menschenrechte der zentrale Bezugsrahmen für die Praxis und Ethik der Sozialen Arbeit sind, die sich für soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde einsetzt.
Was ist das Tripelmandat der Sozialen Arbeit?
Das Tripelmandat umfasst den Auftrag durch den Klienten, den Auftrag durch die Gesellschaft (Staat/Institution) und das professionelle Eigenmandat (Ethik/Menschenrechte).
Welche philosophischen Positionen zur Menschenwürde werden diskutiert?
Die Arbeit stellt vier Positionen dar: Würde als Mitgift, als Potenzial, als Fähigkeit und als Leistung.
Wie hängen Menschenrechte und Menschenwürde zusammen?
Die Menschenwürde bildet das fundamentale Fundament, aus dem sich die spezifischen Menschenrechte als Schutzrechte ableiten.
Was bedeutet „Würdeschutz“ im Gegensatz zu „Würdebesitz“?
Während jeder Mensch Würde besitzt, ist es die Aufgabe der Sozialen Arbeit, den Schutz dieser Würde in prekären Lebenslagen aktiv einzufordern und zu gewährleisten.
- Quote paper
- Verena Morfeld (Author), 2018, Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437482