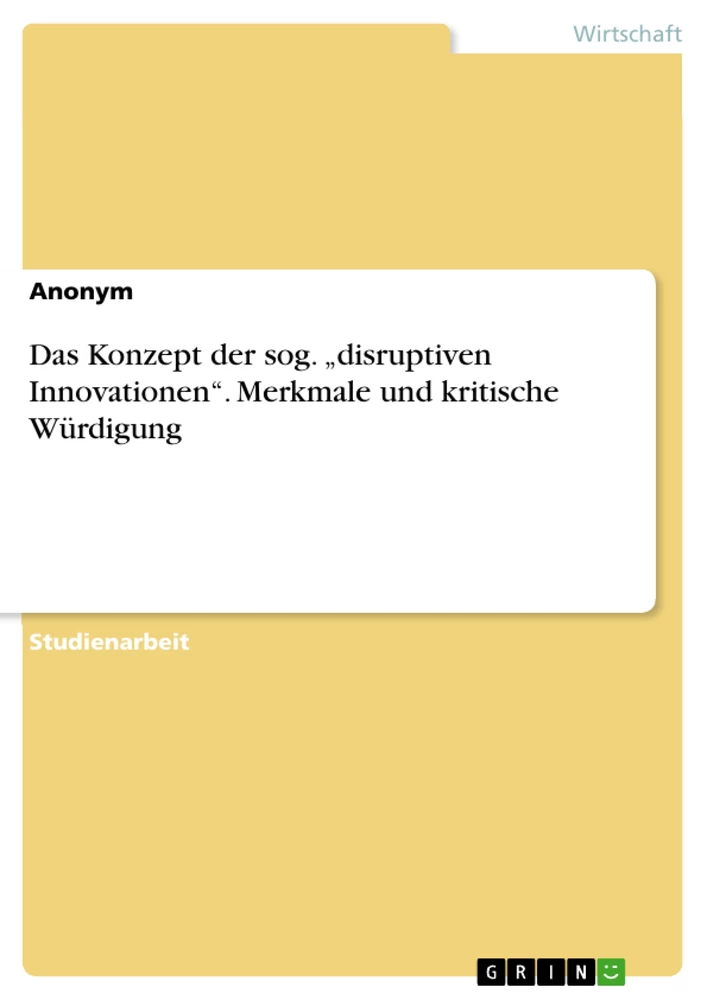Ziel dieser Arbeit ist es, Prinzipien und Wirkungsweisen in Bezug auf disruptive Innovationen verständlich darzustellen. In erster Linie wird die Begrifflichkeit mit Hilfe der Wortherkunft und deren Zusammenhänge erklärt. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird darauf eingegangen, wie Clayton Christensen den Begriff disruptive Technologien etabliert und erklärt. Diese Veranschaulichungen beziehen sich in dieser Arbeit auf Arten von Technologien, Eigenschaften und Unterschiede der Disruption und welche Probleme etablierte Marktteilnehmer mit der Disruption haben. Im Anschluss folgen aktuelle Beispiele zur Veranschaulichung, sowie eine Zusammenfassung mit kritischer Auseinandersetzung mit der Thematik. Erfindungen, jeder kennt einige revolutionäre Erfindungen. Von der Dampfmaschine bis zum Automobil, vom Morsegerät bis zum Smartphone. Doch worauf basieren eigentlich diese Erfindungen, oder auch Innovationen? Innovationen basieren auf Unzufriedenheit und auf ungelösten Problemen. Innovationen und Erfindungen lösen Probleme und erleichtern das Leben auf der Erde, jene erzeugen in den meisten Fällen Wohlstand. Eine sehr wichtiger und elementarer Nebeneffekt von neu auf den Markt gebrachten Innovationen ist die Veränderung. Diese Veränderung zum Beispiel eines Marktes kann zur Folge haben, dass jene nicht von allen Teilnehmern erwünscht ist. In den meisten Fällen ist eine Veränderung von den wenigsten Marktteilnehmern erwünscht, da diese möglicherweise Produkte von sogenannten Platzhirschen in Frage stellen könnten. In besonderen Fällen kann dies bedeuten, dass ganze Nischen, Produktgruppen oder auch ganze Branchen auf den Kopf gestellt werden. Problematisch und schwierig für Unternehmen ist die frühzeitige Erkennung und Bewertung dieser Technologien in Bezug auf Auswirkungen in der Zukunft. Es stellt sich meist die Frage, ob sich diese neuen grundlegend revolutionären Technologien in dem jeweiligen Markt durchsetzen könnten. Wird diese Frage positiv beantwortet, so stellt sich gleich die nächste Frage: Macht es Sinn in diesen neuen Markt zu investieren, um die präsentative Marktdominanz nicht zu verlieren? Diese beiden korrelierenden Thematiken und Problemfälle beschreibt der Autor Clayton Christensen mit dem Werk „The Innovator's Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Problemstellung
- 1.1 Ziel und Aufbau der Arbeit
- 2. Disruptive Innovation, Wortherkunft und Definition
- 3. Betrachtungsweise von Christensen
- 3.1 Disruptive und Sustaining Innovations
- 3.2 Grundlegende Eigenschaften disruptiver Innovation
- 3.3 Abgrenzungen disruptiver Innovationen
- 3.3.1 Innovationsintensität
- 3.4 Targetierung
- 4. Veranschaulichung am Beispiel Amazon
- 4.1 Weitere Beispiele
- 5. Zusammenfassung und kritische Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, das Konzept disruptiver Innovationen nach Clayton Christensen zu erläutern und kritisch zu würdigen. Sie beleuchtet die relevanten Zusammenhänge, insbesondere den Aspekt der Innovationsintensität, und untersucht anhand von Beispielen die Anwendbarkeit und Grenzen des Konzepts.
- Definition und Wortherkunft disruptiver Innovationen
- Christensens Betrachtungsweise von disruptiven und Sustaining Innovations
- Charakteristische Merkmale disruptiver Innovationen
- Anwendungsbeispiele und deren Analyse
- Kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Problemstellung: Die Einleitung führt in die Thematik der disruptiven Innovationen ein und stellt die Frage nach den Grundlagen revolutionärer Erfindungen und deren Auswirkungen auf Märkte. Sie thematisiert die Herausforderungen für Unternehmen, neue Technologien frühzeitig zu erkennen und deren zukünftige Auswirkungen einzuschätzen, und die damit verbundene Entscheidungsfindung bezüglich Investitionen. Das Kapitel legt den Fokus auf die Problematik der Marktdominanz und die Notwendigkeit, disruptive Innovationen zu verstehen, um diese Herausforderungen zu meistern. Der Bezug auf das Werk von Clayton Christensen wird hergestellt, um den Kontext des weiteren Vorgehens zu etablieren.
2. Disruptive Innovation, Wortherkunft und Definition: Dieses Kapitel liefert eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Begriffs „disruptive Innovation“. Es analysiert die etymologische Wurzel des Wortes „disruptiv“, welches auf das lateinische Verb „dirumpere“ (zerreißen, zerstören) zurückgeht, und verbindet dies mit der Definition von „Innovation“ als neuartige, fortschrittliche Problemlösung. Die Kombination beider Begriffe wird präzise definiert, wobei der Fokus auf der grundlegenden Veränderung und dem potenziellen „Zerstören“ etablierter Systeme liegt. Das Kapitel betont den Einfluss von Clayton Christensen auf die Popularisierung dieses Begriffs.
3. Betrachtungsweise von Christensen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Christensen's Perspektive auf disruptive Innovationen. Es verdeutlicht, dass neue Marktteilnehmer nur geringe Chancen gegen etablierte Unternehmen haben, wenn sie lediglich ähnliche oder leicht verbesserte Produkte anbieten. Stattdessen betont der Abschnitt die Bedeutung von überraschenden und praktikablen Innovationen ("Gamechanger"). Es werden die Herausforderungen für das Management etablierter Unternehmen angesprochen, insbesondere die oft träge Entscheidungsfindung, und die Notwendigkeit, separate Abteilungen zu schaffen, die dynamische und agile Arbeitsumgebungen fördern. Der Abschnitt unterscheidet zwischen disruptiven und Sustaining Innovationen.
Schlüsselwörter
Disruptive Innovation, Clayton Christensen, Innovationsintensität, Sustaining Innovation, Marktdisruption, Gamechanger, Marktdominanz, Technologieentwicklung, Unternehmensstrategie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Disruptive Innovationen nach Clayton Christensen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Konzept der disruptiven Innovationen nach Clayton Christensen. Sie beinhaltet eine Einleitung mit Problemstellung und Zielsetzung, eine detaillierte Erläuterung des Begriffs "disruptive Innovation", Christensens Betrachtungsweise inklusive der Unterscheidung zwischen disruptiven und sustaining Innovationen, Anwendungsbeispiele (u.a. Amazon) und eine kritische Schlussbetrachtung. Das Dokument enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist die Erklärung und kritische Würdigung des Konzepts disruptiver Innovationen nach Clayton Christensen. Es werden die relevanten Zusammenhänge, insbesondere die Innovationsintensität, beleuchtet und die Anwendbarkeit sowie Grenzen des Konzepts anhand von Beispielen untersucht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Wortherkunft disruptiver Innovationen, Christensens Unterscheidung zwischen disruptiven und Sustaining Innovationen, charakteristische Merkmale disruptiver Innovationen, Anwendungsbeispiele und deren Analyse, und eine kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept. Besonderes Augenmerk liegt auf der Innovationsintensität und den Herausforderungen für etablierte Unternehmen.
Wie wird der Begriff "disruptive Innovation" definiert?
Der Begriff wird etymologisch von dem lateinischen Verb "dirumpere" (zerreißen, zerstören) abgeleitet und mit der Definition von "Innovation" als neuartige, fortschrittliche Problemlösung verbunden. Der Fokus liegt auf der grundlegenden Veränderung und dem potenziellen "Zerstören" etablierter Systeme. Die Arbeit betont den Einfluss von Clayton Christensen auf die Popularisierung dieses Begriffs.
Welche Rolle spielt Clayton Christensen?
Clayton Christensen ist die zentrale Referenzperson dieser Arbeit. Seine Perspektive auf disruptive Innovationen, insbesondere die Unterscheidung zwischen disruptiven und sustaining Innovationen und die Herausforderungen für etablierte Unternehmen, bilden den Kern der Analyse. Die Arbeit erläutert seine Argumentation und bewertet diese kritisch.
Welche Beispiele werden verwendet?
Die Arbeit verwendet Amazon als ein Beispiel für eine disruptive Innovation. Weitere Beispiele werden erwähnt, jedoch nicht im Detail analysiert.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung und Problemstellung, Disruptive Innovation, Wortherkunft und Definition, Betrachtungsweise von Christensen, Veranschaulichung am Beispiel Amazon, und Zusammenfassung und kritische Schlussbetrachtung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Disruptive Innovation, Clayton Christensen, Innovationsintensität, Sustaining Innovation, Marktdisruption, Gamechanger, Marktdominanz, Technologieentwicklung, Unternehmensstrategie.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, welche deren Inhalt und Schwerpunkte prägnant beschreibt.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit dem Thema disruptive Innovationen auseinandersetzen möchte. Sie ist geeignet für Studierende und Wissenschaftler, die sich mit den theoretischen Grundlagen und praktischen Implikationen disruptiver Innovationen befassen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Das Konzept der sog. „disruptiven Innovationen“. Merkmale und kritische Würdigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437560