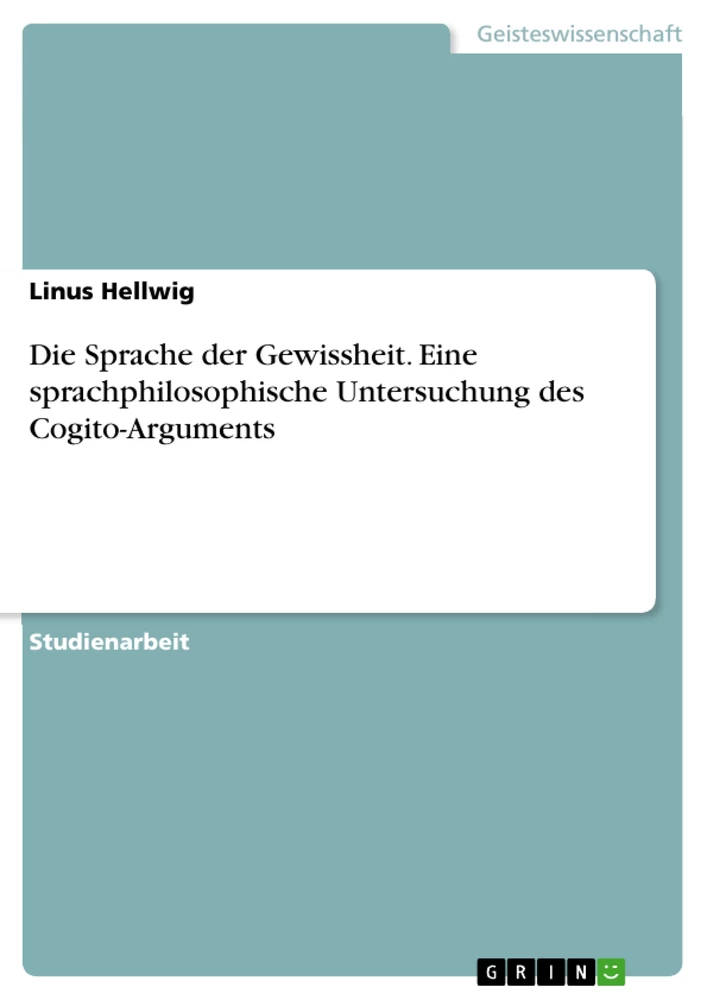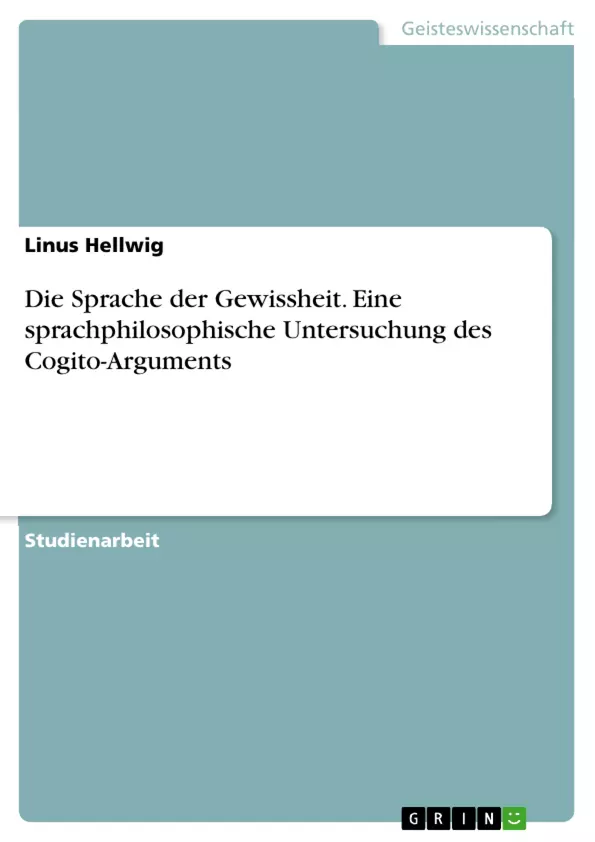Das Ziel dieser Arbeit ist es, die rhapsodischen Bemerkungen der Philosophischen Untersuchungen Wittgensteins für eine Kritik an der rationalistischen Philosophie Descartes‘ fruchtbar zu machen. Bereits Gilbert Ryle hat mit seinem Werk Der Begriff des Geistes die Gangbarkeit einer an Wittgensteins Sprachphilosophie angelehnten kritischen Auseinandersetzung mit der cartesianischen Metaphysik aufgezeigt. Aber auch Wittgenstein selbst hat in einer Bemerkung, die im Zuge der Ausarbeitungen des zweiten Teils der PhU niedergeschrieben wurde, auf die Möglichkeit einer Konfrontation von sprachphilosophischen Überlegungen mit den Fragen der Metaphysik hingedeutet:
"Philosophische Untersuchungen: begriffliche Untersuchungen. Das Wesentliche der
Metaphysik: daß ihr der Unterschied zwischen sachlichen und begrifflichen Untersuchungen nicht klar ist. Die metaphysische Frage ist dem Anschein nach eine sachliche, obschon das Problem ein begriffliches ist." (BPP I, § 949)
Ich möchte also jene „begriffliche Untersuchungen“ aufnehmen und werde dabei im Unterschied zu Ryle, der sich in Orientierung an Wittgenstein mit dem cartesianischen Leib-Seelen-Dualismus auseinandergesetzt hat, gezielt die Cogito-Argumentation in Descartes‘ Meditationen über die Erste Philosophie anhand der PhU evaluieren. Ich werde zunächst in einem kurzen Abschnitt die Argumentationsstruktur der Cogito-Überlegungen der ersten beiden Meditationen Descartes‘ rekonstruieren, um dann in einem zweiten Abschnitt meine eigenen Überlegungen für eine Kritik des Cogito-Arguments mittels der PhU auszuführen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Cogito-Argument
- Die Sprache der Gewissheit
- Abschlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Cogito-Argument von René Descartes aus sprachphilosophischer Perspektive und kritisiert dessen Gültigkeit mit Hilfe der Philosophischen Untersuchungen Ludwig Wittgensteins. Ziel ist es, die von Descartes angestrebte sichere Grundlage für Erkenntnis durch eine kritische Auseinandersetzung mit der sprachlichen Vermittlung von Gewissheit in Frage zu stellen.
- Die Argumentationsstruktur des Cogito-Arguments
- Die Rolle der Sprache in der Konstruktion von Gewissheit
- Die Bedeutung des Privatsprachen-Arguments für die Kritik des Cogito
- Die Grenzen der Selbsterkenntnis und die Abhängigkeit vom sprachlichen Kontext
- Die kontingente Natur des Ich-Gefühls und seine sprachliche Konstitution
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit erläutert ihre Zielsetzung, welche darin besteht, Descartes' Cogito-Argument anhand von Wittgensteins Sprachphilosophie zu kritisieren.
- Das Cogito-Argument: Das Kapitel beschreibt Descartes' drei Zweifelsgründe (Sinneswahrnehmung, Traumargument, Genius Malignus) und rekonstruiert die Argumentationsstruktur der ersten beiden Meditationen, insbesondere die These der Gewissheit der eigenen Existenz.
- Die Sprache der Gewissheit: Das Kapitel untersucht die Rolle der Sprache in der Konstruktion von Gewissheit und argumentiert, dass Descartes' Cogito-Argument aufgrund der sprachlichen Vermittlung von Erkenntnissen anfällig für Kritik ist.
Schlüsselwörter
Cogito-Argument, Descartes, Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Sprachphilosophie, Gewissheit, Privatsprachen-Argument, Selbsterkenntnis, Ich-Gefühl, Sprache, Skepsis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel dieser sprachphilosophischen Untersuchung?
Das Ziel ist es, Descartes' rationalistisches Cogito-Argument mithilfe der Spätphilosophie Ludwig Wittgensteins, insbesondere seiner "Philosophischen Untersuchungen", kritisch zu hinterfragen.
Welche Rolle spielt die Sprache bei der Konstruktion von Gewissheit?
Die Arbeit argumentiert, dass Erkenntnisse sprachlich vermittelt sind. Da Sprache ein öffentliches Regelsystem ist, wird die von Descartes angestrebte rein subjektive, private Gewissheit problematisch.
Was sind die drei Zweifelsgründe von Descartes?
Descartes führt in seinen Meditationen die Täuschung durch Sinneswahrnehmungen, das Traumargument und die Hypothese eines bösen Geistes (Genius Malignus) als Gründe für radikale Skepsis an.
Wie wird das Privatsprachen-Argument in der Kritik genutzt?
Das Privatsprachen-Argument von Wittgenstein dient dazu, die Gültigkeit des Cogito-Arguments zu prüfen, indem es die Abhängigkeit der Selbsterkenntnis vom sprachlichen und sozialen Kontext aufzeigt.
Inwiefern unterscheidet sich diese Arbeit von Gilbert Ryles Kritik?
Während Ryle sich auf den Leib-Seelen-Dualismus konzentrierte, fokussiert sich diese Untersuchung gezielt auf die sprachliche Struktur und Evaluierung des konkreten Cogito-Arguments.
- Quote paper
- Linus Hellwig (Author), 2017, Die Sprache der Gewissheit. Eine sprachphilosophische Untersuchung des Cogito-Arguments, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437599