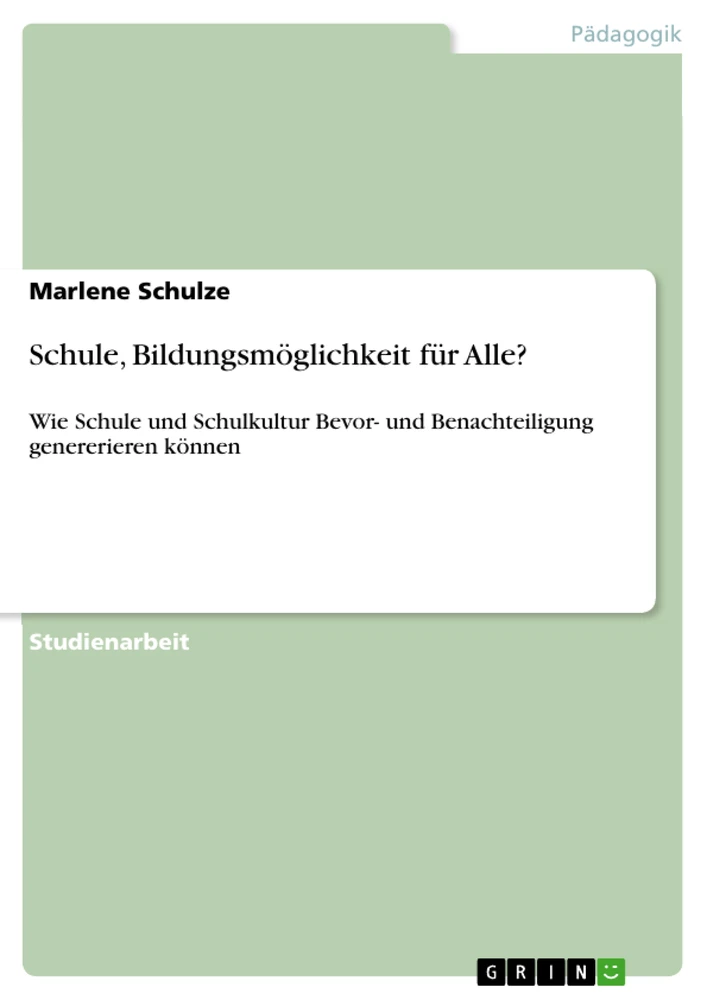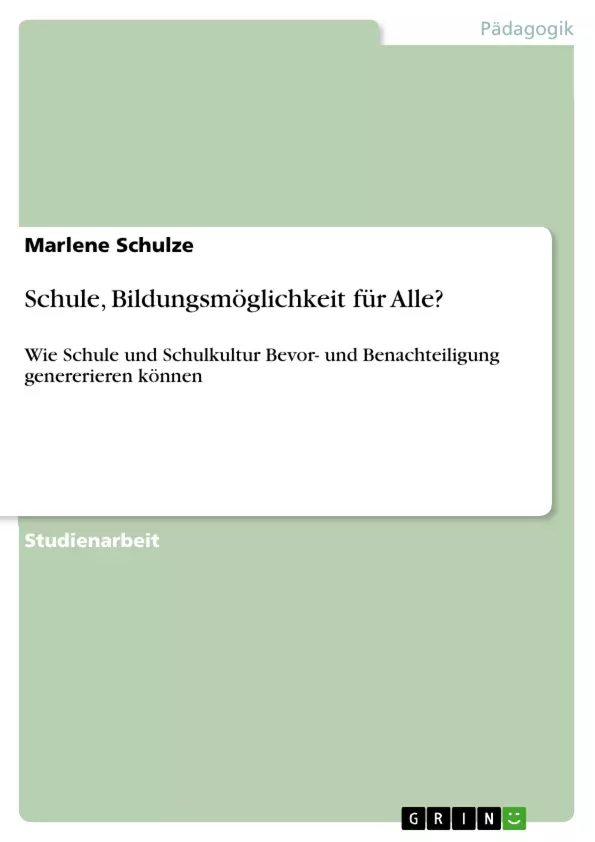Kaum ein System in Deutschland ist so komplex wie das Schulsystem: flächendeckend, für verschiedene Altersgruppen, privat oder öffentlich und dabei zusätzlich föderal organisiert.
Die Spannbreite an dem, was Schule leistet oder darstellt, ist groß. Diese Hausarbeit versucht, sich dem System Schule zu nähern.
Ausgangspunkt dieser Hausarbeit ist das vorangegangene Seminar „Migration Regimes and Space“, was auf den ersten Blick nichts mit Schule gemein hat. Und doch soll, aus einer interdisziplinären Perspektive, dieses Feld thematisiert werden. Dazu wird erziehungswissenschaftliche, aber auch soziologische Literatur zur Erklärung von schulischem Ausschluss und Zugang herangezogen. Der räumliche Aspekt des Systems Schule wird miteinbezogen. Auch Ansätze des Regimebegriffs werden einfließen. Trotzdem bleiben diese Schlagwörter eher im Hintergrund der Ausarbeitung.
Die Leistung dieser Hausarbeit soll zum einen darin bestehen, dass Thema unter dem Aspekt „Migration Regimes & Space“ zu fassen. Zum anderen versuche ich, Mechanismen der Benachteiligung und der Bevorteiligung unter Zuhilfenahme der Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu zu erläutern. Es wird versucht, mit Hilfe der Beispiele von Zugängen zu Eliteschulen und des Kontrastes der sich durchziehenden Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund Mechanismen aufzuzeigen. Dazu sollen beide Phänomene der Illustrierung dienen und werden, auf Grund des knappen Umfangs der Arbeit, nicht bis ins Detail beschrieben und erforscht.
Der Anspruch soll sein, Bevor- und Benachteiligungsmechanismen zu markieren und Anstöße für Veränderungen aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Relevanz in der (Migrations-)Forschung
- Schule als...
- ...Teil des Bildungssystems
- ...Institution
- ...Schulkultur
- ...Raum
- ...Gesamtheit
- Bourdieu und der Habitus
- Grundsätzliche Überlegungen
- Ökonomisches Kapital
- Kulturelles Kapital
- Soziales Kapital
- Anwendbarkeit in Bezug auf schulische Bildung
- Kritik an Bourdieus Modell
- Bevorteiligung und Benachteiligung
- Ausschluss und Zugang nach Bourdieu
- Ausschluss und Zugang an Schulen
- Elite und Exzellenz
- Migrationshintergrund: (Immer noch) ein Problem?
- Ausblick: Wie können Ungleichheiten überwunden werden?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem komplexen deutschen Schulsystem und analysiert, wie es Bevor- und Benachteiligung von Schülern, insbesondere mit Migrationshintergrund, generiert. Im Zentrum steht die Frage, wie Schule als Teil des Bildungssystems, als Institution und als Raum zur Reproduktion von Ungleichheiten beiträgt. Die Arbeit untersucht die Relevanz der Bildung in der Migrationsforschung und beleuchtet das Konzept des Habitus nach Pierre Bourdieu, um die Mechanismen von Bevor- und Benachteiligung zu erklären.
- Das deutsche Schulsystem und seine Rolle in der Reproduktion von Ungleichheiten
- Die Relevanz von Bildung in der Migrationsforschung
- Das Konzept des Habitus nach Pierre Bourdieu
- Bevor- und Benachteiligungsmechanismen im deutschen Schulsystem
- Die Rolle von Migrationshintergrund im Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz der Bildung im Kontext der Migrationsforschung heraus und erläutert den Fokus der Hausarbeit auf die Analyse von Bevor- und Benachteiligungsmechanismen im deutschen Schulsystem.
Schule als...
Dieser Abschnitt definiert die Schule als Teil des Bildungssystems, als Institution, als Schulkultur und als Raum. Er analysiert die Besonderheiten des deutschen Schulsystems, die Rolle von staatlicher Aufsicht und die Unterschiede zwischen öffentlichen und privaten Schulen.
Bourdieu und der Habitus
Dieser Teil stellt die Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu vor und erklärt die verschiedenen Kapitalformen: ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital. Die Arbeit untersucht die Anwendbarkeit dieser Theorie auf das Schulsystem und beleuchtet kritische Aspekte des Bourdieu-Modells.
Bevorteiligung und Benachteiligung
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Ausschluss und Zugang zu Bildung nach Bourdieu und beleuchtet die Mechanismen, die zu Benachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund führen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themengebiete Bildung, Migrationsforschung, Schulsystem, Bevor- und Benachteiligung, Habitus, Kapitaltheorie, Pierre Bourdieu, Migrationshintergrund, Ausschluss, Zugang, Elite, Exzellenz, und Ungleichheit.
Häufig gestellte Fragen
Wie reproduziert die Schule soziale Ungleichheit?
Durch Mechanismen der Bevor- und Benachteiligung, die oft an das kulturelle und soziale Kapital der Elternhäuser anknüpfen.
Was versteht Pierre Bourdieu unter "Habitus"?
Der Habitus ist ein System von Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmustern, das durch die soziale Herkunft geprägt wird und den Bildungserfolg beeinflusst.
Welche Kapitalformen unterscheidet Bourdieu?
Er unterscheidet ökonomisches Kapital (Geld), kulturelles Kapital (Bildung/Wissen) und soziales Kapital (Beziehungen/Netzwerke).
Sind Schüler mit Migrationshintergrund im deutschen System benachteiligt?
Ja, die Arbeit zeigt auf, dass der Zugang zu Eliteschulen erschwert ist und Migrationshintergrund oft mit geringerem schulischem Erfolg korreliert.
Was ist die Rolle von Privatschulen in diesem Kontext?
Privatschulen können als Räume der Exzellenz dienen, die jedoch oft soziale Schließungsprozesse fördern und den Zugang für bildungsferne Schichten erschweren.
- Quote paper
- Marlene Schulze (Author), 2016, Schule, Bildungsmöglichkeit für Alle?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437695