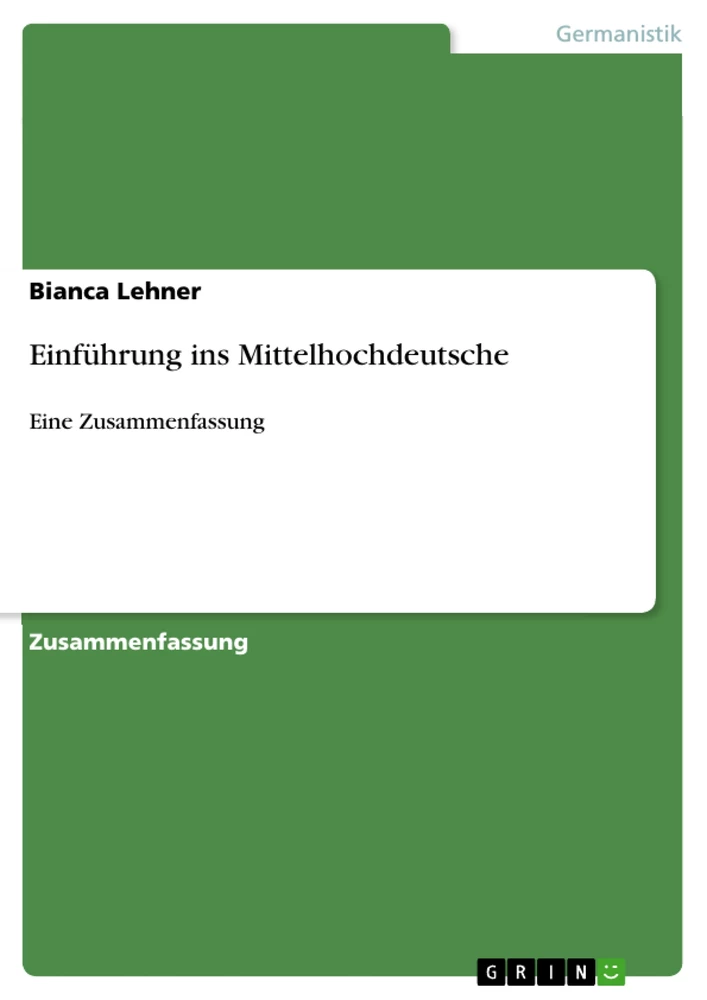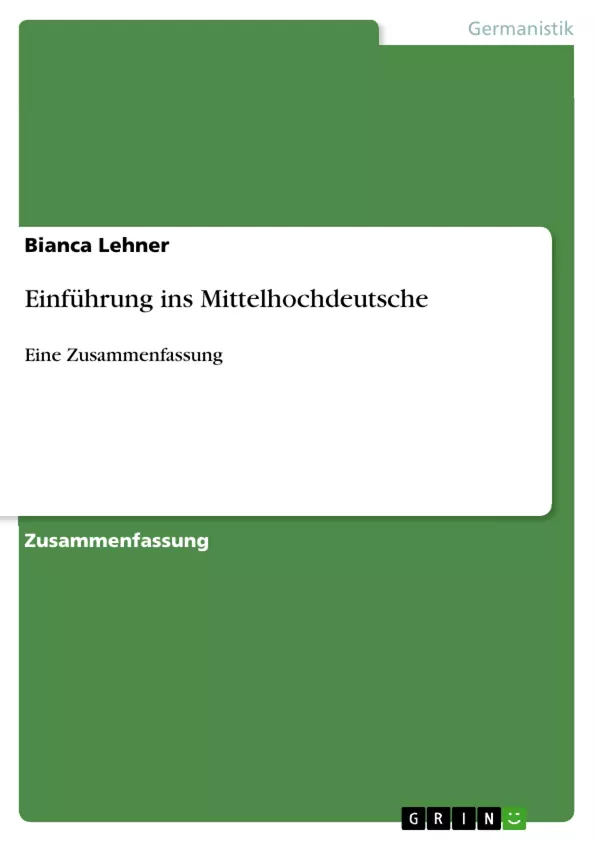Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Zusammenfassung zum Proseminar "Einführung ins Mittelhochdeutsche". Sie enthält Allgemeines zum Mittelhochdeutschen, erste und zweite Lautverschiebung, Sprachphänomene, Aussprache und Grammatik des Mittelhochdeutschen.
Inhaltsverzeichnis
- Der arme Heinrich
- Prolog
- Allgemeines
- Aussprache
- Sprachphänomene
- Neuhochdeutsche Diphthongierung
- Neuhochdeutsche Monophthongierung
- Neuhochdeutsche Dehnung
- Neuhochdeutsche Kürzung
- Neuhochdeutsche Rundung
- Neuhochdeutsche Entrundung
- Neuhochdeutsche Senkung vor Nasal
- Konsonantenwandel
- Grammatischer Wechsel
- Assimilation
- Kontraktionen
- Klise
- Apokope und Synkope
- Verben
- Starke Verben
- Schwache Verben
- Präterito-Präsentien
- Wurzelverben
- Verbum substantivum ,,sîn“ (Sein)
- Temporaler Geltungsbereich
- Substantive
- Schwache Deklination
- Starke Deklination
- Negation
- Adjektiv
- Adverbien
- Pronomina
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text dient als Einführung in die mittelhochdeutsche Sprache und Literatur. Er soll den Studierenden ein grundlegendes Verständnis der sprachlichen und literarischen Besonderheiten des Mittelhochdeutschen vermitteln.
- Entwicklung des Mittelhochdeutschen
- Lautwandel und grammatische Veränderungen
- Merkmale der mittelhochdeutschen Literatur
- Wichtige mittelhochdeutsche Autoren und Werke
- Analyse des mittelhochdeutschen Textes „Der arme Heinrich“
Zusammenfassung der Kapitel
Der arme Heinrich
In diesem Kapitel wird die Erzählung „Der arme Heinrich“ von Hartmann von Aue vorgestellt. Zunächst wird der Prolog beleuchtet, in dem sich der Dichter vorstellt und auf seine Quellen verweist. Anschließend werden die wichtigsten Handlungspunkte der Erzählung zusammengefasst: Heinrich, ein reicher Fürst, wird vom Aussatz befallen und kann nur durch das Herzblut einer Jungfrau gerettet werden. Die Tochter des Meiers, auf dessen Hof sich Heinrich zurückgezogen hat, ist bereit, sich für ihn zu opfern.
Aussprache
In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Besonderheiten der mittelhochdeutschen Aussprache erläutert. Die Aussprache ähnelt dem heutigen Hochdeutsch, jedoch gibt es einige Unterschiede in der Betonung und der Länge der Vokale.
Sprachphänomene
Hier werden verschiedene sprachliche Entwicklungen vorgestellt, die zur Entstehung des Neuhochdeutschen führten. Diese Phänomene umfassen die Diphthongierung, Monophthongierung, Dehnung, Kürzung, Rundung, Entrundung und Senkung von Vokalen sowie Veränderungen im Konsonantenbestand.
Verben
Dieses Kapitel behandelt die mittelhochdeutschen Verben. Es werden starke und schwache Verben, Präterito-Präsentien und Wurzelverben erklärt. Darüber hinaus wird die Konjugation des Verbum substantivum „sîn“ (Sein) erläutert.
Substantive
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Deklination der Substantive. Es werden die schwache und starke Deklination sowie die Besonderheiten der Kasus-Endungen erklärt.
Negation
In diesem Kapitel wird die Verwendung der Negation im Mittelhochdeutschen behandelt. Es werden verschiedene Möglichkeiten der Negation sowie die Negation in konjunktivistischen Nebensätzen erklärt.
Adjektiv
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Deklination und Steigerung der Adjektive im Mittelhochdeutschen.
Adverbien
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Merkmale der mittelhochdeutschen Adverbien erläutert.
Pronomina
Dieser Abschnitt stellt verschiedene Arten von Pronomen im Mittelhochdeutschen vor, darunter Interrogativpronomen und Indefinitpronomen.
Schlüsselwörter
Mittelhochdeutsch, Hartmann von Aue, Der arme Heinrich, Lautwandel, Grammatik, Literatur, Sprachentwicklung, Diphthongierung, Monophthongierung, Deklination, Konjugation, Negation, starke Verben, schwache Verben.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die wichtigsten Merkmale des Mittelhochdeutschen?
Dazu gehören spezifische Lautphänomene wie die Diphthongierung, Monophthongierung sowie eine komplexe Grammatik mit starken und schwachen Verben.
Worum geht es im Werk „Der arme Heinrich“?
Es ist eine Erzählung von Hartmann von Aue über einen aussätzigen Fürsten, der nur durch das freiwillige Opfer einer Jungfrau geheilt werden kann.
Was ist der „Grammatische Wechsel“?
Ein regelmäßiger Konsonantenwechsel innerhalb eines Wortstammes, der auf das Vernersche Gesetz zurückgeht und im Mittelhochdeutschen noch stark ausgeprägt ist.
Wie unterscheidet sich die Aussprache vom Neuhochdeutschen?
Die Aussprache unterscheidet sich vor allem in der Vokallänge, der Betonung und der Tatsache, dass viele Buchstaben (z. B. das 'v' als 'f') anders artikuliert werden.
Was sind Präterito-Präsentien?
Verben, deren ursprüngliche Präteritalform eine gegenwärtige Bedeutung angenommen hat (z. B. "wissen" oder "können").
- Quote paper
- Bianca Lehner (Author), 2014, Einführung ins Mittelhochdeutsche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437809