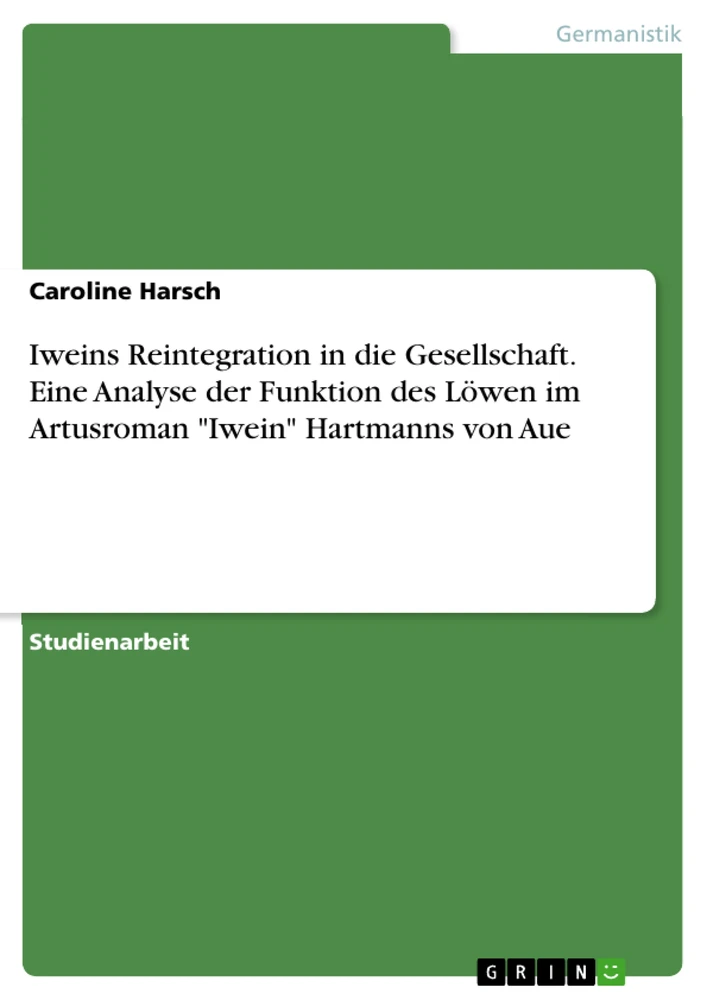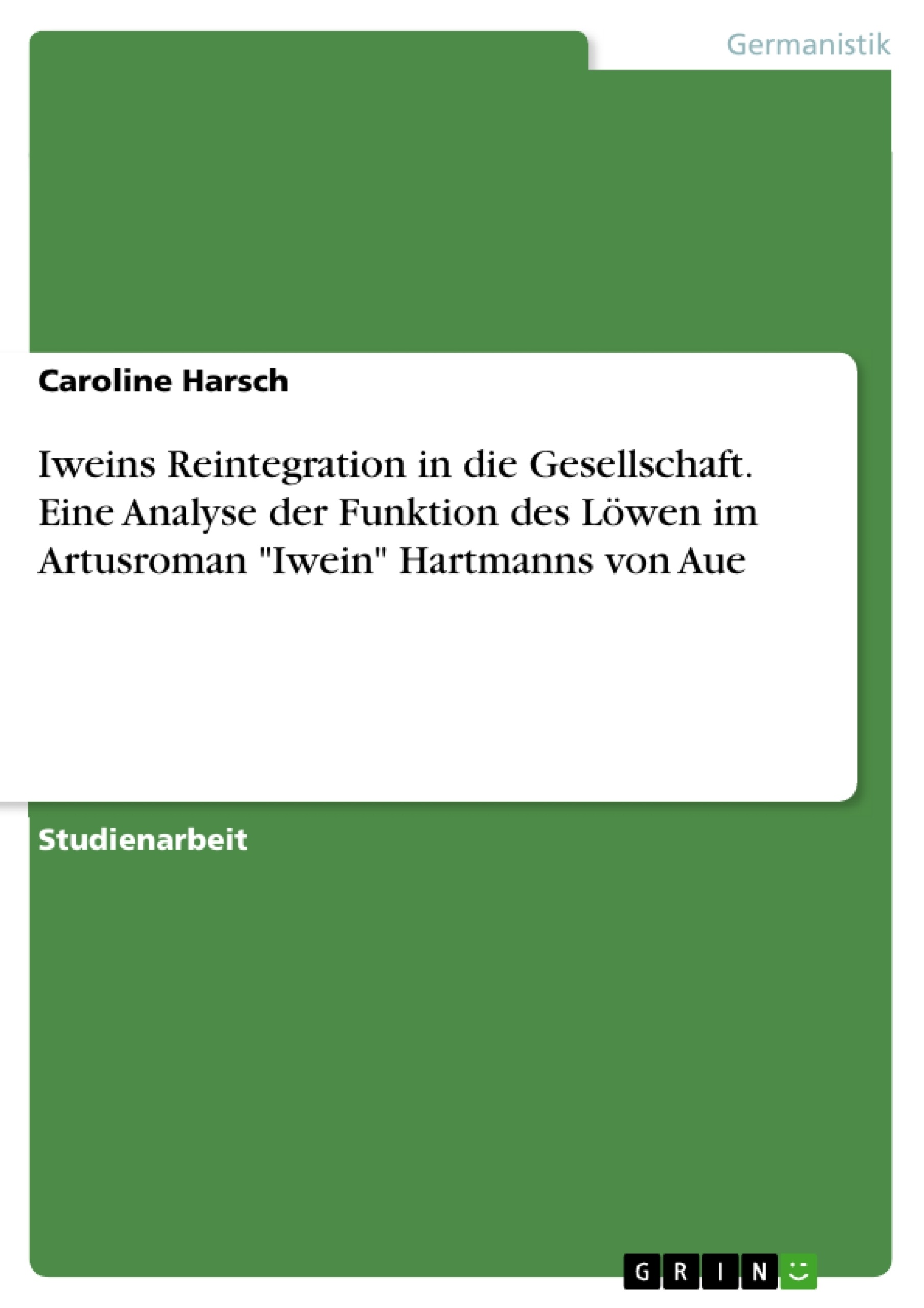Der um 1200 entstandene Artusroman Iwein Hartmanns von Aue gehört noch heute zu den bedeutsamen Lektüren des Mittelalters. Iwein, ein Artusritter, wird von seiner Ehefrau Laudine verstoßen, da er sein Versprechen ihr gegenüber nicht einhält. Als diese alle Verbindungen zu ihm bricht, verliert Iwein nicht nur sein Ansehen, sondern auch seinen Verstand und lebt für einige Zeit als Wahnsinniger im Wald. Der zweite Teil des Romans befasst sich mit seiner Reintegration in die Gesellschaft und dem Wiedererwerb Laudines. Iwein wird in diesem Part die gesamte Zeit von einem Löwen begleitet, welchem er im Kampf mit einem Drachen das Leben rettete und der von diesem Moment an sein Begleiter wird. Gemeinsam bestehen sie mehrere Kämpfe, welche sie nur durch ihre Zusammenarbeit gewinnen können, bis sie schlussendlich wieder an den Artushof zurückkehren und Iwein unwissentlich den letzten Kampf gegen seinen Freund Gawein kämpft.
Hartmann nutzte die altfranzösische Fassung Yvain ou Le Chevalier au lion von Chrétien de Troyes als Vorlage für seinen Roman, welche er allerdings teilweise veränderte und erweiterte. Die vorliegende Arbeit bezieht sich ausschließlich auf die Version Hartmanns. Iweins Beiname rîter mittem leun weist schon auf die immense Bedeutung der Gestalt des Löwen für das Werk hin. Iwein wird einerseits von anderen Figuren als solcher bezeichnet und nennt sich andererseits zum Teil auch selbst so. Der Löwe erfüllt viele für den Protagonisten relevante Funktionen, welche Iweins Rückkehr in die ritterliche Gesellschaft nach seinem Fehlverhalten wieder ermöglichen. Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Beitrag des Löwen zu Iweins Rückkehr. Die konkrete Leitfrage hierzu lautet: Welche Rolle spielt der Löwe bei Iweins Wiedergewinn von triuwe, êre und sælde?
Um den Verlust und Wiedergewinn der Eigenschaften triuwe, êre und sælde analysieren zu können, steht zu Beginn der Arbeit eine Definition ebendieser Begriffe. Anschließend wird erläutert wie Iwein diese Eigenschaften verlor. Das vierte Kapitel widmet sich dem Löwen: Neben der Frage, warum Iwein sich entscheidet den Löwen zu retten, wird auch eine häufig vorkommende Konzeption des Löwen als Christus besprochen. Das anschließende Unterkapitel handelt von der Beziehung zwischen Iwein und dem Löwen und den verschiedenen Etappen zu Iweins Reintegration. Das letzte Kapitel befasst sich einerseits mit den für Iwein relevanten Funktionen des Löwen sowie andererseits mit Iweins Identifikation als Löwenritter.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Triuwe, êre, sælde
- Iweins Verlust
- Der Löwe
- Der Gewinn des Löwen
- Der Löwe an Iweins Seite
- Der Selbstmordversuch des Löwen (I 3877-4010)
- Der Kampf gegen den Riesen Harpin (I 4011-5144)
- Der Kampf für Lunete (I 5145-5437)
- Die Burg zum Schlimmen Abenteuer (I 5578-6794)
- Parallelen der Kämpfe
- Iweins Wiedergewinn
- Vorbild, Mahnung und Ergänzung
- Die Identifikation als Löwenritter
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Rolle des Löwen in Hartmanns von Aues Artusroman "Iwein" und untersucht seinen Beitrag zu Iweins Wiedergewinn von triuwe, êre und sælde. Ziel ist es, die Funktionen des Löwen für Iweins Reintegration in die ritterliche Gesellschaft nach seinem Fehlverhalten zu analysieren.
- Bedeutung der Eigenschaften triuwe, êre und sælde im mittelalterlichen Kontext
- Iweins Verlust von triuwe, êre und sælde durch seinen Bruch des Treueversprechens gegenüber Laudine
- Die Rolle des Löwen als Retter, Begleiter und Symbol für Iweins Wiedergeburt
- Iweins Identifikation als Löwenritter und seine neue Rolle in der Gesellschaft
- Die Darstellung des Löwen als Christusfigur und seine Bedeutung für Iweins moralische und spirituelle Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in den Artusroman "Iwein" von Hartmann von Aue ein und stellt den Protagonisten Iwein und seine Geschichte vor. Die Arbeit fokussiert sich auf Iweins Reintegration in die Gesellschaft und die Rolle des Löwen in diesem Prozess. Die Leitfrage der Arbeit lautet: Welche Rolle spielt der Löwe bei Iweins Wiedergewinn von triuwe, êre und sælde?
- Triuwe, êre, sælde: Dieses Kapitel definiert die mittelalterlichen Begriffe triuwe, êre und sælde und untersucht ihre Bedeutung im Kontext des Werkes. Die Eigenschaften triuwe, êre und sælde sind für die ritterliche Gesellschaft von größter Bedeutung und stellen die Grundlage für ein ehrenvolles und tugendhaftes Leben dar.
- Iweins Verlust: Dieses Kapitel beleuchtet Iweins Verlust von triuwe, êre und sælde, der durch seinen Bruch des Treueversprechens gegenüber Laudine verursacht wird. Iwein gerät in ein moralisches Dilemma und verliert dadurch sein Ansehen in der Gesellschaft.
- Der Löwe: Dieses Kapitel befasst sich mit der Begegnung zwischen Iwein und dem Löwen. Der Löwe wird zum Symbol für Iweins Wiedergeburt und steht für seine moralische und spirituelle Entwicklung. Das Kapitel behandelt auch die christliche Konzeption des Löwen als Christusfigur.
- Iweins Wiedergewinn: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Löwen bei Iweins Wiedergewinn von triuwe, êre und sælde. Der Löwe dient Iwein als Vorbild, Mahnung und Ergänzung. Die Arbeit beleuchtet auch Iweins Identifikation als Löwenritter.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Begriffen triuwe, êre und sælde im Kontext des Artusromans "Iwein". Weitere zentrale Themen sind die Reintegration des Protagonisten Iwein in die ritterliche Gesellschaft, die Rolle des Löwen als Symbol für Iweins moralische und spirituelle Entwicklung sowie die christliche Konzeption des Löwen als Christusfigur. Die Arbeit fokussiert sich auf die Interaktion zwischen Iwein und dem Löwen und deren Bedeutung für Iweins Wiedergewinn von triuwe, êre und sælde.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt der Löwe im Artusroman „Iwein“?
Der Löwe fungiert als treuer Begleiter, Retter und Symbol für Iweins moralische Wiedergeburt. Er hilft Iwein dabei, seine ritterliche Ehre und gesellschaftliche Stellung zurückzugewinnen.
Was bedeuten die Begriffe triuwe, êre und sælde?
Dies sind zentrale ritterliche Tugenden: „triuwe“ steht für Treue, „êre“ für das gesellschaftliche Ansehen und „sælde“ für das durch Gott geschenkte Heil oder Glück.
Warum verliert Iwein seinen Verstand?
Nachdem er ein Versprechen gegenüber seiner Frau Laudine gebrochen hat und von ihr verstoßen wird, verliert er sein Ansehen und verfällt in einen Zustand des Wahnsinns im Wald.
Gibt es eine christliche Deutung des Löwen in Hartmanns Werk?
Ja, in der Forschung wird der Löwe oft als Christusfigur interpretiert, die dem Protagonisten bei seiner spirituellen und moralischen Läuterung zur Seite steht.
Wie erlangt Iwein den Beinamen „Ritter mit dem Löwen“?
Nachdem er den Löwen vor einem Drachen gerettet hat, weicht das Tier nicht mehr von seiner Seite. Diese Identifikation markiert seine neue, geläuterte Rolle in der Gesellschaft.
- Citar trabajo
- Caroline Harsch (Autor), 2013, Iweins Reintegration in die Gesellschaft. Eine Analyse der Funktion des Löwen im Artusroman "Iwein" Hartmanns von Aue, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437821