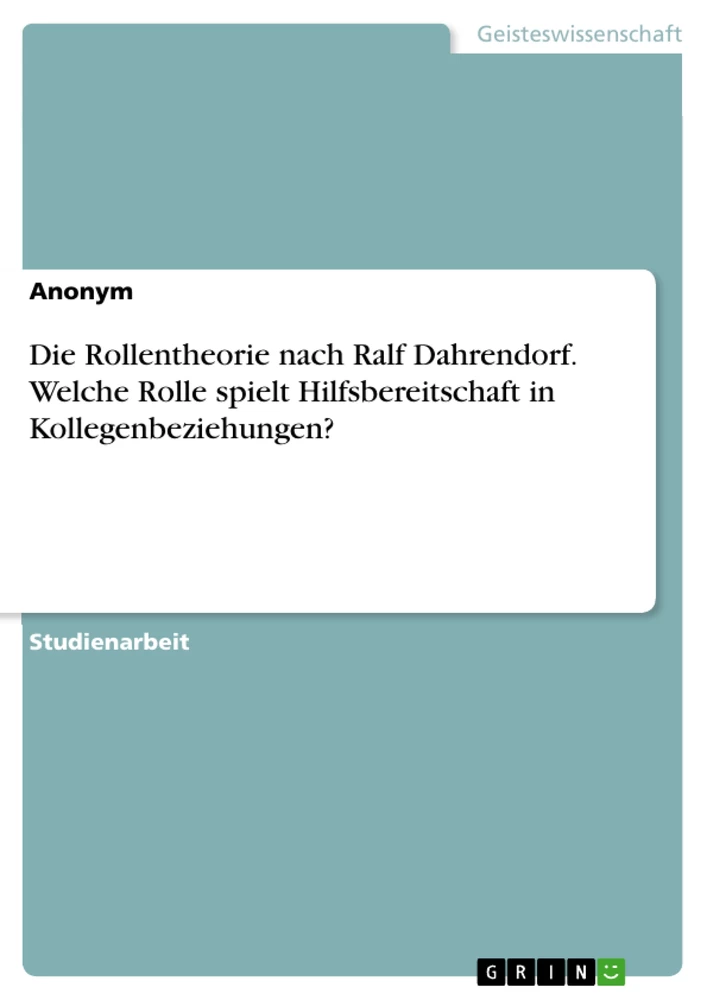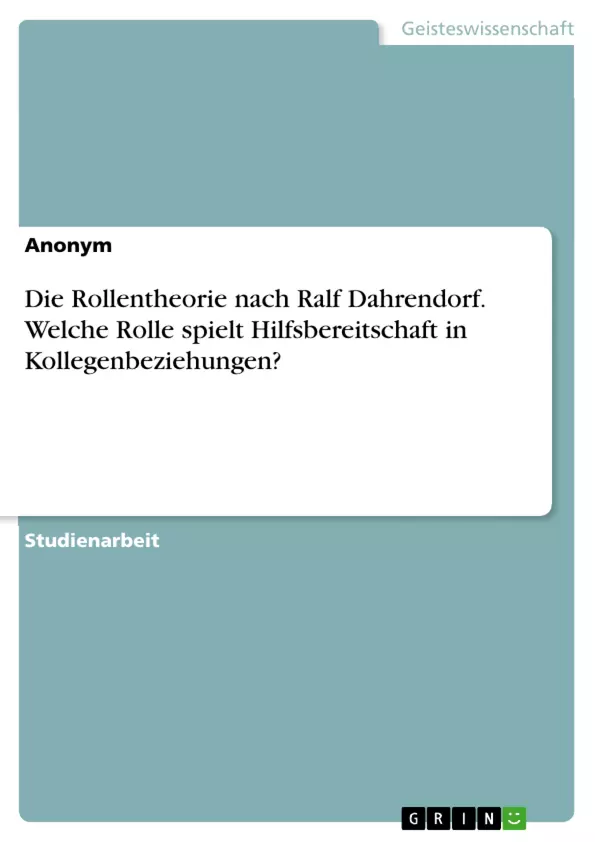In dieser Arbeit soll die empirische Fragestellung beantwortet werden, welche Rolle Hilfsbereitschaft in Kollegenbeziehungen spielt. Ebenso werden die Bedingungen, unter denen Hilfsbereitschaft in Kollegenbeziehungen auftritt analysiert. Es wird untersucht, wie zwei Aspekte des Berufslebens mit der Hilfsbereitschaft zusammenhängen. Diese Aspekte sind die Angewiesenheit der Kollegen untereinander und die Konkurrenzsituation.
In dieser Arbeit wurden Interviews zu Hilfe genommen. Die Hilfsbereitschaft wird untersucht, da viele Interviewpartner über sie berichteten. Zunächst wird ausführlich Dahrendorfs Rollentheorie behandelt und eine Verbindung zur empirischen Fragestellung hergestellt. Anschließend wird das methodische Vorgehen zur empirischen Untersuchung erläutert und die empirischen Befunde dargestellt. Nach einer Interpretation der Ergebnisse wird schließlich ein Ausblick der Rolltheorie gegeben. Zum Schluss folgt eine Zusammenfassung der zentralen Kategorien von Dahrendorfs Theorie und eine empirische Verortung dieser sowie eine Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse.
Inhaltsverzeichnis
- Vorgehensweise und Auswahl der Theorie für die Untersuchung
- Strukturtheoretische Rollentheorie nach Dahrendorf
- Homo Sociologicus
- Soziale Rolle
- Position und Positionsfeld
- Erwartungsarten
- Bezugsgruppen
- Empirische Ergebnisse
- Interpretation der Ergebnisse
- Ausblick und Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, die Rolle von Hilfsbereitschaft in Kollegenbeziehungen zu untersuchen und die Bedingungen zu analysieren, unter denen sie auftritt. Insbesondere werden die Aspekte der gegenseitigen Angewiesenheit und der Konkurrenzsituation im Berufsleben betrachtet.
- Die Rolle der Hilfsbereitschaft in Kollegenbeziehungen
- Der Einfluss von Angewiesenheit auf die Hilfsbereitschaft
- Der Einfluss von Konkurrenzsituationen auf die Hilfsbereitschaft
- Die Anwendung der Rollentheorie von Dahrendorf auf die empirische Fragestellung
- Die Interpretation der empirischen Ergebnisse im Lichte der Rollentheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Vorgehensweise und Auswahl der Theorie für die Untersuchung
Dieses Kapitel erläutert die empirische Fragestellung der Arbeit und die Vorgehensweise zur Beantwortung. Es wird die Relevanz der Hilfsbereitschaft in Kollegenbeziehungen hervorgehoben und die Bedeutung der Aspekte Angewiesenheit und Konkurrenz im Berufsleben betont. Darüber hinaus wird Dahrendorfs Rollentheorie als theoretischer Rahmen für die Untersuchung vorgestellt und die Methode der Interviews als Datenerhebungsinstrument erläutert.
Kapitel 2: Strukturtheoretische Rollentheorie nach Dahrendorf
In diesem Kapitel wird Dahrendorfs Rollentheorie detailliert behandelt. Zuerst wird der homo sociologicus als soziologische Konstruktion vorgestellt, die die Komplexität des menschlichen Verhaltens vereinfacht. Anschließend werden die zentralen Begriffe der Rollentheorie wie die soziale Rolle, Positionen, Erwartungsarten und Bezugsgruppen definiert und erläutert. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Anwendung der Theorie auf das Verhältnis von Kollegen und der Rolle der Hilfsbereitschaft.
Kapitel 3: Empirische Ergebnisse
Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung, die auf Interviews basiert. Hier werden die verschiedenen Aspekte der Hilfsbereitschaft in Kollegenbeziehungen, die Rolle der Angewiesenheit und der Einfluss von Konkurrenzsituationen beleuchtet. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für die Interpretation der Ergebnisse im nächsten Kapitel.
Kapitel 4: Interpretation der Ergebnisse
In diesem Kapitel werden die empirischen Ergebnisse aus Kapitel 3 im Lichte von Dahrendorfs Rollentheorie interpretiert. Es wird analysiert, wie die Ergebnisse die Annahmen und Erkenntnisse der Theorie bestätigen oder widerlegen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Rollentheorie nach Dahrendorf, dem homo sociologicus, der sozialen Rolle, den Verhaltenserwartungen, der Hilfsbereitschaft in Kollegenbeziehungen, der Angewiesenheit, der Konkurrenz, der empirischen Untersuchung und der Interpretation der Ergebnisse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „Homo Sociologicus“ bei Dahrendorf?
Es ist ein theoretisches Modell des Menschen als Träger gesellschaftlich vorgegebener Rollen, dessen Verhalten durch soziale Erwartungen bestimmt wird.
Welche Rolle spielt Hilfsbereitschaft unter Kollegen?
Hilfsbereitschaft ist oft eine informelle Rollenerwartung. Sie tritt besonders dann auf, wenn Kollegen aufeinander angewiesen sind, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Wie beeinflusst Konkurrenz die Hilfsbereitschaft?
In starken Konkurrenzsituationen kann die Hilfsbereitschaft abnehmen, da individuelle Erfolge über den Teamerfolg gestellt werden, was zu Rollenkonflikten führt.
Was versteht Dahrendorf unter einem Positionsfeld?
Ein Positionsfeld umfasst alle sozialen Beziehungen und die damit verbundenen Erwartungen, die auf eine bestimmte Position (z. B. „Kollege“) einwirken.
Welche Erwartungsarten gibt es in der Rollentheorie?
Dahrendorf unterscheidet zwischen Muss-Erwartungen (rechtlich bindend), Soll-Erwartungen (gesellschaftliche Normen) und Kann-Erwartungen (freiwilliges Engagement wie Hilfsbereitschaft).
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2013, Die Rollentheorie nach Ralf Dahrendorf. Welche Rolle spielt Hilfsbereitschaft in Kollegenbeziehungen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437838