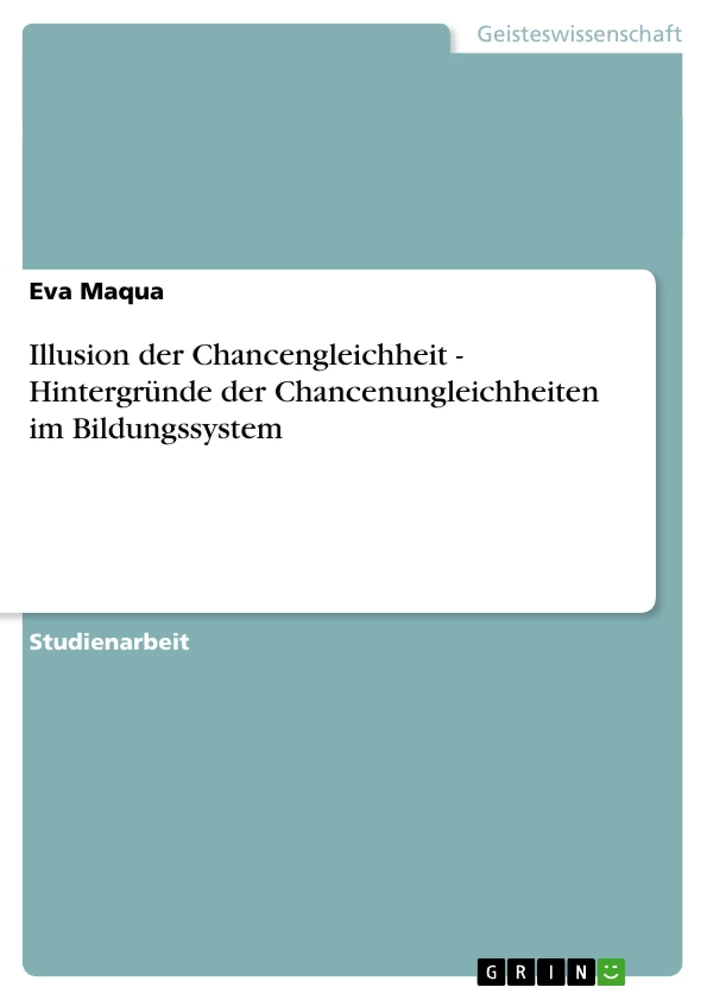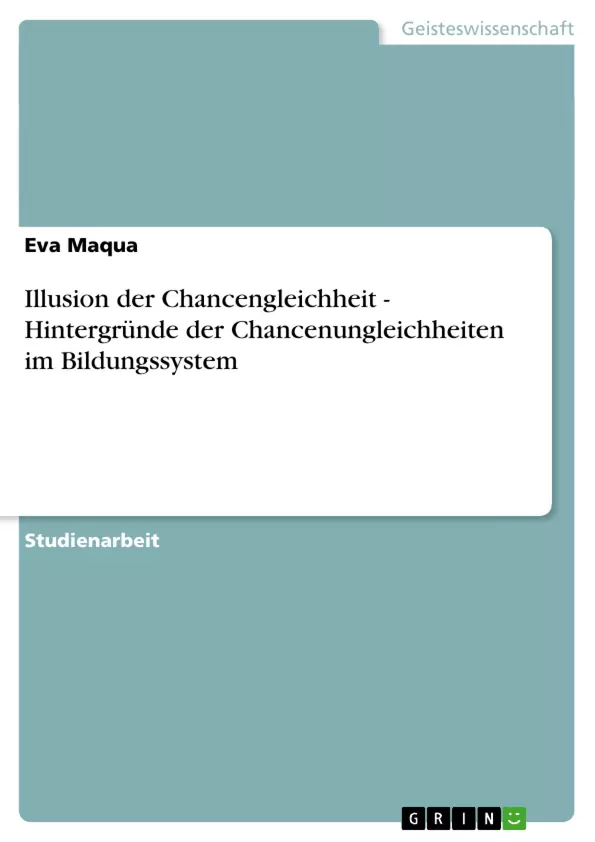Das Bildungswesen ist in den letzten Jahren wieder in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Das Ziel der Verbesserung der Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten ist nur bedingt umgesetzt worden. Wie die aktuellen PISA-Studien zeigen, ist bisher nur formal eine Chancengleichheit zu erkennen. Jeder hat laut der Theorie die Möglichkeit die Schulbildung zu erhalten, zu der er fähig ist. Das Leistungsprinzip scheint also die Grundlage, auf dem das Schulsystem aufbaut. Jeder wird anscheinend nach der erbrachten Leistung bewertet und demnach auch zur Weiterbildung zu gelassen. Das Bildungssystem besitzt zwar in diesem Sinne eine Zuteilungsfunktion, es aber nur formell nach den persönlichen Fähigkeiten beurteilt, die Weichen für ihr weiteres Berufsleben stellen die familiären und sozialen Hinergründe. Die Auswahl nach Schichtzugehörigkeit oder sozialer Situation soll völlig ausgeschlossen werden und jedem Schüler sollte je nach Qualifikation eine Bildungsmöglichkeit zur Verfügung stehen. Dies ist die gesetzmäßig und politisch festgelegte Situation. Allerdings zeigt die genauere Untersuchung des Bildungssystems, dass die Realität ganz anders aussieht und noch weitere Faktoren auf den Bildungsweg Einfluss nehmen. Die soziale Herkunft, das Bildungsniveau der Eltern, die Region, die Religionszugehörigkeit und die soziale Einbindung in der Gesellschaft spielen eben doch eine große Rolle in Bezug auf den Bildungseinstieg. Die PISA-Studie belegt, dass gerade in Deutschland die Auswahlprinzipien im Bildungssystem stark durch den sozialen Status und die vererbten Werte bestimmt werden. Der Begriff der Chancengleichheit ist hierbei nicht mehr tragbar.
Verfolgt man die Entwicklung, ist zu erkennen, dass der Anteil der aus Arbeiterfamilien stammenden Kinder in höheren Bildungsstufen weitaus geringer ist, als der Anteil der Kinder von Freiberuflern oder Führungskräften. An den Universitäten lässt sich dieser Zustand gut verfolgen. Diese Entwicklung wird nicht zufällig entstanden sein und wird auch nicht auf eine geringere naturgegebene Begabung der Arbeiterkinder zurückzuführen sein. Die Gründe, die direkt oder indirekt, den Zugang zur Bildung verwehren oder beeinflussen, sollen in der vorliegenden Arbeit herausgearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Illusion der Chancengleichheit
- Die Auswirkungen der sozialen Klasse auf den Schulerfolg
- Die Ideologie der „befreienden\" Schule und die Legitimation der sozialen Ungleichheit
- Die rationale Pädagogik und die Funktion der Schule
- Die Unterrichtssprache
- Exzellenz und Werte im französischen Unterrichtssystem
- Widersprüche im schulischen Wertesystem
- Das kulturelle Kapital und die kulturelle Praxis
- Die Übertragung von kulturellem Kapital
- Die drei Formen des kulturellen Kapitals
- Die Auswirkungen des kulturellen Kapitals in der Hochschule
- Der Habitus
- Die Krise des Bildungssystems
- Vorschläge für das Bildungswesen der Zukunft
- Grundsätze zur Reflexion der Unterrichtsinhalte
- Bildungsexpansion oder Bildungsinflation
- Bildungsexpansion als horizontaler Prozess
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Ursachen für Chancenungleichheiten im Bildungssystem, indem sie sich auf Pierre Bourdieus Theorien und Studien konzentriert. Ziel ist es, die Mechanismen zu analysieren, die die soziale Ungleichheit im Bildungssystem aufrechterhalten, und mögliche Lösungen für eine gerechtere Bildungslandschaft aufzuzeigen.
- Die Illusion der Chancengleichheit im Bildungssystem
- Der Einfluss des kulturellen Kapitals auf den Bildungserfolg
- Die Rolle des Habitus in der Reproduktion sozialer Ungleichheit
- Die Kritik am bestehenden Bildungssystem und mögliche Reformen
- Die Folgen von Bildungsexpansion und -inflation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den aktuellen Stand der Diskussion über die Chancengleichheit im Bildungssystem dar und führt in die Problematik der sozialen Ungleichheit ein. Im zweiten Kapitel wird die Illusion der Chancengleichheit im Bildungssystem thematisiert. Kapitel 3 beleuchtet den Einfluss der sozialen Klasse auf den Schulerfolg. Das vierte Kapitel untersucht die Ideologie der „befreienden“ Schule und ihre Funktion in der Legitimation der sozialen Ungleichheit, wobei die rationale Pädagogik, die Unterrichtssprache und die Widersprüche im schulischen Wertesystem betrachtet werden. Im fünften Kapitel werden das kulturelle Kapital und seine drei Formen sowie die Auswirkungen des kulturellen Kapitals auf die Hochschule behandelt. Kapitel 6 widmet sich dem Habitus und seiner Rolle in der Bildungsentwicklung. In Kapitel 7 werden die Herausforderungen und die Krise des Bildungssystems dargestellt. Die Arbeit schliesst mit Vorschlägen für das Bildungswesen der Zukunft und einer Analyse der Folgen von Bildungsexpansion und -inflation.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit behandelt die Themen Chancengleichheit, soziale Ungleichheit, Bildungssystem, kulturelles Kapital, Habitus, Bildungsinflation, Bildungsexpansion, Pierre Bourdieu, rationale Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird von einer „Illusion der Chancengleichheit“ gesprochen?
Weil das Bildungssystem formal zwar jedem offensteht, der tatsächliche Erfolg aber stark von der sozialen Herkunft und dem familiären Hintergrund abhängt.
Was versteht Pierre Bourdieu unter „kulturellem Kapital“?
Kulturelles Kapital umfasst Bildung, Wissen und kulturelle Güter, die innerhalb der Familie vererbt werden und den Schulerfolg maßgeblich beeinflussen.
Welche Rolle spielt der „Habitus“ im Bildungssystem?
Der Habitus ist ein System von Denk- und Verhaltensmustern, das Schüler aus ihrem sozialen Umfeld mitbringen und das darüber entscheidet, wie gut sie sich im schulischen Umfeld zurechtfinden.
Was ist der Unterschied zwischen Bildungsexpansion und Bildungsinflation?
Bildungsexpansion bezeichnet die Zunahme höherer Bildungsabschlüsse; Bildungsinflation beschreibt den Wertverlust dieser Abschlüsse auf dem Arbeitsmarkt durch ihr Überangebot.
Welchen Einfluss hat die soziale Klasse auf den Schulerfolg?
Kinder aus Akademikerfamilien haben statistisch gesehen eine deutlich höhere Chance auf das Gymnasium oder die Universität zu gelangen als Kinder aus Arbeiterfamilien.
- Arbeit zitieren
- Eva Maqua (Autor:in), 2005, Illusion der Chancengleichheit - Hintergründe der Chancenungleichheiten im Bildungssystem, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43828