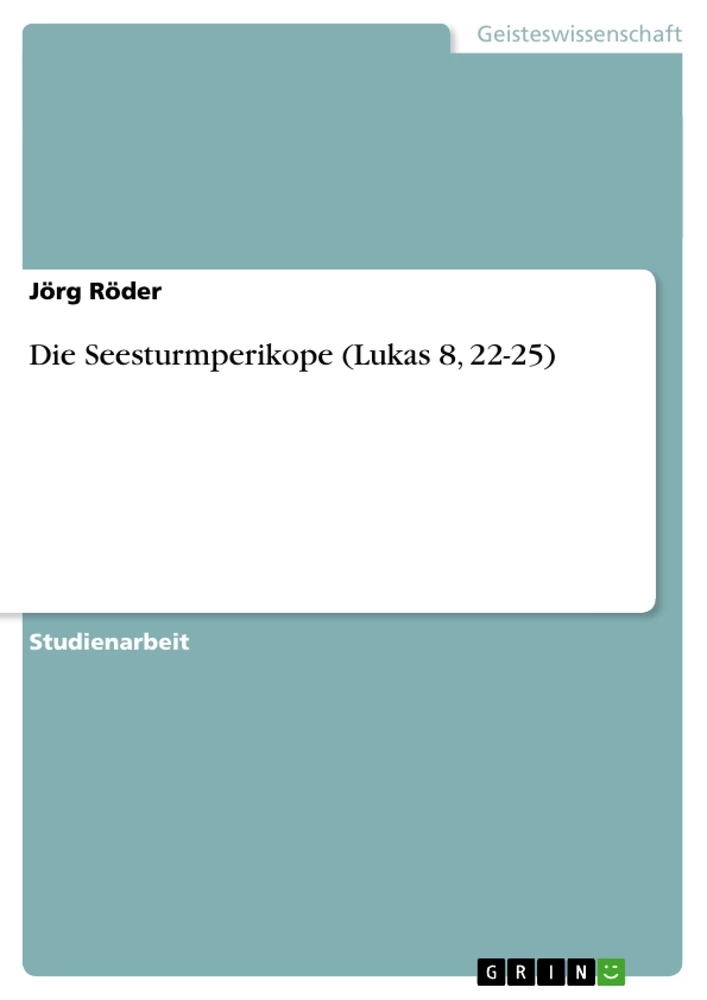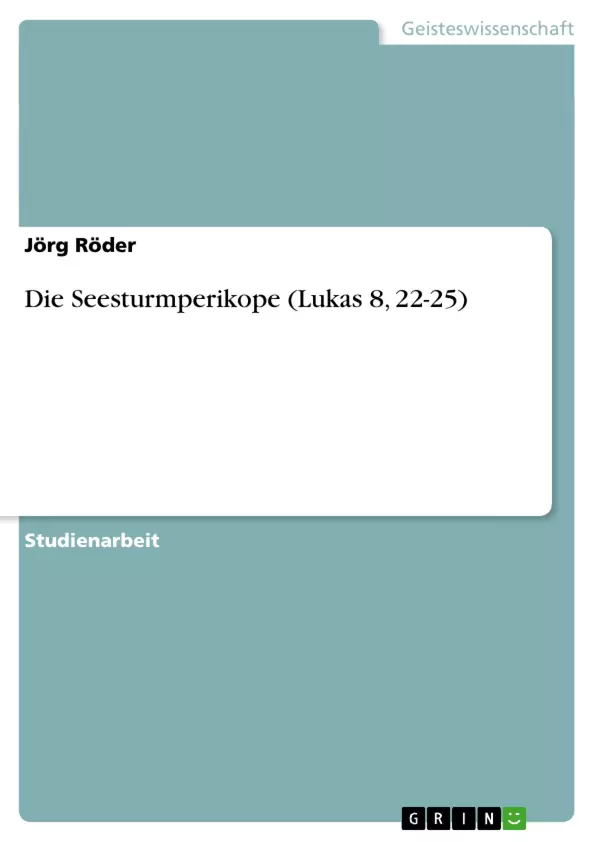In der vorliegenden Arbeit wird die Seesturmerzählung Lk 8,22-25 exegetisch untersucht. Der Übersetzung folgt eine textkritische Untersuchung, in der ausgewählte Stellen des Lukastextes auf ihre Ursprünglichkeit hin überprüft werden. Die Textanalyse geht synchron auf erste sprachliche und stilistische Besonderheiten der vorliegenden Fassung ein, um auf diesem Weg bereits erste Schlüsse bezüglich der Aussageabsicht des Autors ziehen zu können. Außerdem wird hier die Perikope hinsichtlich ihrer Stellung und Funktion im weiteren und engeren Kontext des Evangeliums beleuchtet. Die sich anschließende Literarkritik geht nun diachron vor und untersucht die Abhängigkeitsverhältnisse, die zwischen den entsprechenden Seesturmerzählungen bei Matthäus, Markus und Lukas bestehen. Ist eine solche Abhängigkeit innerhalb der Synoptiker für diese Perikope feststellbar, wird im ersten Schritt der Formgeschichte die ursprüngliche Fassung hinsichtlich der vorgenommenen Redaktion beleuchtet. Alle redaktionellen Eingriffe werden von der Erzählung abgetrennt. Die verbleibende Form der Erzählung wird als vorsynoptisch angenommen, wobei im folgenden versucht wird, sie einer Gattung zuzuordnen und sie bezüglich ihrer soziologischen Funktion zu analysieren. Da der religionsgeschichtliche Vergleich sich in einem zentralen Aspekt direkt auf Ergebnisse der formgeschichtlichen Untersuchung bezieht, wird dieser Abschnitt unmittelbar nach Abschnitt „Formgeschichte“ eingefügt. Er beschäftigt sich mit etwaigen Parallelen der Erzählung von der Sturmstillung in anderen Traditionen, wie der jüdischen oder paganen Antike. Im Abschnitt „Motivgeschichte“ wird ein zentrales Motiv aus der Erzählung herausgegriffen und in bezug auf seine veränderte Bedeutung in verschiedenen Traditionen und Zusammenhängen hin analysiert. Die Redaktionsgeschichte kehrt wieder zum Ausgangstext zurück und thematisiert auf Grundlage der diachronen Untersuchung und unter Zurhilfenahme der textanalytischen Erkenntnisse die redaktionellen Eingriffe des Lukas und geht auf spezielle inhaltliche und theologische Intentionen des Evangelisten ein.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Übersetzung
- III. Textkritik
- 1.) Darstellung und Beurteilung der äußeren Kriterien
- 2.) Beurteilung anhand innerer Kriterien
- 3.) Gesamturteil
- IV. Textanalyse
- V. Literarkritik
- VI. Formgeschichte
- VII. Religionsgeschichtlicher Vergleich
- VIII. Motivgeschichte
- IX. Redaktionsgeschichte
- X. Hermeneutische Überlegungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
In dieser Arbeit wird die Seesturmerzählung in Lukas 8,22-25 exegetisch untersucht. Die Analyse befasst sich mit verschiedenen Aspekten der Perikope, von der textkritischen Überprüfung bis hin zu literarkritischen und formgeschichtlichen Betrachtungen.
- Textkritik: Untersuchung der Ursprünglichkeit des Lukastextes
- Textanalyse: Analyse der sprachlichen und stilistischen Besonderheiten
- Literarkritik: Untersuchung der Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Seesturmerzählungen in den Synoptikern
- Formgeschichte: Analyse der ursprünglichen Fassung der Erzählung und ihrer soziologischen Funktion
- Religionsgeschichtlicher Vergleich: Parallelen zur Erzählung in anderen Traditionen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt die Seesturmperikope (Lukas 8,22-25) als Gegenstand der exegetischen Untersuchung vor und gibt einen Überblick über die einzelnen Abschnitte der Arbeit.
II. Übersetzung
Dieser Abschnitt präsentiert die Übersetzung des Lukastextes der Seesturmerzählung.
III. Textkritik
Die Textkritik beschäftigt sich mit der Beurteilung verschiedener Lesarten im Lukastext, anhand der äußeren und inneren Kriterien. Die Analyse bewertet die einzelnen Lesarten und identifiziert die wahrscheinlichste ursprüngliche Lesart.
IV. Textanalyse
Die Textanalyse befasst sich mit der sprachlichen und stilistischen Besonderheiten der vorliegenden Fassung der Seesturmerzählung, um erste Schlüsse bezüglich der Aussageabsicht des Autors zu ziehen.
V. Literarkritik
Die Literarkritik untersucht die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Seesturmerzählungen in Matthäus, Markus und Lukas.
VI. Formgeschichte
Die Formgeschichte beleuchtet die ursprüngliche Fassung der Seesturmerzählung, die durch die Redaktionen der Synoptiker verändert wurde. Sie analysiert die soziologische Funktion der ursprünglichen Form der Erzählung.
VII. Religionsgeschichtlicher Vergleich
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit etwaigen Parallelen der Seesturmerzählung in anderen Traditionen, wie der jüdischen oder paganen Antike.
VIII. Motivgeschichte
Die Motivgeschichte analysiert ein zentrales Motiv aus der Seesturmerzählung und seine veränderte Bedeutung in verschiedenen Traditionen und Kontexten.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die Seesturmperikope in Lukas 8,22-25, textkritische Analyse, literarkritische Untersuchung, Formgeschichte, religionsgeschichtlicher Vergleich, Motivgeschichte und Redaktionsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Seesturmperikope (Lukas 8, 22-25)?
Es handelt sich um die Erzählung der Sturmstillung durch Jesus, die in dieser Arbeit exegetisch untersucht wird.
Was ist das Ziel der textkritischen Untersuchung?
Die Textkritik prüft verschiedene Lesarten des Lukastextes auf ihre Ursprünglichkeit, um der Fassung, die der Autor vermutlich verfasste, am nächsten zu kommen.
Wie unterscheiden sich die Seesturmerzählungen bei den Synoptikern?
Die Literarkritik analysiert die Abhängigkeiten zwischen Matthäus, Markus und Lukas und zeigt auf, welche redaktionellen Änderungen Lukas vorgenommen hat.
Gibt es Parallelen in der paganen Antike?
Der religionsgeschichtliche Vergleich untersucht ähnliche Motive von Sturmstillungen in jüdischen und paganen Traditionen der Antike.
Welche theologische Intention verfolgt Lukas mit dieser Erzählung?
Durch die Redaktionsgeschichte wird deutlich, wie Lukas die Erzählung nutzt, um die Macht Jesu über die Chaosmächte und die Bedeutung des Glaubens hervorzuheben.
- Quote paper
- Jörg Röder (Author), 2004, Die Seesturmperikope (Lukas 8, 22-25), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43855