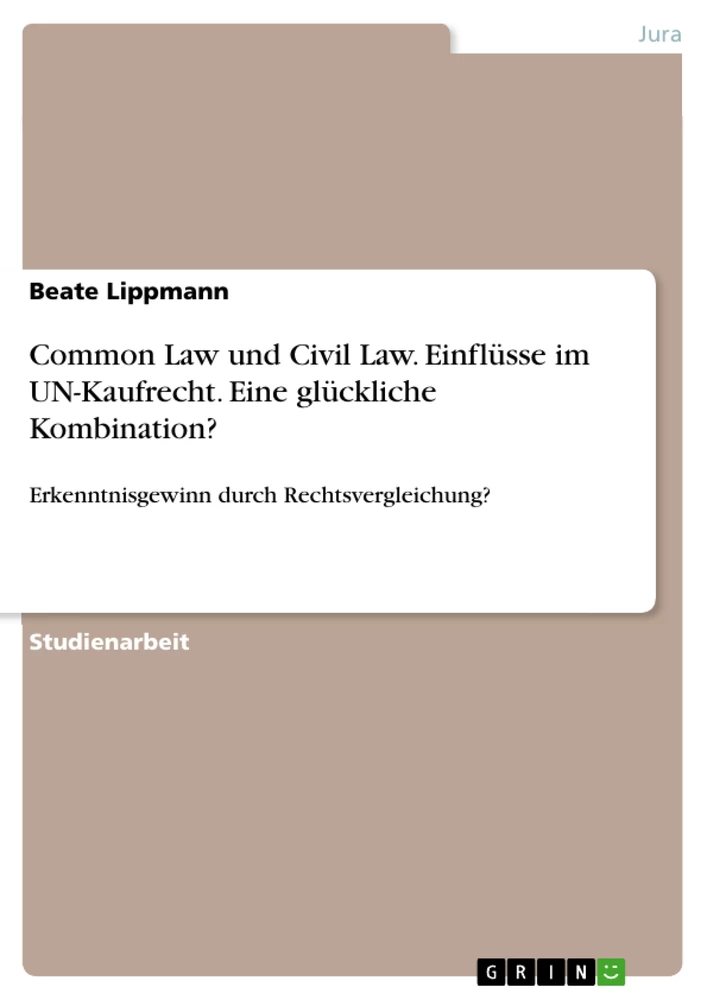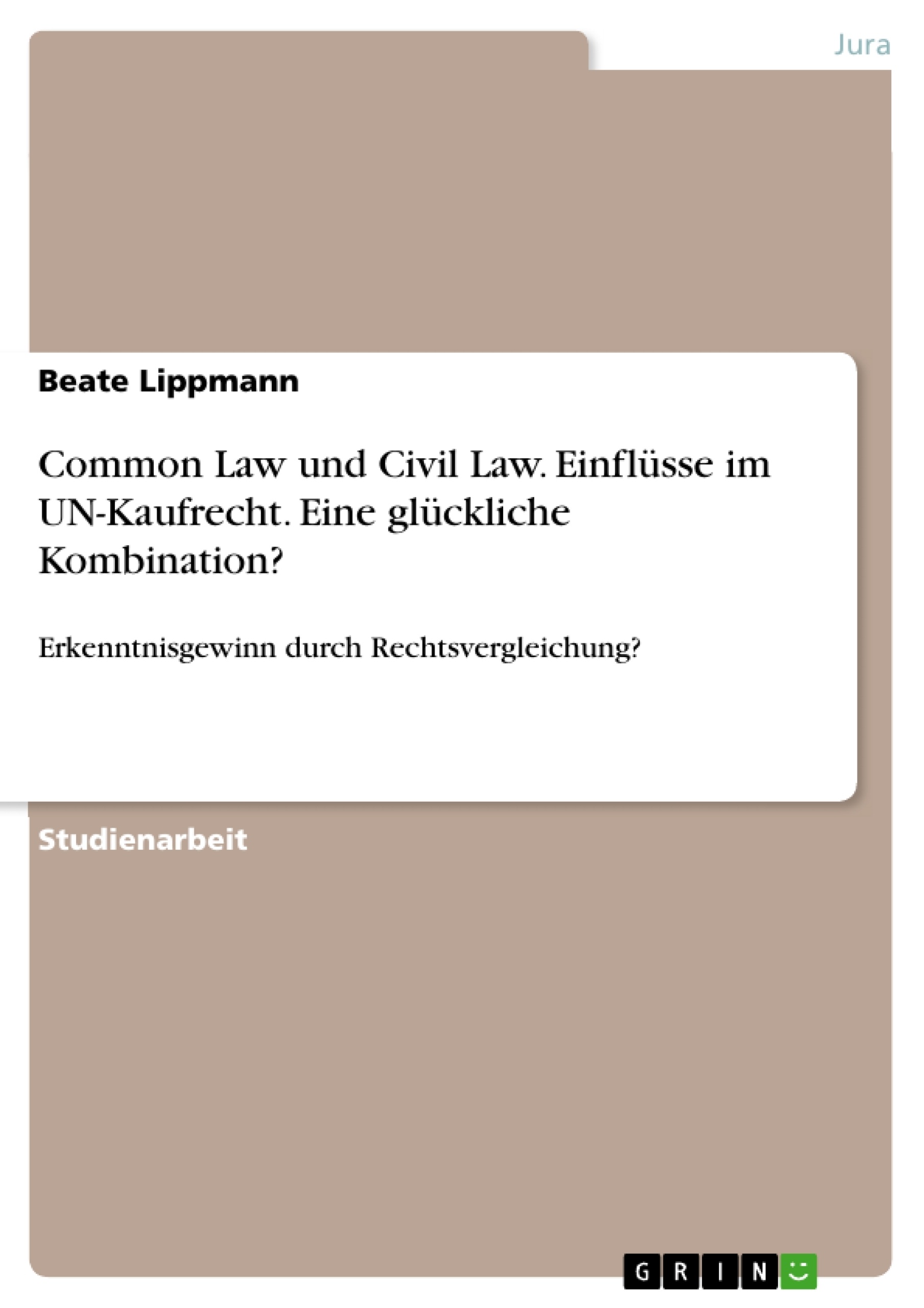Das zum 1. Januar 1991 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getretene Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 nimmt die „besondere Herausforderung“ an, als internationales Einheitsrecht zu funktionieren. Hervorgerufen durch das Bedürfnis nach mehr Rechtssicherheit im internationalen Warenverkehr bildet nunmehr das UN-Kaufrecht den Knotenpunkt einer langen Episode der Rechtsvereinheitlichung. Durch die Mitwirkung etlicher Nationen an der Ausgestaltung des CISG prallten die verschiedenen Rechtssysteme, vor allem die der kontinentaleuropäischen (Civil Law) und angloamerikanischen Länder (Common Law), aufeinander. Da sich das Common Law und Civil Law erheblich unterscheiden, musste sich – wenn sie sich zwar auch im Wege der Globalisierung zwangsweise immer stärker annäherten – um einen Ausgleich der noch bestehenden Gegensätze bemüht werden. Das UN-Kaufrecht stellt demnach eine Kompromisslösung dar, die die unterschiedlichen Interessen der jeweiligen Rechtssysteme in sich beherbergt, wobei dies mit besonderer Note in einzelnen Normen zum Ausdruck kommt. Ob demzufolge Rabel mit seiner Aussage „Common Law and Civil Law are like oil and water, which do not mix” richtig liegt, soll auf den nachfolgenden Seiten anhand ausgewählter Beispiele einer kritischen Analyse unterzogen werden. Als Türöffner dient der Makrovergleich beider Rechtstraditionen, der mit gebotener Kürze die wesentlichen Merkmale der Systeme sowie deren historischen Hintergrund aufzeigen soll. Auf dieser Grundlage werden sodann mustergültige Normen des CISG auf ihre Common Law und Civil Law –Einflüsse hin untersucht, um letztlich auch auf die Frage nach einer „glücklichen Kombination“ der divergierenden Einflüsse replizieren zu können.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Wesentliche Merkmale und historischer Hintergrund
- 1. Civil Law
- 2. Common Law
- III. Zentrale Unterschiede und stilprägende Faktoren
- 1. Rechtsquellen: Gesetz vs. Richterrecht
- 2. Verfahrensrecht und materielles Recht
- 3. Trennung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht
- IV. Common Law und Civil Law-Einflüsse im UN Kaufrecht
- 1. Beispiel: Der Anspruch auf Erfüllung in Natur
- a) Civil Law
- b) Common Law
- c) Regelung des CISG
- 2. Beispiel: Die Widerruflichkeit des Angebots und das Wirksamwerden der Annahme
- a) Civil Law
- aa) Die Widerruflichkeit des Angebots
- bb) Das Wirksamwerden der Annahme
- b) Common Law
- aa) Die Widerruflichkeit des Angebots
- bb) Das Wirksamwerden der Annahme
- c) Regelung des CISG
- aa) Die Widerruflichkeit des Angebots
- bb) Das Wirksamwerden der Annahme
- a) Civil Law
- 3. Beispiel: Die Vertragsänderung oder -anpassung
- a) Civil Law
- b) Common Law
- c) Regelung des CISG
- 4. Zusammenfassung weiterer Einflüsse im UN-Kaufrecht
- 1. Beispiel: Der Anspruch auf Erfüllung in Natur
- V. Auswertung und abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Einflüsse von Common Law und Civil Law auf das UN-Kaufrecht (CISG). Ziel ist es, die Wechselwirkungen beider Rechtstraditionen im CISG zu analysieren und deren Auswirkungen auf konkrete Rechtsfragen zu beleuchten. Die Arbeit befasst sich dabei nicht mit der Feststellung einer „glücklichen Kombination“, sondern untersucht die Interaktion beider Systeme kritisch.
- Vergleich der Rechtsquellen und Methoden von Civil Law und Common Law
- Analyse zentraler Unterschiede im Verfahrens- und Materiellen Recht
- Untersuchung der Integration von Common Law und Civil Law Prinzipien im CISG
- Detaillierte Betrachtung ausgewählter Beispiele aus dem CISG
- Bewertung der Auswirkung der Rechtstraditionen auf die Auslegung und Anwendung des CISG
Zusammenfassung der Kapitel
II. Wesentliche Merkmale und historischer Hintergrund: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für den Rechtsvergleich zwischen Civil Law und Common Law. Es beschreibt die wesentlichen Merkmale beider Rechtssysteme, ihre historischen Entwicklungen und die daraus resultierenden Unterschiede in der Rechtsfindung und Rechtsanwendung. Es werden die unterschiedlichen Rechtsquellen, die Rolle der Judikative und die Struktur der Rechtssysteme beleuchtet, um den Leser auf die anschließende Analyse der Einflüsse auf das UN-Kaufrecht vorzubereiten. Der historische Kontext liefert entscheidende Einblicke in die Prinzipien und Denkweisen der jeweiligen Systeme.
III. Zentrale Unterschiede und stilprägende Faktoren: Dieses Kapitel vertieft den Vergleich der beiden Rechtstraditionen, indem es sich mit zentralen Unterschieden in Bezug auf Rechtsquellen (Gesetz vs. Richterrecht), Verfahrensrecht und materiellem Recht sowie der Trennung von öffentlichem und privatem Recht auseinandersetzt. Es werden die stilprägenden Faktoren beider Systeme analysiert und deren Auswirkungen auf die Rechtsprechung und Rechtsentwicklung herausgearbeitet. Der Fokus liegt auf denjenigen Aspekten, die für das Verständnis der Interaktion von Common Law und Civil Law im UN-Kaufrecht relevant sind.
IV. Common Law und Civil Law-Einflüsse im UN Kaufrecht: Der Kern der Arbeit liegt in diesem Kapitel. Es analysiert anhand konkreter Beispiele aus dem UN-Kaufrecht (CISG), wie Prinzipien des Common Law und des Civil Law in diesem internationalen Vertragssystem zusammenwirken. Die ausgewählten Beispiele (Anspruch auf Erfüllung, Widerruflichkeit des Angebots, Vertragsänderung) dienen als Fallstudien, die die komplexen Interaktionen zwischen den beiden Rechtstraditionen veranschaulichen. Durch die detaillierte Betrachtung der jeweiligen Regelungen im Civil Law, Common Law und im CISG selbst, wird die Problematik der Rechtsvereinheitlichung auf internationaler Ebene deutlich.
Schlüsselwörter
Civil Law, Common Law, UN-Kaufrecht (CISG), Rechtsvergleichung, Rechtsquellen, Richterrecht, Gesetzesrecht, Verfahrensrecht, Materielles Recht, Vertragsrecht, Rechtsvereinheitlichung, Internationale Rechtsordnung, Vertragsauslegung, Erfüllung, Widerruf, Vertragsänderung.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Einflüsse von Common Law und Civil Law auf das UN-Kaufrecht
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument analysiert die Einflüsse von Common Law und Civil Law auf das UN-Kaufrecht (CISG). Es untersucht die Wechselwirkungen beider Rechtstraditionen im CISG und deren Auswirkungen auf konkrete Rechtsfragen. Der Fokus liegt nicht auf der Feststellung einer idealen Kombination, sondern auf der kritischen Untersuchung der Interaktion beider Systeme.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Vergleich der Rechtsquellen und Methoden von Civil Law und Common Law, Analyse zentraler Unterschiede im Verfahrens- und Materiellen Recht, Untersuchung der Integration von Common Law und Civil Law Prinzipien im CISG, detaillierte Betrachtung ausgewählter Beispiele aus dem CISG und Bewertung der Auswirkung der Rechtstraditionen auf die Auslegung und Anwendung des CISG.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Wesentliche Merkmale und historischer Hintergrund (inkl. Civil Law und Common Law), Zentrale Unterschiede und stilprägende Faktoren (inkl. Rechtsquellen, Verfahrensrecht, Materielles Recht und Trennung öffentliches/privates Recht), Common Law und Civil Law-Einflüsse im UN Kaufrecht (inkl. detaillierter Fallstudien zu Anspruch auf Erfüllung, Widerruflichkeit des Angebots und Vertragsänderung) und Auswertung und abschließende Betrachtung.
Welche Fallbeispiele werden im Detail untersucht?
Im Kapitel IV werden anhand von Fallstudien die Einflüsse von Common Law und Civil Law auf das UN-Kaufrecht veranschaulicht. Konkrete Beispiele sind der Anspruch auf Erfüllung in Natur, die Widerruflichkeit des Angebots und das Wirksamwerden der Annahme, sowie die Vertragsänderung oder -anpassung. Jedes Beispiel wird aus der Perspektive des Civil Law, des Common Law und der Regelung des CISG analysiert.
Welche Schlüsselwörter sind für das Verständnis des Dokuments relevant?
Die Schlüsselwörter sind: Civil Law, Common Law, UN-Kaufrecht (CISG), Rechtsvergleichung, Rechtsquellen, Richterrecht, Gesetzesrecht, Verfahrensrecht, Materielles Recht, Vertragsrecht, Rechtsvereinheitlichung, Internationale Rechtsordnung, Vertragsauslegung, Erfüllung, Widerruf, Vertragsänderung.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Ziel des Dokuments ist die Analyse der Wechselwirkungen zwischen Common Law und Civil Law im Kontext des UN-Kaufrechts (CISG) und die Beleuchtung der Auswirkungen dieser Interaktion auf konkrete Rechtsfragen. Es wird eine kritische Auseinandersetzung mit der Interaktion beider Rechtssysteme angestrebt.
Wie werden die Unterschiede zwischen Civil Law und Common Law dargestellt?
Die Unterschiede zwischen Civil Law und Common Law werden anhand ihrer Rechtsquellen (Gesetz vs. Richterrecht), des Verfahrensrechts, des materiellen Rechts und der Trennung von öffentlichem und privatem Recht herausgearbeitet. Der historische Hintergrund beider Systeme und deren stilprägende Faktoren werden ebenfalls berücksichtigt.
Wie werden die Kapitel zusammengefasst?
Das Dokument bietet zusammenfassende Beschreibungen der einzelnen Kapitel. Diese Zusammenfassungen erläutern den Inhalt und die Zielsetzung jedes Kapitels und betonen die Relevanz für das Gesamtverständnis der Interaktion von Common Law und Civil Law im UN-Kaufrecht.
- Arbeit zitieren
- Beate Lippmann (Autor:in), 2011, Common Law und Civil Law. Einflüsse im UN-Kaufrecht. Eine glückliche Kombination?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/438668