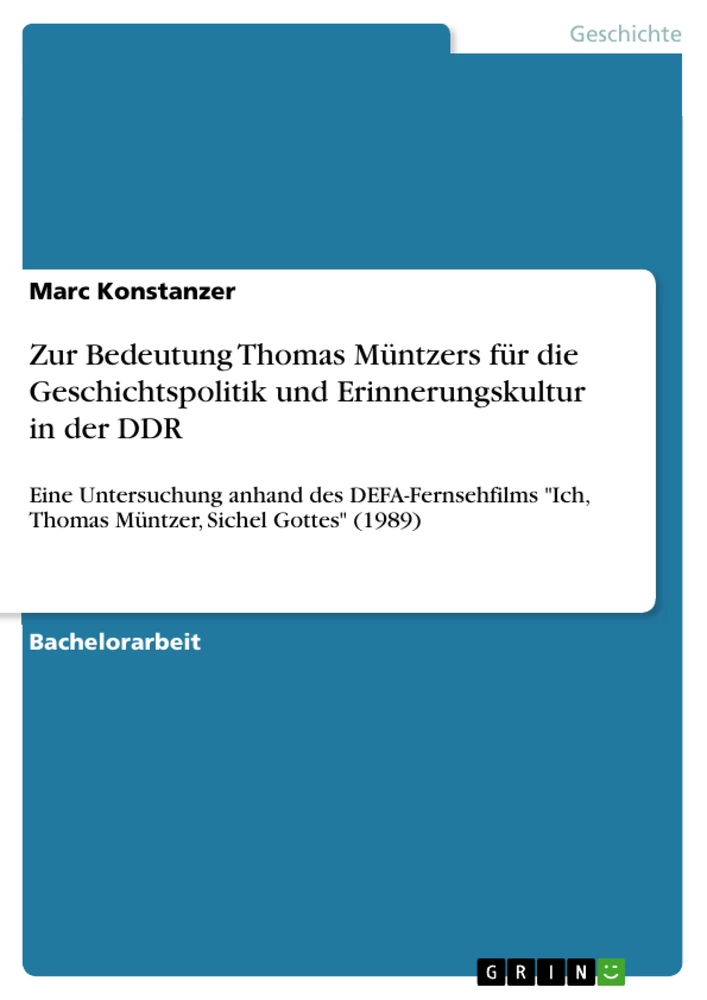Das Ziel in dieser Arbeit ist es, einen genauen Blick auf das diffuse Müntzerbild in den letzten Jahren der DDR zu werfen. Hierfür soll anhand einer Analyse des Fernsehfilms Ich, Thomas Müntzer, Sichel Gottes aus dem Jahr 1989 die Frage beantwortet werden, inwiefern das Medium Film, das in der DDR seit der Staatsgründung als äußerst relevantes Hilfsmittel für die Vermittlung eines neuen Geschichtsverständnisses angesehen wurde, den veränderten Stand der Müntzerforschung abbildet oder – wie in zahlreichen anderen Müntzerdarstellungen aus dem Jubiläumsjahr 1989 geschehen – ignoriert. Außerdem wird, ausgehend von der Prämisse, dass fiktionale Geschichtsdarstellungen mit Authentizitätsanspruch mehr über die Geschichte ihrer Produktion als über ihren historischen Gegenstand aussagen1, nach den gesellschaftlichen Normen, Werten und Haltungen gefragt, die der, in Zeiten gesellschaftlicher und politischer Instabilität entstandene, Fernsehfilm transportiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Forschungsstand
- 1.2 Historisch-politischer Kontext
- 1.3 Forschungsfrage
- 2. Analyse des DEFA-Fernsehfilms Ich, Thomas Müntzer, Sichel Gottes
- 2.1 Das Konzept der frühbürgerlichen Revolution in den 1970er Jahren
- 2.1.2 Das Luther-Jubiläum 1983 im Zeichen von Erbe und Tradition
- 2.1.3 Das Müntzer-Jubiläum 1989 im Zeichen der friedlichen Revolution
- 2.2 Produktionsbedingungen
- 2.3 Inhaltsangabe und Szenenanalyse
- 2.3.1 Inhaltsangabe
- 2.3.2 Anfangsszene [00:00:00-00:01:40]
- 2.3.3 Disputation zwischen Müntzer und Spalatin [00:48:39-00:52:29]
- 2.3.4 Fürstenpredigt [01:48:20-01:54:16]
- 2.4 Rezeption
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung Thomas Müntzers für die Geschichtspolitik und Erinnerungskultur der DDR. Der Fokus liegt auf der Analyse des DEFA-Fernsehfilms „Ich, Thomas Müntzer, Sichel Gottes“ aus dem Jahr 1989, welcher im Kontext der friedlichen Revolution entstanden ist.
- Rezeption Thomas Müntzers in der DDR
- Geschichtspolitik und Erinnerungskultur der DDR
- Analyse des DEFA-Films „Ich, Thomas Müntzer, Sichel Gottes“
- Die Rolle von Thomas Müntzer in der deutschen Geschichte
- Der Zusammenhang zwischen Geschichte und politischer Propaganda
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Forschungsstand zur Rezeption von Thomas Müntzer dar und führt in den historisch-politischen Kontext ein. Die Analyse des DEFA-Films „Ich, Thomas Müntzer, Sichel Gottes“ konzentriert sich auf das Konzept der frühbürgerlichen Revolution in den 1970er Jahren, das Luther-Jubiläum 1983 und das Müntzer-Jubiläum 1989. Die Produktionsbedingungen des Films werden ebenso beleuchtet wie die Inhaltsangabe und Szenenanalyse. Abschließend werden die Rezeption des Films sowie das Fazit der Arbeit präsentiert.
Schlüsselwörter
Thomas Müntzer, DEFA-Film, „Ich, Thomas Müntzer, Sichel Gottes“, Geschichtspolitik, Erinnerungskultur, DDR, frühbürgerliche Revolution, Luther-Jubiläum, Müntzer-Jubiläum, friedliche Revolution, Produktionsbedingungen, Inhaltsanalyse, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen
Welches Bild von Thomas Müntzer wurde in der Spätphase der DDR vermittelt?
Die Arbeit untersucht, wie sich das Bild vom „Revolutionär“ Müntzer im Jubiläumsjahr 1989 im Vergleich zu früheren Jahren wandelte und ob neue Forschungsergebnisse einflossen.
Worum geht es im Film „Ich, Thomas Müntzer, Sichel Gottes“?
Der DEFA-Fernsehfilm von 1989 stellt das Leben und Wirken Müntzers dar und spiegelt dabei auch die gesellschaftliche Instabilität der DDR-Endphase wider.
Was ist das Konzept der „frühbürgerlichen Revolution“?
Es war ein zentrales Geschichtsverständnis der DDR, das die Reformation und den Bauernkrieg als erste Stufe des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus deutete.
Wie unterschieden sich das Luther- (1983) und das Müntzer-Jubiläum (1989)?
Während Luther 1983 stärker in die nationale Tradition integriert wurde, stand Müntzer 1989 im Zeichen der herannahenden friedlichen Revolution.
Diente der Film als politische Propaganda?
Die Arbeit analysiert, inwieweit fiktionale Geschichtsdarstellungen in der DDR zur Vermittlung eines staatlich gewünschten Geschichtsverständnisses genutzt wurden.
- Quote paper
- Marc Konstanzer (Author), 2018, Zur Bedeutung Thomas Müntzers für die Geschichtspolitik und Erinnerungskultur in der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/438732