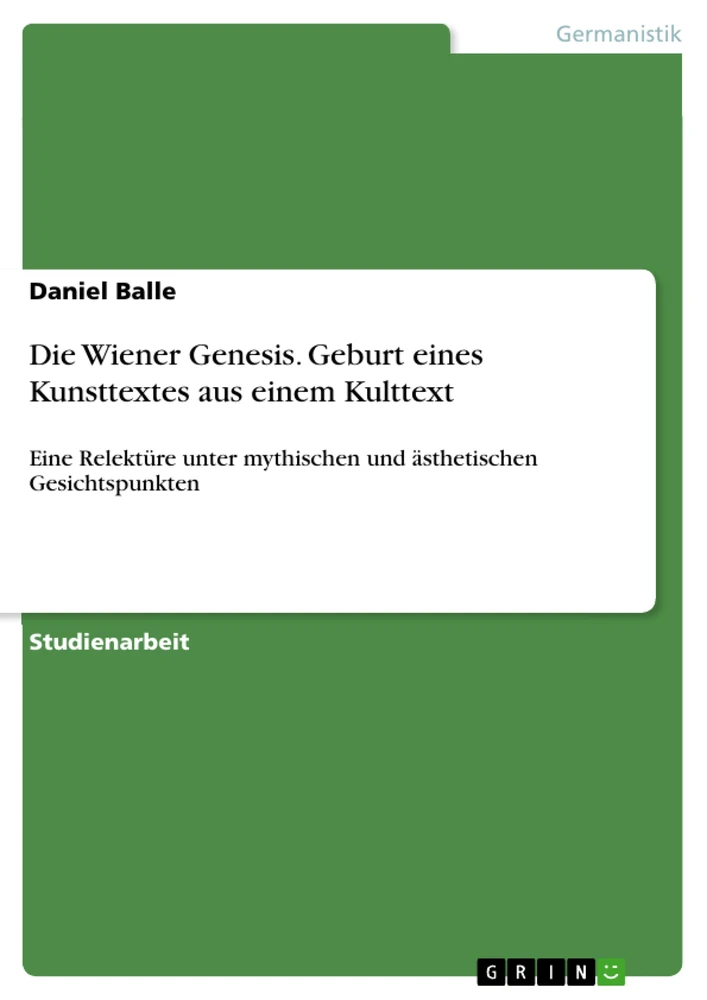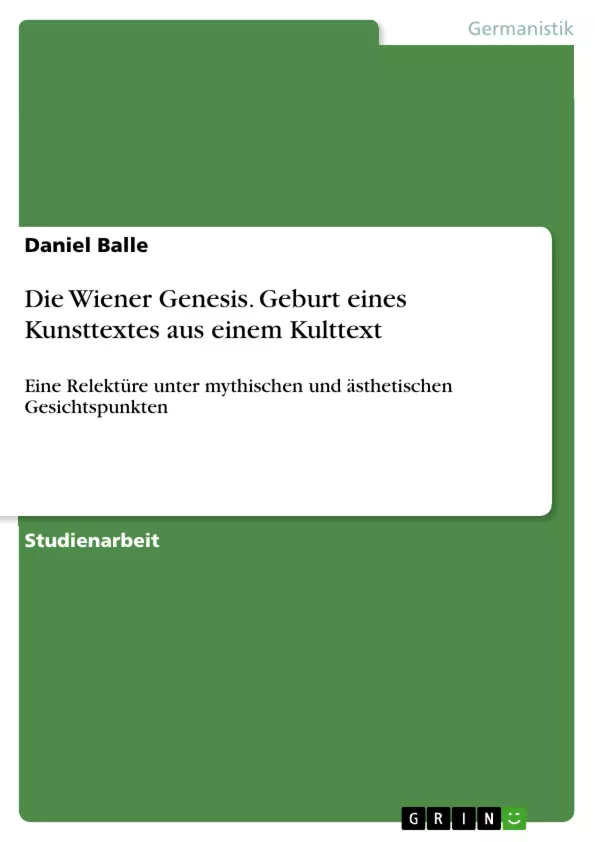Die eigentümlichste Art der Kunstproduktion und ihrer Werke füllt unser höchstes Bedürfnis nicht mehr aus; wir sind darüber hinaus, Werke der Kunst göttlich verehren und sie anbeten zu können.“ In diesem Zitat von Hegel kommt zum Ausdruck, dass es zwischen der Kunst und dem Heiligen, dass sich im Kult findet, einen Zusammenhang gibt, der in der heutigen Zeit so oftmals nicht sehr naheliegend zu sein scheint, da die Kunst doch als eigenständiges, autonomes Medium verstanden wird, das nicht vom Kult abhängt. Denkt man jedoch zurück in die Zeiten des Mittelalters so wird bewusst, dass Kult und Kunst dort nicht getrennt waren und die Kunst durch den Kult - das Religiöse sehr dominiert wurde. So waren Wissen und Poesie im Hochmittelalter noch nicht getrennt. Poesie ist ursprünglicher Artikulationsort einer christlich-mythischen Rationalität. Die heiligen Texte im Mittelalter waren in der Regel in Latein und nicht in der Volkssprache verfasst. Als jedoch die Volkssprachlichkeit Einzug in die Texte hielt erwuchs deren literarische Autonomie aus der Aneignung biblischer Inhalte. So wird z.B. die Wiener Genesis als ein bibelepischer Text, der in Volkssprache, dem frühmittelhochdeutsch verfasst ist, verstanden.
Erst in einem historischen Prozess hat sich dann die Kunst vom Kult getrennt. Der historische Prozess zwischen Kunst und Kult ist kontrovers modelliert. Das Verhältnis von Kunst und Kult kann nicht als Verhältnis einer plötzlichen Ablösung im Mittelalter gesehen werden, da diese nicht scharf durch eine epochale Zäsur zu trennen sind. So hat sich die Kunst schrittweise aus dem Kult herausgelöst. Die Kunst des Mittelalters hat memorative und bildende Funktionen gehabt, die religiöse Funktion bestand in der Transmission.
Die biblische Welt ist, was ihre Literarizität anbelangt, trotz ihres großen Einflusses, nicht besonders gegenwärtig. Die Präsenz der Bibel und die Festlegung der Figuren mache es den Schriftstellern schwer mit dem Stoff umzugehen und eine literarische Autonomie herzustellen, die künstlerischen Anspruch hat. Der biblische Gott hat jedoch auch Züge des Mythischen. Eben jenes Mythische könnte dem Text seine Literarizität verleihen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- Begriff und Zweck des Mythos
- Der rituelle Text
- Kult- und Kunsttext
- Die Wiener Genesis
- Die Wiener Genesis als Kunsttext
- Schöpfung als Mythos in der Wiener Genesis
- Descriptio Hominis
- Die Schöpfung des Menschen als ästhetisch-erzählerisches Verfahren
- Zusammenfassung, Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Wiener Genesis, ein bibelepischer Text in frühmittelhochdeutscher Sprache, um zu untersuchen, wie aus einem Kulttext ein Kunsttext werden kann. Dabei wird die Rolle des Mythos und des Ästhetischen bei der Abgrenzung des Kunsttextes vom Kulttext beleuchtet.
- Der Mythos als erzählendes Verfahren zur Selbstbehauptung des Menschen
- Die Wiener Genesis als Kunsttext und ihre Abhebung von der biblischen Genesis
- Die Bedeutung des Ästhetischen in der Schöpfungsgeschichte der Wiener Genesis
- Die Schöpfung des Menschen als ästhetisch-erzählerisches Verfahren in der Wiener Genesis
- Die Rolle der Mythisierung in der bibelepischen Erzählung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt den Zusammenhang zwischen Kunst und Kult im historischen Kontext dar. Die Grundlagen werden im zweiten Kapitel behandelt. Dort wird der Begriff des Mythos und seine Funktion im Zusammenhang mit dem Kult beleuchtet. Weiterhin werden rituelle Kulttexte und Kunsttexte sowie deren Verhältnis zueinander untersucht. Abschließend wird die Wiener Genesis als Beispiel für einen Kulttext vorgestellt.
Im dritten Kapitel wird die Wiener Genesis als Kunsttext betrachtet. Die Schöpfungsgeschichte wird als mythologisches Element analysiert, und es wird untersucht, wie die Wiener Genesis durch ihre ästhetischen Mittel ihre literarische Autonomie erlangt und sich von der biblischen Genesis abhebt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Begriffen Kulttext und Kunsttext, dem Mythos als Erzählverfahren, der Wiener Genesis als bibelepischer Text, Schöpfung als mythologisches Element, ästhetisch-erzählerisches Verfahren und dem historischen Zusammenhang zwischen Kunst und Kult im Mittelalter.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „Wiener Genesis“?
Die Wiener Genesis ist ein bibelepischer Text in frühmittelhochdeutscher Sprache, der biblische Inhalte literarisch aufbereitet und als eines der frühesten Beispiele für Volkssprachlichkeit gilt.
Wie unterscheiden sich Kulttexte von Kunsttexten?
Kulttexte dienen religiösen Zwecken und der Transmission göttlicher Wahrheiten, während Kunsttexte eine literarische Autonomie und ästhetische Gestaltung beanspruchen.
Wie wird die Schöpfungsgeschichte in der Wiener Genesis dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Schöpfung als mythologisches und ästhetisch-erzählerisches Verfahren, das über die rein religiöse Überlieferung hinausgeht.
Welche Rolle spielt der Mythos im Mittelalter?
Der Mythos dient als Erzählverfahren zur Selbstbehauptung des Menschen und bildet oft den Kern, aus dem literarische Texte ihre Autonomie gegenüber dem rein Religiösen gewinnen.
Warum löste sich die Kunst allmählich vom Kult?
Es war ein historischer Prozess, bei dem die Kunst von einer rein dienenden, memorativen Funktion zu einem eigenständigen Medium mit individuellem künstlerischem Anspruch reifte.
- Arbeit zitieren
- Daniel Balle (Autor:in), 2017, Die Wiener Genesis. Geburt eines Kunsttextes aus einem Kulttext, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/438749