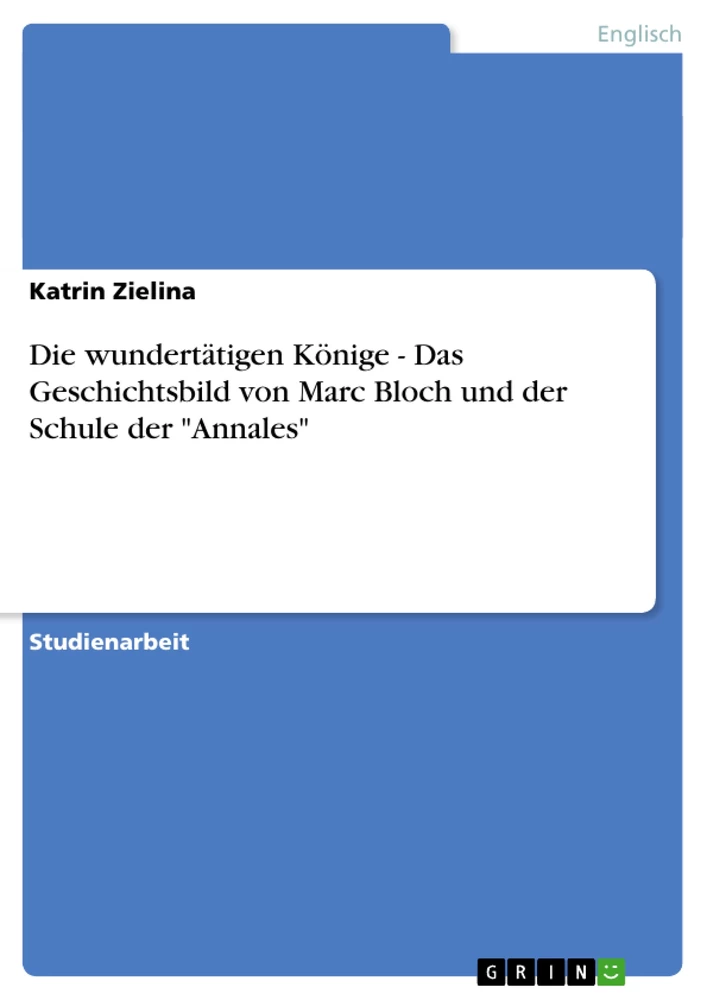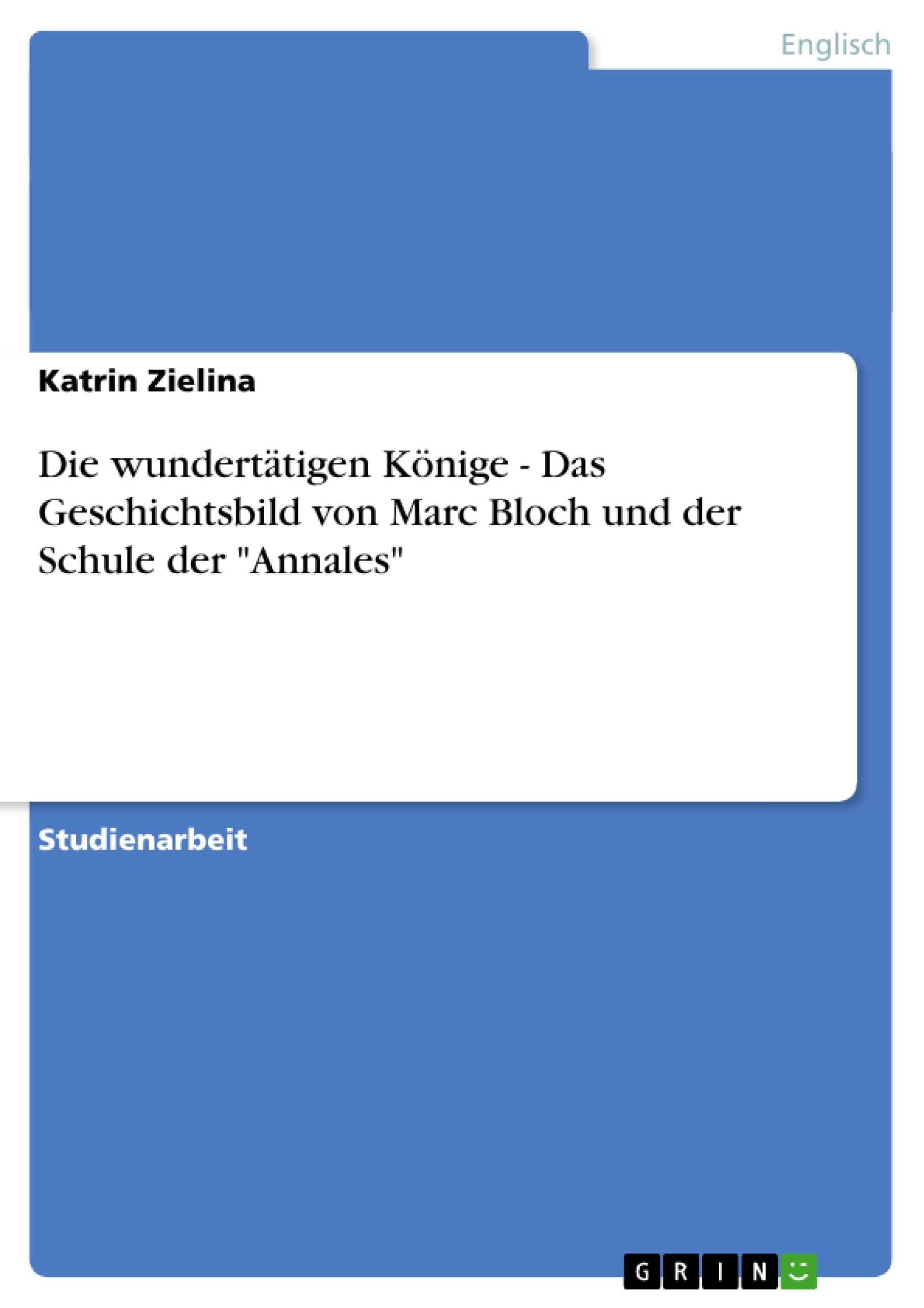1. Einleitung
Mit der Veröffentlichung ihrer Zeitung „Annales d’histoire économique et sociale“ läuteten Marc Bloch und Lucien Febvre eine völlig neue Epoche und Art der Geschichtsschreibung ein – die so genannte „Schule der Annales“. Auch wenn die spezielle Methode in der Geschichtsschreibung heute in dieser Form nicht mehr praktiziert wird, so hat diese Methode die Art der Geschichtsschreibung doch entscheidend beeinflusst und revolutioniert. Marc Blochs Bild von Geschichte wird an seinem Buch „Die wundertätigen Könige“ am deutlichsten. Bloch untersucht in diesem Werk, dass sich die englischen und französischen Könige fast 800 Jahre lang damit brüsteten, Skrofeln durch bloßes Handauflegen heilen zu können. Bloch fragt letztlich nicht, wie die Heilung möglich war, sondern vielmehr warum die Menschen so standhaft jahrhundertelang an das vermeintliche Wunder glauben konnten. Die Schule der Annales mit Marc Bloch als eine Art geistigem Vater entwirft ein spezielles Bild von Geschichte, auch wenn sich dieses Bild im Lauf der Jahre etwas geändert hat. Ziel dieser Arbeit ist es, das Geschichtsbild der „Gründerjahre“ um Bloch und Febvre herauszuarbeiten und aufzuzeigen, warum es sich grundlegend vom bis dato geltenden Bild von Geschichte unterschied. Zunächst werde ich die Grundzüge der Schule der Annales darstellen, inklusive deren Grenzen. Nach einer kurzen Zusammenfassung des Buches werde ich im nächsten Schritt Blochs Argumentation wiedergeben. Abschließend werde ich als Fazit anfügen, welches Bild von Geschichte Bloch in seinem Buch entwirft. Letztlich spiegelt dieses Bild die Ansicht der ersten Anhänger der Schule der Annales um die Gründungszeit wieder.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Schule der Annales
- Die wundertätigen Könige
- Was sind Skrofeln?
- Zusammenfassung von „Die wundertätigen Könige“
- Wie konnten die Menschen so lange an das Wunder glauben?
- Fazit Welches Bild von Geschichte entwirft Bloch?
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Geschichtsbild der „Schule der Annales“, insbesondere im Kontext von Marc Blochs Werk „Die wundertätigen Könige“. Ziel ist es, die Grundzüge dieser neuen Geschichtsschreibung herauszuarbeiten und deren Abgrenzung vom traditionellen Historismus aufzuzeigen. Die Arbeit konzentriert sich auf die erste Generation der Annales-Schule um Bloch und Febvre.
- Die Methode und Ziele der Annales-Schule
- Blochs Analyse des Glaubens an die „wundertätigen Könige“
- Der Einfluss der Sozialwissenschaften auf die Geschichtswissenschaft
- Die Kritik am traditionellen Historismus
- Das von Bloch entworfene Geschichtsbild
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Bedeutung der „Schule der Annales“ und Marc Blochs Werk „Die wundertätigen Könige“ für die Geschichtswissenschaft. Sie benennt die Ziele der Arbeit, nämlich die Darstellung des Geschichtsbildes der Annales-Schule und die Analyse von Blochs Argumentation in seinem Buch.
Die Schule der Annales: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung und die Ziele der „Schule der Annales“. Es wird die Abkehr vom traditionellen Historismus und die Integration der Sozialwissenschaften in die Geschichtswissenschaft erläutert. Die Etablierung der Annales-Schule als Reaktion auf die gesellschaftliche Nachfrage nach sozialwissenschaftlicher Erkenntnis wird hervorgehoben, ebenso wie die Einteilung der Schule in verschiedene Generationen, wobei der Fokus auf der ersten Generation um Bloch und Febvre liegt. Die Interdisziplinarität und problemorientierte Herangehensweise werden als zentrale Merkmale dieser Schule beschrieben.
Die wundertätigen Könige: Dieses Kapitel fasst Blochs Werk zusammen. Bloch untersucht nicht die Möglichkeit der Heilung von Skrofeln durch königliche Berührung, sondern den anhaltenden Glauben daran über Jahrhunderte hinweg. Der Fokus liegt auf den soziokulturellen und psychologischen Faktoren, die diesen Glauben aufrechterhielten, und nicht auf der medizinischen oder wundersamen Seite des Phänomens. Es werden die Methoden der Annales-Schule angewendet um den Glauben zu erklären und zu verstehen.
Schlüsselwörter
Schule der Annales, Marc Bloch, Lucien Febvre, Historismus, Sozialgeschichte, Interdisziplinarität, „Die wundertätigen Könige“, Skrofeln, Geschichtsbild, problemorientierte Geschichtsschreibung.
Häufig gestellte Fragen zu Marc Blochs "Die wundertätigen Könige" und der Annales-Schule
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Geschichtsbild der „Schule der Annales“, insbesondere anhand von Marc Blochs Werk „Die wundertätigen Könige“. Der Fokus liegt auf der ersten Generation der Annales-Schule um Bloch und Febvre. Es werden die Methoden, Ziele und die Abgrenzung vom traditionellen Historismus untersucht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Methode und Ziele der Annales-Schule, Blochs Analyse des Glaubens an die „wundertätigen Könige“, den Einfluss der Sozialwissenschaften auf die Geschichtswissenschaft, die Kritik am traditionellen Historismus und das von Bloch entworfene Geschichtsbild. Ein wichtiger Aspekt ist die Erklärung des lang anhaltenden Glaubens an die heilende Wirkung der königlichen Berührung, ohne die medizinische Seite des Phänomens zu untersuchen.
Was ist die "Schule der Annales"?
Die „Schule der Annales“ war eine einflussreiche Gruppe von Historikern, die sich von der traditionellen Geschichtsschreibung abgrenzte. Sie integrierte sozialwissenschaftliche Methoden und konzentrierte sich auf langfristige Prozesse und soziale Strukturen. Die Arbeit konzentriert sich auf die erste Generation um Bloch und Febvre, die durch Interdisziplinarität und problemorientierte Herangehensweise charakterisiert war.
Was ist die Kernaussage von Blochs "Die wundertätigen Könige"?
Blochs Werk untersucht nicht die medizinische Möglichkeit der Heilung von Skrofeln durch die königliche Berührung, sondern den anhaltenden Glauben daran über Jahrhunderte hinweg. Er analysiert die soziokulturellen und psychologischen Faktoren, die diesen Glauben aufrechterhielten, unter Anwendung der Methoden der Annales-Schule.
Wie grenzt sich die Annales-Schule vom traditionellen Historismus ab?
Die Annales-Schule unterschied sich vom traditionellen Historismus durch ihre interdisziplinäre Herangehensweise, die Integration der Sozialwissenschaften und die Fokussierung auf langfristige soziale und kulturelle Prozesse anstatt auf politische Ereignisse und Individuen. Sie kritisierte den Historismus für seine zu starke Fokussierung auf politische Geschichte und das Vernachlässigen sozialer und wirtschaftlicher Aspekte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schule der Annales, Marc Bloch, Lucien Febvre, Historismus, Sozialgeschichte, Interdisziplinarität, „Die wundertätigen Könige“, Skrofeln, Geschichtsbild, problemorientierte Geschichtsschreibung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Schule der Annales, ein Kapitel zu Blochs "Die wundertätigen Könige", ein Fazit zum Geschichtsbild Blochs und ein Literaturverzeichnis. Das Kapitel zu "Die wundertätigen Könige" beinhaltet Unterkapitel zu den Skrofeln, einer Zusammenfassung des Werkes und der Frage nach der Dauerhaftigkeit des Glaubens an das Wunder.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Grundzüge der Geschichtsschreibung der Annales-Schule darzustellen und deren Abgrenzung vom traditionellen Historismus aufzuzeigen, indem sie Blochs Werk "Die wundertätigen Könige" als Fallbeispiel analysiert.
- Quote paper
- Katrin Zielina (Author), 2005, Die wundertätigen Könige - Das Geschichtsbild von Marc Bloch und der Schule der "Annales", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43885