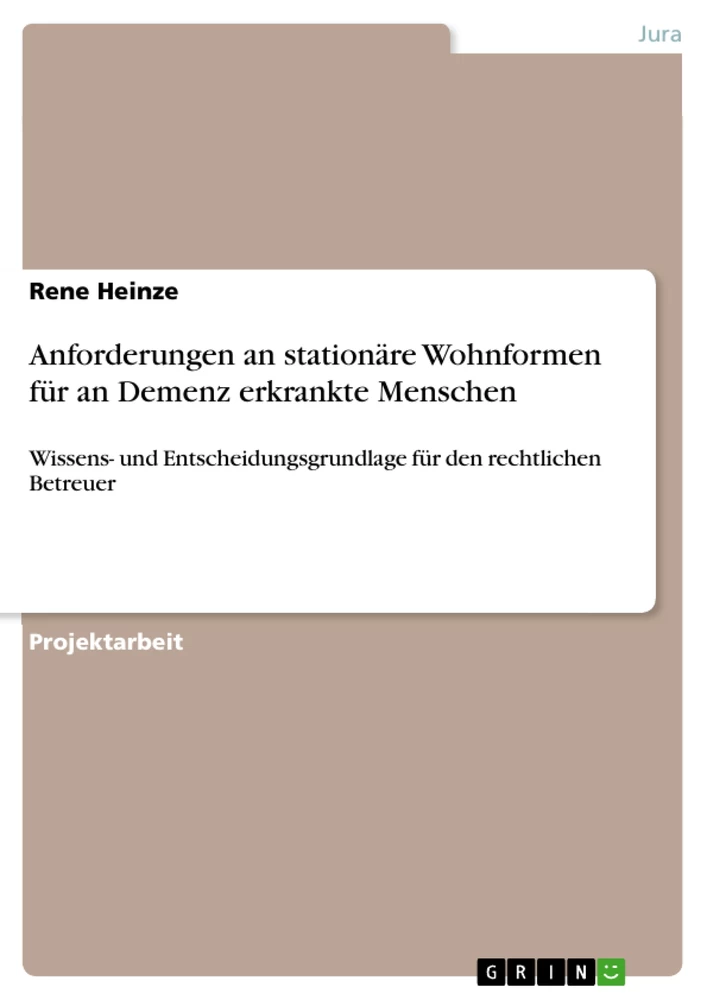Welche Maßstäbe stellen verschiedene Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht und Bildung an eine stationäre Einrichtung stellen, die möglicherweise in einer späteren Lebensphase unter der Annahme nicht vorhandener oder nicht mehr realisierbarer pflegerischer Versorgungsalternativen ihren Lebensmittelpunkt stellen. Durch den Wirkungskreis meiner Arbeit in der Bundeshauptstadt Berlin ist es mir erlaubt, im Unterschied zu ländlichen Regionen unter einer Vielzahl differenzierter stationärer Versorgungsangebote wählen zu können. Es besteht eine große Auswahl unterschiedlichster Einrichtungen, die einem die Erfüllung individueller Bedürfnisse dieser Art des Wohnens erlauben. Laut Statistik der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales bestehen aktuell 32.998 vollstationäre Pflegeplätze in 290 verschiedenen Einrichtungen in Berlin, ergänzend der Bereich des Bundeslandes Brandenburg mit derzeit 400 stationären Pflegeeinrichtungen.
Seitens potentieller Betroffener gibt es in Berlin und der unmittelbaren territorialen Umgebung eine große Zahl unterschiedlichster Menschen mit verschiedensten Biografien und damit differenzierten Anforderungen an eine Pflegeeinrichtung. In der Vorbereitung der Umfrage wurden Leistungsbeschreibungen von Pflegeeinrichtungen durchgearbeitet und eigene Erfahrungen mit Angeboten diverser Anbieter eingebracht, um eine Vielzahl von Punkten abzufragen, die in der Entscheidung für einen Pflegeheimplatz relevant
sind. Diese Fragen nach den Präferenzen einer späteren Pflegeeinrichtung wurden in die Rubriken „Standort“, „Wohnen & Ausstattung“, „Betreuung & Pflege“, „Tagesablauf“, „Essen & Trinken“ sowie „Personal & Service“ auf der Grundlage der vorab gestellten kategorischen Fragen nach den Grundbedürfnissen in einer stationären Pflegeeinrichtung eingeordnet.
Diese lauteten wie folgt:
- In welcher Lage möchte ich zukünftig wohnen?
- Wie sieht die Einrichtung und mein zukünftiges Zimmer aus?
- Wie wird dort gepflegt und wer betreut mich?
- Wie sieht die Tagesgestaltung aus und wie kann ich diese beeinflussen?
- Welche Anforderungen an die Nahrungsversorgung stelle ich?
- Wie viel Personal ist vorhanden und welche Serviceangebote kann ich nutzen?
Im zweiten Teil der Befragung wurde von mir abgefragt, ob ein generelles Interesse bezüglich einer späteren stationären Versorgungsform vorliegt und welche Vorsorge diesbezüglich getroffen wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsfrage
- Hypothese
- Abgeleitete Hypothesen
- Epidemiologie und demographischer Wandel
- Methodik
- Pflege in stationären Einrichtungen
- Demenz
- Befragung
- Ergebnisse
- Auswertung allgemeiner Fragen
- Auswertung Bewertungsfragen
- Zusammenfassung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit der Problematik geeigneter Wohnformen und Wohnformübergängen bei an Demenz erkrankten Menschen im Kontext der alltäglichen Arbeit des rechtlichen Betreuers. Die zunehmende Lebenserwartung führt zu einem proportionalen Anstieg der Anzahl an Demenzkranken, die rechtliche Betreuung benötigen. Die steigende Anzahl an Demenzkranken stellt eine wachsende Herausforderung für die Arbeit mit Klienten dar und bildet den Fokus dieser Studienarbeit.
- Analyse der Anforderungen an stationäre Wohnformen für Demenzkranke aus der Perspektive des rechtlichen Betreuers
- Bewertung des Einflusses des demographischen Wandels auf die Anforderungen an die Betreuung von Demenzkranken
- Entwicklung einer Entscheidungshilfe für Betreuer bei der Wahl einer geeigneten stationären Wohnform für Demenzkranke
- Untersuchung der Präferenzen von verschiedenen Bevölkerungsgruppen hinsichtlich ihrer Anforderungen an eine stationäre Pflegeeinrichtung
- Analyse des aktuellen Angebots an stationären Pflegeeinrichtungen in Berlin und Brandenburg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Studienarbeit ein und beleuchtet die Relevanz des Themas im Kontext der steigenden Anzahl an Demenzkranken und der damit verbundenen Herausforderungen für den rechtlichen Betreuer. Die Forschungsfrage der Studie wird definiert und die Hypothese der Arbeit aufgestellt. Das Kapitel "Methodik" beschreibt die angewandte Methode der quantitativen Forschung. Die Kapitel "Pflege in stationären Einrichtungen" und "Demenz" liefern einen theoretischen Rahmen für die Studie, indem sie die verschiedenen Formen der Demenz und die Herausforderungen der Pflege in stationären Einrichtungen beleuchten. Das Kapitel "Befragung" präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Befragung, die Aufschluss über die Präferenzen von verschiedenen Bevölkerungsgruppen hinsichtlich ihrer Anforderungen an eine stationäre Pflegeeinrichtung liefern.
Schlüsselwörter
Demenz, rechtliche Betreuung, stationäre Wohnform, Pflegeeinrichtung, Präferenzen, Bevölkerungsgruppen, demographischer Wandel, Entscheidungshilfe, Berlin, Brandenburg.
Häufig gestellte Fragen
Welche Faktoren sind bei der Wahl eines Pflegeheims für Demenzkranke wichtig?
Relevante Rubriken sind Standort, Wohnen & Ausstattung, Betreuung & Pflege, Tagesablauf, Essen & Trinken sowie Personal & Service.
Wie viele vollstationäre Pflegeplätze gibt es in Berlin?
Laut Statistik der Senatsverwaltung gibt es in Berlin aktuell etwa 32.998 vollstationäre Pflegeplätze in 290 verschiedenen Einrichtungen.
Welche Rolle spielt der rechtliche Betreuer bei der Wohnformsuche?
Der Betreuer muss unter Berücksichtigung der Biografie und Bedürfnisse des Demenzkranken eine geeignete stationäre Versorgungsform auswählen, wenn häusliche Pflege nicht mehr möglich ist.
Wie beeinflusst der demographische Wandel die Pflegeplanung?
Die steigende Lebenserwartung führt zu einem proportionalen Anstieg der Anzahl an Demenzkranken, was die Nachfrage nach spezialisierten stationären Wohnformen erhöht.
Gibt es Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Versorgungsangeboten?
In der Bundeshauptstadt Berlin besteht im Vergleich zu ländlichen Regionen eine deutlich größere Auswahl an differenzierten stationären Versorgungsangeboten.
- Citar trabajo
- Rene Heinze (Autor), 2017, Anforderungen an stationäre Wohnformen für an Demenz erkrankte Menschen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/438883