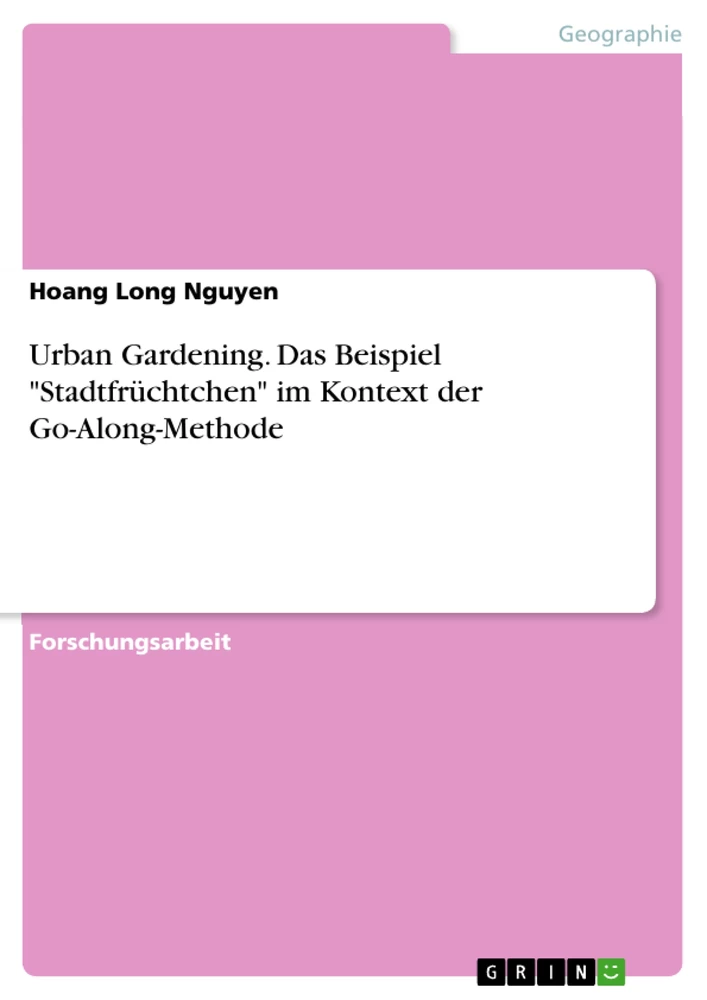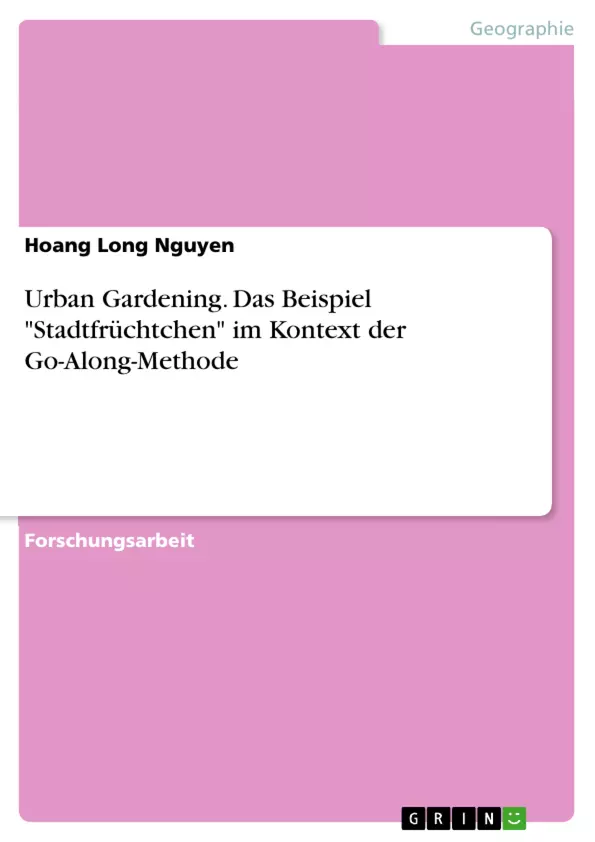Urbane Gemeinschaftsgärten sind unlängst Teil vieler dicht besiedelter Städte dieser Welt. Dabei muss das sogenannte Konzept „Urban Gardening“ nicht immer durch Stadtplaner_innen initiiert und organisiert werden. In vielen Fällen beteiligen sich auch die Bürgerinnen und Bürger selbst, etwa in Form von Initiativen, bei der Reaktivierung von ungenutzten Brachflächen sowie bei der Wiederbelebung von Grünstrukturen in den Großstädten. Dieser Trend zum urbanen Gärtnern weitet sich mittlerweile auch in Deutschland aus. So kann in der Stadt Bonn ebenfalls Urban Gardening beobachtet werden. Seit 2017 wurde dort das Projekt „Stadtfrüchtchen“ gegründet.
Im Rahmen des Methodenseminars „(Post)Humanistische Methoden zur Erforschung von Mensch-Natur Beziehungen“ soll das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt bei dem Projekt Stadtfrüchtchen anhand der „Go-Along-Methode“ aus ethnographischer Perspektive dargestellt werden. Dazu sollen die Ergebnisse aus den qualitativen Erhebungen mit den Probandinnen untereinander verglichen und ausgewertet werden.
Zum Einstieg in dieser Arbeit dient ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen. In diesem Kapitel wird der aktuelle Forschungsstand zu Urban Gardening identifiziert und der Begriff anhand dessen definiert. Der zweite theoretische Teil befasst sich dagegen mit der ethnographischen Erhebungsmethode Go-Along, da dies ein besseres Verständnis für die Diskussion der empirischen Ergebnisse im späteren Verlauf beitragen soll. Anhand der theoretischen Grundlagen werden im darauffolgenden Kapitel die Fragestellung und das Forschungsziel erläutert. Ausgehend von den theoretischen Grundlagen dieser Arbeit wird der Forschungsgegenstand vorgestellt.
Nachdem die Basis für diese Arbeit geschaffen worden ist, geht es im Hauptteil um die Wahrnehmungen der einzelnen Probandinnen zum Projekt „Stadtfrüchtchen“, welches den Forschungsgegenstand darstellt. Zunächst wird die Auswahl der Probandinnen begründet und auch das methodische Vorgehen erläutert. Die empirischen Ergebnisse werden dann anschließend präsentiert. Im selbigen Kapitel sollen neue Erkenntnisse während der Anwendung der Go-Along-Methode aus Sicht des Autors reflektiert werden.
Schließlich werden im Fazit die wesentlichen Ergebnisse aus dieser Arbeit zusammengefasst und wertend vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Urban Gardening
- 2.2 Go-Along-Methode
- 3. Fragestellung und Forschungsziel
- 4. Forschungsgegenstand
- 5. Diskussion der empirischen Ergebnisse
- 5.1 Methodisches Vorgehen
- 5.2 Ergebnisse aus den Go-Alongs
- 5.3 Reflexion der empirischen Ergebnisse
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert das Projekt „Stadtfrüchtchen“ in Bonn im Kontext der Go-Along-Methode. Ziel ist es, das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt in diesem urbanen Gemeinschaftsgarten aus ethnographischer Perspektive zu beleuchten.
- Urban Gardening als ein Trend zur Reaktivierung ungenutzter Flächen und zur Förderung lokaler Ernährungssouveränität.
- Die Go-Along-Methode als qualitative Erhebungstechnik zur Untersuchung von Mensch-Umwelt-Beziehungen.
- Die Wahrnehmung und Erfahrungen von Probandinnen im Projekt „Stadtfrüchtchen“ im Hinblick auf Urban Gardening und Umweltbewusstsein.
- Reflexion der empirischen Ergebnisse aus der Anwendung der Go-Along-Methode.
- Die Bedeutung von Urban Gardening für die Gestaltung von städtischen Räumen und die Förderung von sozialer Inklusion.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit führt in die Thematik des Urban Gardening ein und stellt das Projekt „Stadtfrüchtchen“ als Forschungsgegenstand vor. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen von Urban Gardening und der Go-Along-Methode. Kapitel 3 erläutert die Fragestellung und das Forschungsziel der Arbeit. In Kapitel 5 werden die empirischen Ergebnisse der Go-Alongs präsentiert und reflektiert, wobei das methodische Vorgehen erläutert wird.
Schlüsselwörter
Urban Gardening, Go-Along-Methode, Ethnographie, Mensch-Umwelt-Beziehungen, Stadtfrüchtchen, Gemeinschaftsgarten, Ernährungssouveränität, soziale Inklusion, qualitative Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Urban Gardening?
Urban Gardening bezeichnet die meist gemeinschaftliche gärtnerische Nutzung städtischer Flächen, oft zur Reaktivierung von Brachflächen und zur Förderung lokaler Ernährungssouveränität.
Was ist das Projekt "Stadtfrüchtchen" in Bonn?
Es handelt sich um eine 2017 gegründete Urban Gardening Initiative in Bonn, die Bürgern Raum zum gemeinsamen Gärtnern und zum Austausch bietet.
Wie funktioniert die Go-Along-Methode?
Bei dieser ethnographischen Methode begleitet der Forscher die Probanden in ihrem natürlichen Umfeld (hier beim Gärtnern) und führt dabei Gespräche, um Wahrnehmungen und Handlungen im Kontext zu verstehen.
Welchen sozialen Nutzen haben Gemeinschaftsgärten?
Sie fördern die soziale Inklusion, schaffen Begegnungsräume für verschiedene Bevölkerungsgruppen und stärken das Umweltbewusstsein in der Stadt.
Warum ist Urban Gardening ein aktueller Trend?
Er entspringt dem Wunsch nach mehr Natur in der Stadt, gesunden Lebensmitteln und dem Bedürfnis nach aktiver Mitgestaltung des eigenen Lebensraums.
- Quote paper
- Bachelor of Science Geographie Hoang Long Nguyen (Author), 2017, Urban Gardening. Das Beispiel "Stadtfrüchtchen" im Kontext der Go-Along-Methode, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/439154