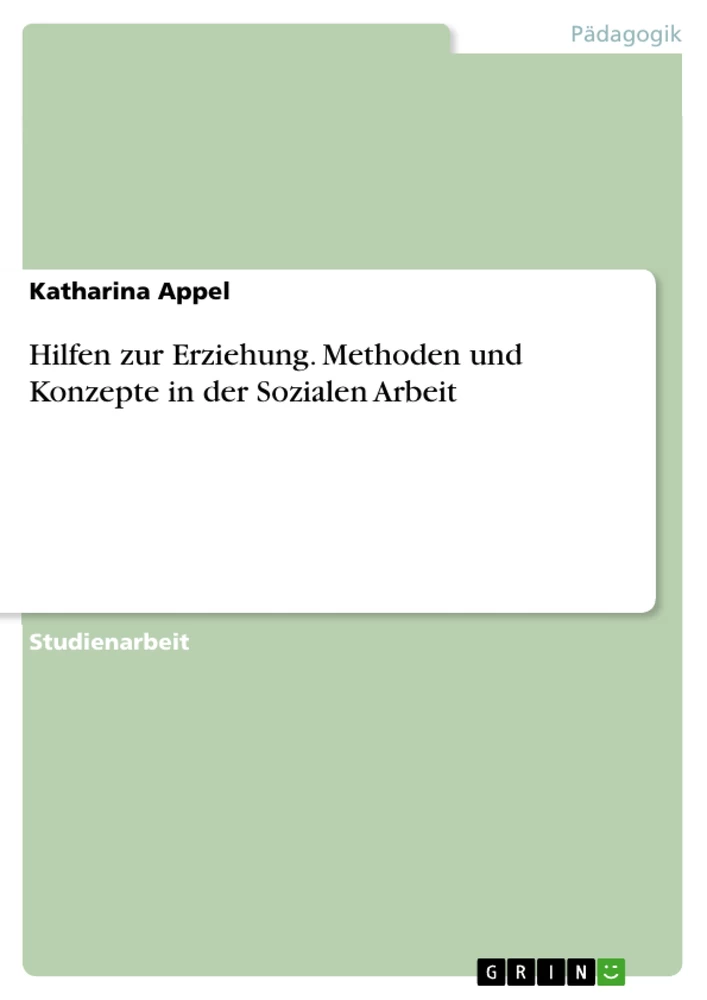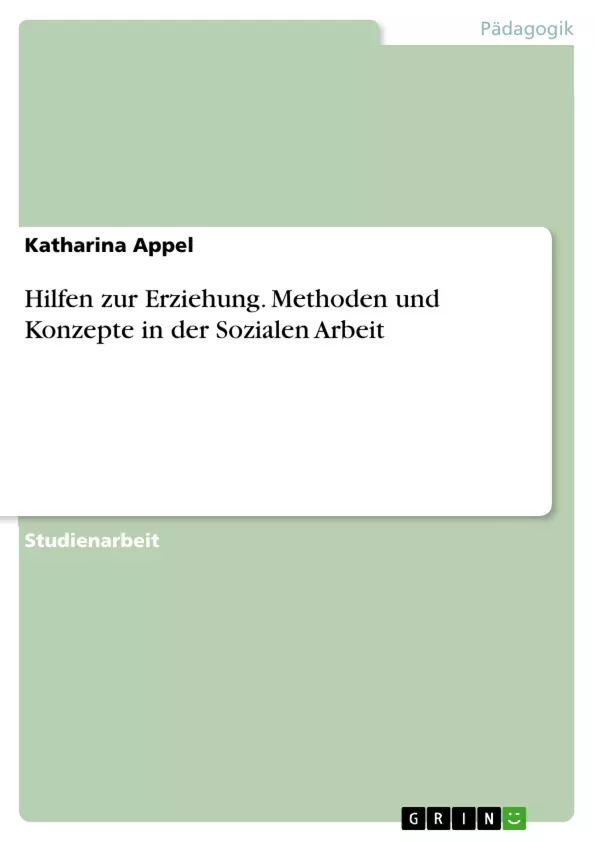Bei dieser Arbeit handelt es sich um ein Portfolio des Moduls 11 mit den Themen Hilfe zur Erziehung (M 11.1), Planung, Steuerung und Finanzierung (M 11.2) und Grundlagen der Gesprächsführung (M 11.3). Aufgrund des eingeschränkten Umfangs des Portfolios habe ich die Reflexionen der einzelnen Teile relativ kurz gehalten und nicht jede Sitzung reflektiert, um den Werkstücken den nötigen Raum zu geben. Lediglich bei der Reflexion des Teils 11.1 bin ich chronologisch vorgegangen, was aufgrund der Strukturierung, in jeder Sitzung ein Hauptthema, auch kein Nachteil war. Das Werkstück für 11.2 habe ich so konzipiert, dass es für mich auch durchfürbar wird. Ich habe es bereits im Team der Kita (in der ich arbeite) angesprochen und wir werden es noch in diesem Herbst realisieren. Bislang habe ich dort lediglich einmal in der Woche mit den Kindern einen Waldtag veranstaltet. Der dritte Teil des Portfolios (M 11.3) ist wesentlich länger ausgefallen, als die beiden anderen Teile. liegt daran liegt, dass ich für mich aus diesem Teil des Moduls am meisten mitnehmen konnte. Hier hat die Reflexion wirklich unmittelbar zu meinem Verständnis und zu meiner Wissenerweiterung beigetragen. Das Portfolio gliedert sich in drei Teile, die jeweils die Reflexion und das Werkstück des Teilmoduls beinhalten. Zum einfacheren Verständnis und der Übersichtlichkeit halber, habe ich ausschließlich die weibliche Form verwendet. Männer sind selbstverständlich mitgemeint.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Modul 11.1: Hilfe zur Erziehung
- Reflexion
- Werkstück
- Modul 11.2: Planung, Steuerung und Finanzierung
- Reflexion
- Werkstück
- Modul 11.3: Grundlagen der Gesprächsführung
- Reflexion
- Werkstück
- Ausblick
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Portfolio befasst sich mit den drei Teilmodulen des Moduls 11: Hilfe zur Erziehung, Planung, Steuerung und Finanzierung sowie Grundlagen der Gesprächsführung. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die im Studium erlernten Methoden und Konzepte der Sozialen Arbeit in der Praxis anzuwenden und zu reflektieren. Darüber hinaus soll das Werkstück aus dem Modul 11.2 in der Kita der Autorin umgesetzt werden.
- Hilfeplanverfahren und seine Phasen
- Die Rolle des Jugendamts in der Hilfeplanung
- Kommunikationsstrategien in der Sozialen Arbeit
- Macht und Kontrolle in der Sozialen Arbeit
- Methoden der Gesprächsführung
Zusammenfassung der Kapitel
Modul 11.1: Hilfe zur Erziehung
Die Reflexion zu Modul 11.1 behandelt die einzelnen Sitzungen des Seminars und beleuchtet verschiedene Aspekte des Hilfeplanverfahrens. Dabei werden Themen wie der Falleingang, die Anamnese und die Erstellung des Hilfekonzepts thematisiert. Zudem wird auf die Klientel der Erziehungshilfen und die Herausforderungen der Kommunikation in der Sozialen Arbeit eingegangen.
Modul 11.2: Planung, Steuerung und Finanzierung
Die Reflexion zu Modul 11.2 konzentriert sich auf die Planung und Umsetzung eines Werkstücks, welches im Team der Kita der Autorin realisiert werden soll. Das Werkstück soll sich mit dem Thema Waldtage für Kinder beschäftigen.
Modul 11.3: Grundlagen der Gesprächsführung
Die Reflexion zu Modul 11.3 fokussiert auf die Bedeutung der Gesprächsführung in der Sozialen Arbeit und beleuchtet verschiedene Methoden und Strategien. Die Autorin analysiert verschiedene Gesprächssituationen und beschreibt ihre persönlichen Lernprozesse und Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Das Portfolio beschäftigt sich mit den Themenbereichen Hilfe zur Erziehung, Hilfeplanverfahren, Gesprächsführung, Kommunikation, Macht und Kontrolle, Sozialarbeit, Kita, Werkstück, Reflexion, Planung, Steuerung und Finanzierung.
- Quote paper
- Katharina Appel (Author), 2010, Hilfen zur Erziehung. Methoden und Konzepte in der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/439438