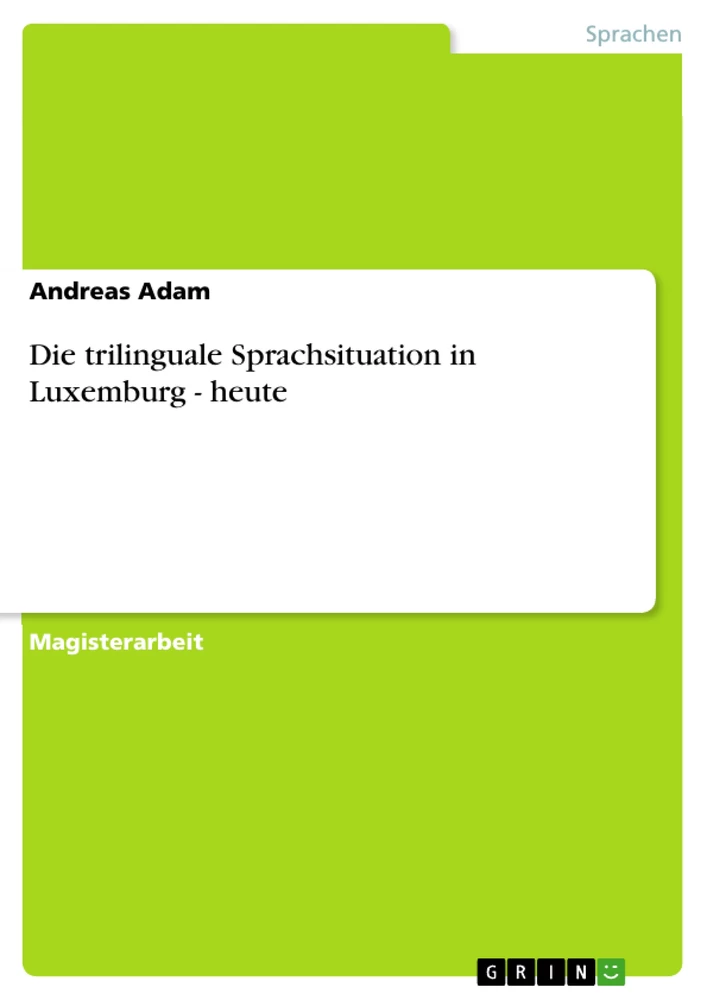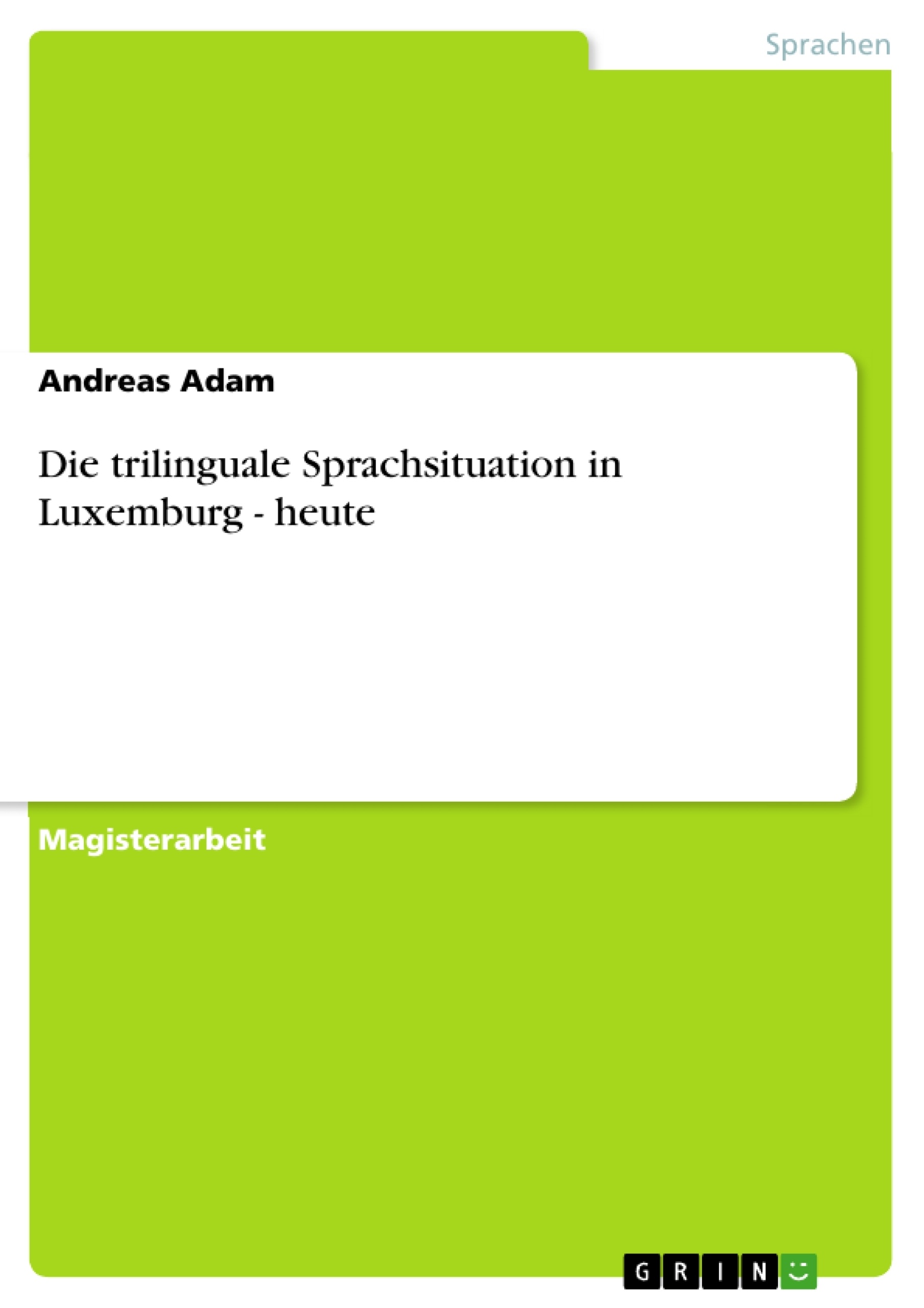Lëtzebuergesch wurde 1848 zum ersten Mal bei einem offiziellen Anlaß verwendet: Der Abgeordnete C.M. André wendete sich anläßlich der Ständeversammlung in Ettelbrück über die Teilnahme am Frankfurter Parlament auf lëtzebuergesch an die Versammlung und erläuterte seinen Standpunkt ganz in seiner Muttersprache. Die Verfassung von 1848 hatte die Wahlfreiheit zwischen Deutsch und Französisch und damit die Zweisprachigkeit des Staates festgelegt. Bereits 1847 war das erste "Lexikon der Luxemburger Umgangssprache" mit deutscher und französischer Übersetzung von J. F. Gangler erschienen.
Die Triglossiesituation in Luxemburg rückte erstmals 1896 in den Vordergrund, als der Abgeordnete Caspar Mathias Spoo seine Antrittsrede im Parlament auf "...Lëtzebuergesch..." hielt. Vorausgesetzt wird bei der Bezeichnung Triglossiesituation, daß man Lëtzebuergesch als Sprache versteht. Die Verwendung der moselfränkischen Mundart der Bevölkerung durch Spoo 1896 führte damals zum Verbot , d.h. zur Nichtzulassung von Lëtzebuergesch im Parlament. Die Einstellung der Bevölkerung zum Lëtzebuergeschen war damals eine andere als heute. So sagte der Präsident zu Spoos lëtzebuergescher Rede:
"Maintenant, si l’hon. M. Spoo a préparé un discours en luxembourgeois qu’il allait nous faire entendre à l’occasion de la discussion du budget, je proposerai, à titre de transaction, de laisser passer la chose pour aujourd’hui: mais la Chambre prendra la décision qu’à l’avenir tout le monde emploiera la langue française ou la langue allemande." Spoo begründete seinen Gebrauch des Lëtzebuergeschen interessanterweise unter anderem mit der damals aktuellen Verfassung, wonach im Parlament entweder Deutsch oder Französisch zu sprechen war:
"Unsere Sprache ist die Deutsche, und ich behaupte sogar, dass dieselbe viel älter und ehrwürdiger ist als das sogenannte Hochdeutsche. Denn lange vorher ist sie gesprochen worden, bevor ein Lessing, Göthe[sic!] und Schiller gekommen waren, welche der hochdeutschen Sprache erst ihre bessere Gestalt gegeben haben. ... ... Luxemburgisch ist Deutsch und hat sein verfassungsmäßiges Recht hier. Das kann doch nicht anders heissen als: Rede jeder das Deutsch, welches ihm am besten geht.."
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Einleitung
- Der Weg des Lëtzebuergeschen zur Nationalsprache
- Die heutige Sprachpraxis
- Ein domänenspezifischer Überblick über die Sprachpraxis im öffentlichen Bereich
- Das Schulwesen
- Vor- und Grundschule
- Hauptschule
- Schultypen mit handwerklich-technischer Ausrichtung
- Gymnasien
- Hochschulausbildung
- Die Medien
- Printmedien
- Rundfunk
- Fernsehen
- Die Justiz
- Das Parlament und die öffentlichen Verwaltungen
- Die Regierung
- Die Kirche
- Das Schulwesen
- Ein domänenspezifischer Überblick über die Sprachpraxis im halböffentlich-privaten Bereich
- Handel, Gewerbe und Industrie
- Arbeitsstelle
- Familie, Freunde, Bekannte
- Umfrage
- Die Arbeitsstelle
- Der Privatbereich
- Öffentliche Sprachkontakte
- Ein domänenspezifischer Überblick über die Sprachpraxis im öffentlichen Bereich
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit von 1996 untersucht die trilinguale Sprachpraxis in Luxemburg. Sie konzentriert sich auf ausgewählte Bereiche des öffentlichen und halböffentlich-privaten Lebens und beschreibt die Sprachsituation des Jahres 1996. Die Arbeit analysiert den Sprachgebrauch luxemburgischer Staatsbürger und beleuchtet den Weg des Lëtzebuergeschen zur Nationalsprache.
- Der Entwicklungsprozess des Lëtzebuergeschen zur Nationalsprache
- Sprachgebrauch in verschiedenen öffentlichen Bereichen (Schule, Medien, Justiz etc.)
- Sprachgebrauch in halböffentlich-privaten Bereichen (Arbeit, Familie etc.)
- Ergebnisse einer Umfrage zur Sprachpraxis in Luxemburg
- Die Rolle des Lëtzebuergeschen im Kontext der deutschen und französischen Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkung: Diese Arbeit beschreibt anhand ausgewählter Bereiche die trilinguale Sprachpraxis in Luxemburg im Jahr 1996, fokussiert auf repräsentative Bereiche und Situationen, nicht auf Vollständigkeit.
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der trilingualen Sprachsituation in Luxemburg ein und skizziert den Fokus der Arbeit auf ausgewählte Bereiche und die Beschränkung auf die Sprachsituation von 1996. Sie erwähnt die erste Verwendung des Lëtzebuergeschen bei einem offiziellen Anlass 1848 und die damit verbundene Entwicklung der Zweisprachigkeit (Deutsch und Französisch) im Staat.
Der Weg des Lëtzebuergeschen zur Nationalsprache: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Lëtzebuergeschen. Es beschreibt den ersten offiziellen Gebrauch von Lëtzebuergesch im Parlament 1896, das darauf folgende Verbot und die ambivalenten Einstellungen gegenüber der Sprache. Die Entwicklung wird weiterverfolgt bis zum Zweiten Weltkrieg, der dem Lëtzebuergeschen eine neue Bedeutung verschaffte.
Die heutige Sprachpraxis: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und untersucht den Sprachgebrauch in verschiedenen öffentlichen und halböffentlichen Bereichen. Es werden detaillierte Analysen des Sprachgebrauchs im Schulwesen, den Medien, der Justiz, im Parlament und in anderen Institutionen präsentiert, gefolgt von einer Erörterung des Sprachgebrauchs in der Familie, am Arbeitsplatz und im Handel. Die Kapitel beschreiben die beobachteten Sprachpraktiken und geben einen Überblick über die Sprachvielfalt in Luxemburg. Eine eingehende Analyse einer durchgeführten Umfrage ergänzt die Kapitel und liefert detaillierte Einblicke in den tatsächlichen Sprachgebrauch.
Schlüsselwörter
Lëtzebuergesch, Trilingualismus, Luxemburg, Sprachpraxis, Sprachgeschichte, öffentlicher Bereich, halböffentlich-privater Bereich, Medien, Schule, Justiz, Umfrage, Sprachpolitik, Mehrsprachigkeit, Moselfränkisch, Deutsch, Französisch.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit über die trilinguale Sprachpraxis in Luxemburg (1996)
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit aus dem Jahr 1996 untersucht die trilinguale Sprachpraxis in Luxemburg. Sie konzentriert sich auf ausgewählte Bereiche des öffentlichen und halböffentlich-privaten Lebens und beschreibt die Sprachsituation des Jahres 1996. Die Arbeit analysiert den Sprachgebrauch luxemburgischer Staatsbürger und beleuchtet den Weg des Lëtzebuergeschen zur Nationalsprache.
Welche Bereiche der Sprachpraxis werden untersucht?
Die Arbeit analysiert den Sprachgebrauch in verschiedenen öffentlichen Bereichen wie dem Schulwesen (von der Vorschule bis zur Hochschule), den Medien (Print, Rundfunk, Fernsehen), der Justiz, dem Parlament, der Regierung und der Kirche. Zusätzlich wird der Sprachgebrauch im halböffentlich-privaten Bereich untersucht, einschließlich Handel, Gewerbe, Industrie, Arbeitsplatz und dem privaten Umfeld (Familie, Freunde).
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer domänenspezifischen Analyse der Sprachpraxis in verschiedenen Bereichen des öffentlichen und halböffentlichen Lebens. Ein wichtiger Bestandteil ist eine eigene durchgeführte Umfrage zum Sprachgebrauch in der Arbeitsstelle, im Privatbereich und bei öffentlichen Sprachkontakten.
Welche historischen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Lëtzebuergeschen zur Nationalsprache. Es wird der erste offizielle Gebrauch von Lëtzebuergesch im Parlament (1896), das darauf folgende Verbot und die ambivalenten Einstellungen gegenüber der Sprache beschrieben. Die Entwicklung wird bis zum Zweiten Weltkrieg verfolgt, der dem Lëtzebuergeschen eine neue Bedeutung verschaffte.
Welche Schlüsselthemen werden behandelt?
Schlüsselthemen sind der Entwicklungsprozess des Lëtzebuergeschen zur Nationalsprache, der Sprachgebrauch in verschiedenen öffentlichen und halböffentlich-privaten Bereichen, die Ergebnisse der Umfrage zur Sprachpraxis, die Rolle des Lëtzebuergeschen im Kontext von Deutsch und Französisch sowie die trilinguale Sprachsituation in Luxemburg.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Vorbemerkung, eine Einleitung, ein Kapitel über den Weg des Lëtzebuergeschen zur Nationalsprache, ein Kapitel über die heutige Sprachpraxis (einschließlich der detaillierten Domänenanalysen und der Umfrageergebnisse) und eine Zusammenfassung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit bietet einen detaillierten Überblick über die trilinguale Sprachpraxis in Luxemburg im Jahr 1996. Die Schlussfolgerungen basieren auf den Ergebnissen der Domänenanalysen und der Umfrage und geben einen Einblick in den tatsächlichen Sprachgebrauch in verschiedenen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens in Luxemburg.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Lëtzebuergesch, Trilingualismus, Luxemburg, Sprachpraxis, Sprachgeschichte, öffentlicher Bereich, halböffentlich-privater Bereich, Medien, Schule, Justiz, Umfrage, Sprachpolitik, Mehrsprachigkeit, Moselfränkisch, Deutsch, Französisch.
- Citation du texte
- Andreas Adam (Auteur), 1996, Die trilinguale Sprachsituation in Luxemburg - heute, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43951