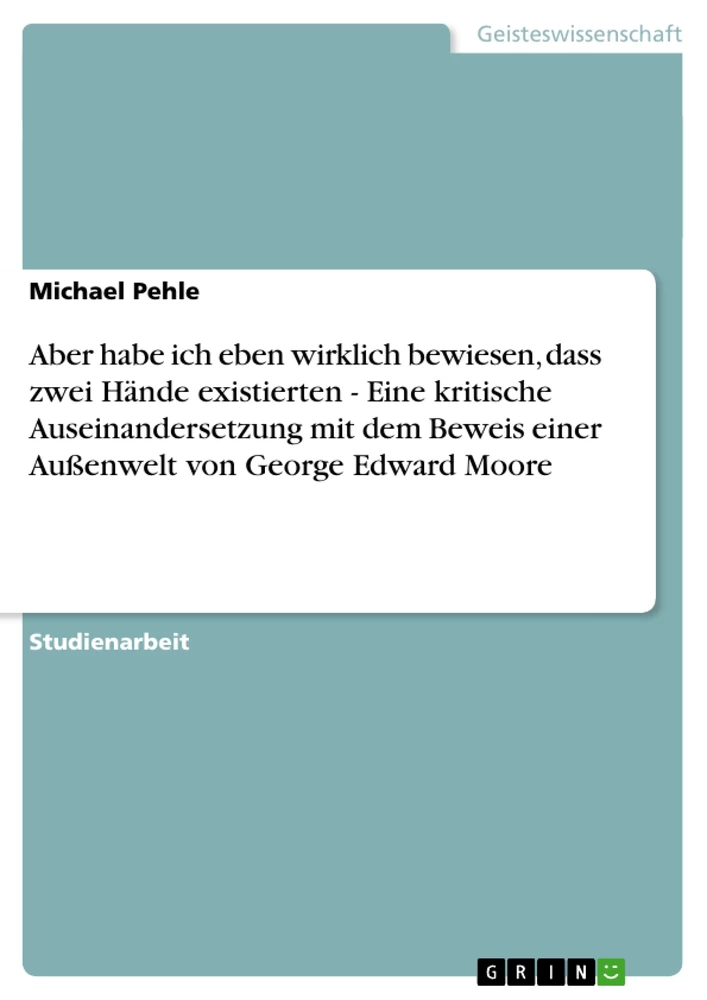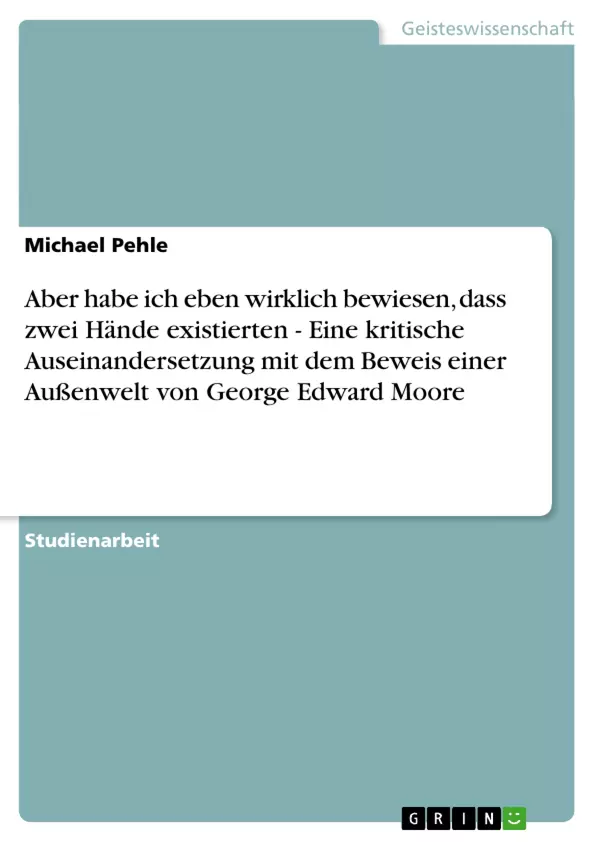Die Arbeit befasst sich mit dem Versuch des Beweises einer Außenwelt von George Edward Moore. Dazu ist es nötig, zunächst verschiedene Begriffe zu klären, die Moore zum Teil von Kant übernimmt aber gleichzeitig versucht, sie genauer zu definieren. Nach diesem Abschnitt wird zur Verdeutlichung Moores Beispiel der Seifenblase vorgestellt und anschließend sein Beweis der Außenwelt nachvollzogen. Der letzte Teil der Arbeit setzt sich mit diesem kritisch auseinander und zeigt mit der Hilfe von Wittgenstein die Probleme dieser Vorgehensweise auf.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Person G. E. Moore
- 3 Moores Definition der Außenwelt
- 3.1 Begriffsunterscheidung: Außendinge - Dinge außer uns - Dinge, die außerhalb unseres Bewusstseins existieren
- 3.2 Begriffsunterscheidung: im Raume vorgestellt - im Raume anzutreffen
- 3.3 Begriffsunterscheidung: außerhalb unseres Bewusstseins - innerhalb unseres Bewusstseins
- 4 Das Beispiel der Seifenblase
- 5 Der Beweis einer Außenwelt
- 6 Kritische Bemerkungen zu Moores Beweis
- 6.1 Kritik aus logischer Sichtweise
- 6.2 Wittgensteins Kritik
- 6.2.1 Wittgensteins Kritik am Beweis Moores
- 6.2.2 Wittgensteins Kritik am Zweifel
- 7 Abschlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht George Edward Moores Versuch, die Existenz einer Außenwelt zu beweisen. Sie klärt zunächst Moores Begrifflichkeiten, analysiert sein Beispiel der Seifenblase und rekonstruiert seinen Beweis. Schließlich wird Moores Beweis kritisch anhand von Wittgensteins Argumenten evaluiert.
- Klärung der Begrifflichkeiten von G.E. Moore zur Außenwelt
- Analyse von Moores Beweisführung für die Existenz einer Außenwelt
- Rekonstruktion des Beispiels der Seifenblase im Kontext des Beweises
- Kritische Auseinandersetzung mit Moores Beweisansatz
- Einbeziehung von Wittgensteins Kritik an Moore
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Aufbau der Arbeit. Sie kündigt die Klärung von Moores Begriffen, die Vorstellung des Seifenblasenbeispiels, die Nachvollziehung seines Beweises und die anschließende kritische Auseinandersetzung mit Hilfe von Wittgensteins Argumenten an. Ein kurzer biographischer Abriss Moores und seine Bedeutung für die analytische Philosophie werden ebenfalls erwähnt.
2 Die Person G. E. Moore: Dieses Kapitel skizziert die Biografie von G. E. Moore, seine Zeit am Trinity College in Cambridge, seine bedeutenden philosophischen Werke (wie "Principia Ethica" und "Proof of an External World") und seinen Einfluss auf die analytische Philosophie. Es hebt seine Methodik der Definition und logischen Analyse hervor und erwähnt seine Kritik am Idealismus und dem "naturalistischen Fehlschluss".
3 Moores Definition der Außenwelt: Dieses Kapitel widmet sich der präzisen Definition von zentralen Begriffen bei Moore, um Missverständnisse zu vermeiden. Es analysiert Moores Unterscheidung zwischen "Außendinge", "Dinge außer uns" und "Dinge außerhalb unseres Bewusstseins", zeigt seine Abgrenzung von Kants Verwendung dieser Begriffe auf und beleuchtet seine Definition von "im Raum vorgestellt" versus "im Raum anzutreffen" anhand konkreter Beispiele wie dem Phänomen der negativen Nachbilder.
4 Das Beispiel der Seifenblase: Dieses Kapitel (dessen detaillierter Inhalt im vorliegenden Textauszug fehlt) behandelt mutmaßlich ein von Moore verwendetes Beispiel, um seine Theorie der Außenwelt zu veranschaulichen. Die Funktion dieses Beispiels im Kontext des Gesamtarguments würde hier detailliert erläutert werden.
5 Der Beweis einer Außenwelt: Dieses Kapitel (dessen detaillierter Inhalt im vorliegenden Textauszug fehlt) beschreibt den eigentlichen Beweis Moores für die Existenz einer Außenwelt. Hier würde eine detaillierte Darstellung und Analyse des Beweises selbst erfolgen, einschließlich seiner Prämissen, Schlussfolgerungen und der zugrundeliegenden Argumentationsstruktur.
6 Kritische Bemerkungen zu Moores Beweis: Dieses Kapitel analysiert die Kritik an Moores Beweis, sowohl aus logischer Perspektive als auch unter Einbezug von Wittgensteins Argumenten. Es wird detailliert auf die Schwächen und Probleme des Beweises eingegangen und die Gegenargumente Wittgensteins sorgfältig untersucht und im Kontext der vorherigen Kapitel eingeordnet.
Schlüsselwörter
G.E. Moore, Außenwelt, Beweis, Analytische Philosophie, Idealismus, Common Sense, Wittgenstein, Begriffsanalyse, Seifenblasenbeispiel, Raum, Wahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen zu "G.E. Moores Beweis einer Außenwelt"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht George Edward Moores Versuch, die Existenz einer Außenwelt zu beweisen. Sie analysiert Moores Begrifflichkeiten, sein Beispiel der Seifenblase und seinen Beweis. Schließlich wird Moores Beweis kritisch anhand von Wittgensteins Argumenten evaluiert. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu Moores Biografie, eine detaillierte Analyse seiner Definition der Außenwelt, eine Erklärung seines Seifenblasenbeispiels (obwohl der detaillierte Inhalt im Auszug fehlt), eine Rekonstruktion seines Beweises (ebenfalls mit fehlenden Details im Auszug), eine kritische Auseinandersetzung mit dem Beweis und eine abschließende Betrachtung. Schlüsselwörter umfassen G.E. Moore, Außenwelt, Beweis, Analytische Philosophie, Idealismus, Common Sense, Wittgenstein, Begriffsanalyse, Seifenblasenbeispiel, Raum und Wahrnehmung.
Wer war G.E. Moore und welche Rolle spielt er in dieser Arbeit?
G.E. Moore war ein einflussreicher Philosoph, bekannt für seine Arbeiten in der analytischen Philosophie, insbesondere "Principia Ethica" und "Proof of an External World". Die Arbeit konzentriert sich auf Moores Versuch, die Existenz einer Außenwelt zu beweisen. Sein biographischer Hintergrund und seine philosophische Methode werden im zweiten Kapitel erläutert. Seine Definition der Außenwelt und sein Beweis bilden den Kern der Analyse.
Wie definiert Moore die Außenwelt?
Moore’s Definition der Außenwelt wird im dritten Kapitel präzise erläutert. Es werden wichtige Begriffsunterscheidungen wie "Außendinge", "Dinge außer uns", "Dinge außerhalb unseres Bewusstseins", "im Raume vorgestellt" und "im Raume anzutreffen" analysiert und anhand von Beispielen wie dem Phänomen der negativen Nachbilder veranschaulicht. Die Arbeit verdeutlicht die Abgrenzung von Kants Verwendung dieser Begriffe.
Welche Rolle spielt das Beispiel der Seifenblase in Moores Beweis?
Das Beispiel der Seifenblase (dessen detaillierter Inhalt im vorliegenden Textauszug fehlt) dient mutmaßlich als Veranschaulichung von Moores Theorie der Außenwelt. Die Arbeit verspricht eine detaillierte Erklärung der Funktion dieses Beispiels im Kontext des Gesamtarguments, welche im Auszug jedoch nicht enthalten ist.
Wie wird Moores Beweis rekonstruiert und kritisiert?
Der Beweis Moores für die Existenz einer Außenwelt wird im fünften Kapitel rekonstruiert (obwohl die Details im Auszug fehlen). Das sechste Kapitel analysiert die Kritik an diesem Beweis, sowohl aus logischer Sicht als auch durch die Einbeziehung von Wittgensteins Argumenten. Wittgensteins Kritik an Moores Beweis und an der Natur des Zweifels wird hier detailliert untersucht.
Welche Rolle spielt Wittgenstein in dieser Arbeit?
Wittgenstein spielt eine wichtige Rolle als kritischer Gegenspieler zu Moore. Seine Argumente werden verwendet, um Moores Beweis für die Existenz einer Außenwelt zu evaluieren und dessen Stärken und Schwächen zu beleuchten. Wittgensteins Kritik wird sowohl auf den Beweis selbst als auch auf die zugrundeliegende Methodik des Zweifels angewendet.
Welche Zielsetzung verfolgt diese Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Moores Beweis für die Existenz einer Außenwelt zu klären, zu analysieren und kritisch zu bewerten. Sie klärt Moores Begrifflichkeiten, rekonstruiert seinen Beweis und setzt diesen in Beziehung zu Wittgensteins Kritik. Die zentralen Themen sind die Klärung von Moores Begriffen, die Analyse seiner Beweisführung, die Rekonstruktion des Seifenblasenbeispiels, eine kritische Auseinandersetzung mit Moores Ansatz und die Einbeziehung von Wittgensteins Argumenten.
- Quote paper
- Michael Pehle (Author), 2005, Aber habe ich eben wirklich bewiesen, dass zwei Hände existierten - Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Beweis einer Außenwelt von George Edward Moore, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43955