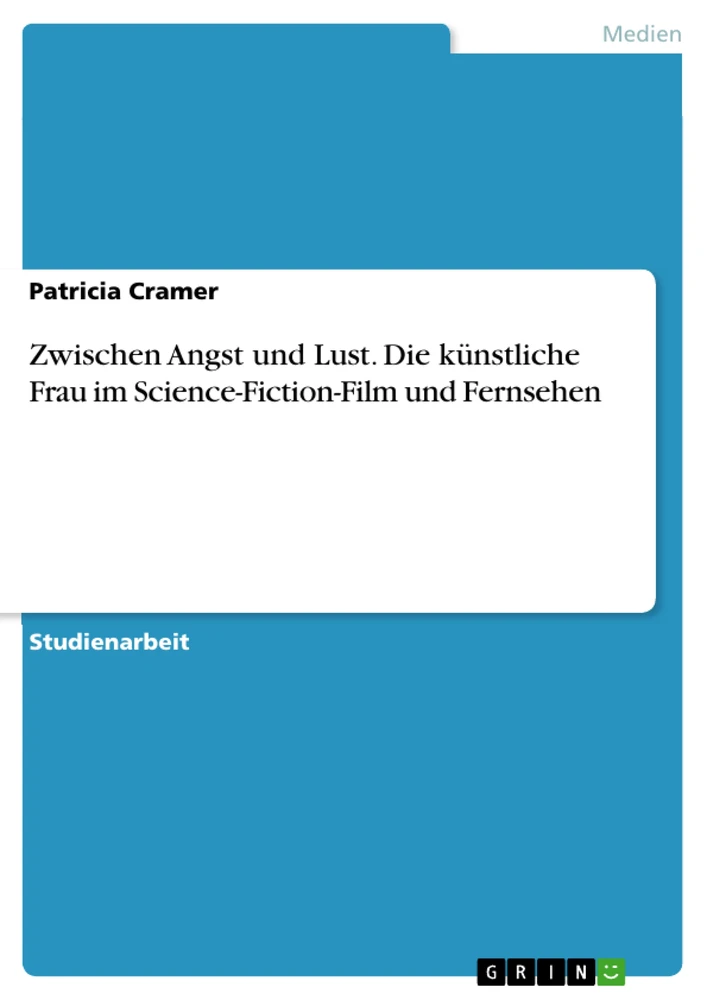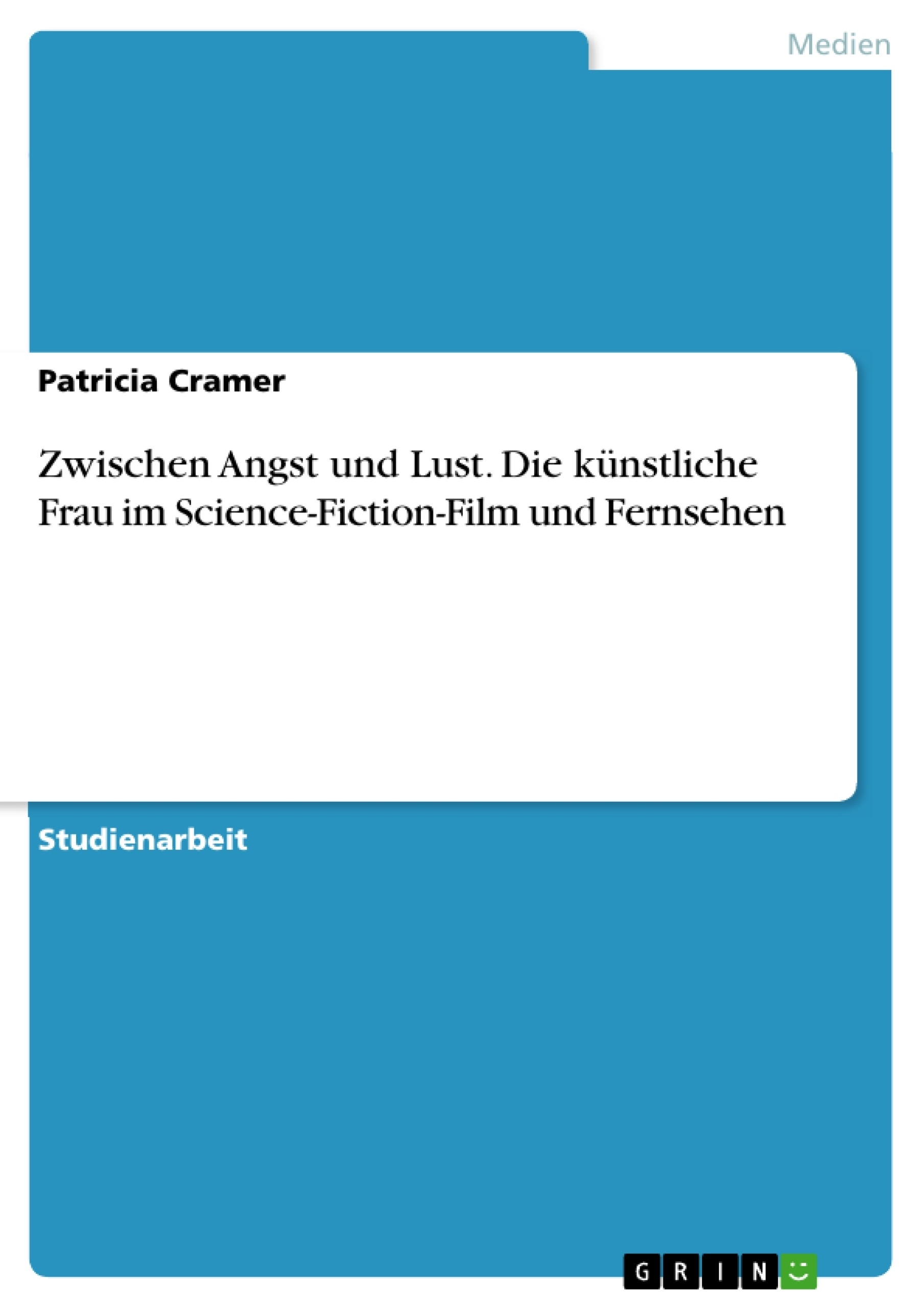Die Idee eines künstlich erschaffenen, menschlichen Wesens beschäftigt die Menschen seit frühster Zeit und in den verschiedensten Formen. Von dem jüdischen Golem, dem alchemistischen Homunkulus über Mary Shelleys Monster von Dr. Frankenstein und der mechanischen Maria von Fritz Lang bis hin zu den Replikanten aus Blade Runner und geklonten Menschen. So unterschiedliche wie die Art des künstlichen Menschen, ist auch der Kontext, in dem er auftaucht und die Probleme, die er mit sich bringt. Er bewegt sich dabei immer zwischen Faszination und Angst. Faszination wegen der Möglichkeit, die Rolle von Gott oder der Evolution einzunehmen. Angst davor, dass eine Grenze überschritten wird und das Geschöpf sich gegen seinen Erschaffer wendet.
In neuerer Zeit sind die künstlichen Wesen vor allem ein Produkt der Science-Fiction. Science-Fiction geht immer von dem aktuellen Forschungsstand aus und spinnt ihn weiter.Dabei geht es aber nicht nur um neue Technologien, sondern auch um gesellschaftliche Entwicklungen. Im Kontext der feministischen bzw. Genderfilmtheorie möchte ich der Frage nachgehen, inwieweit unsere gesellschaftlich etablierten Stereotypen und Rollenbilder sich von denen in Science-Fiction Welten mit künstlichen Menschen unterscheiden. Dabei möchte ich den Fokus nicht nur darauf legen, ob sich diese gleichen oder nicht, sondern auch, ob es einen Unterschied zwischen der Real- und der Filmwelt gibt. Genauer gesagt, ob unsere Geschlechterrollen auf die künstlichen Menschen übertragen werden, obwohl es die innerdiegetische Welt nicht tut.
Ich gehe davon aus, dass beispielsweise ein vollkommen cyborgisierter Mensch, der seine körperliche Erscheinung und Voraussetzungen nach Belieben ändern kann, dem Geschlecht nicht mehr die grundlegende Bedeutung für sein Leben zuschreibt, wie wir es tun. Gender ist zwar kulturell konstruiert, aber das biologische Geschlecht dient in der gesellschaftlichen Diskussion zur Begründung. Auch wenn die Wissenschaft viele Vorurteile widerlegt hat,die sich auf genetische Voraussetzungen gründen, halten sich diese Annahmen im breiten gesellschaftlichen Bewusstsein dank halbwissenschaftlicher Buchveröffentlichungen. Wenn die Genetik nun aber vor der Geburt beeinflussen lässt oder später nachgebessert bzw. umgangen werden kann, müsste dies Auswirkungen auf unser Bild von den Geschlechtern haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Filmtheoretische Basis
- Das Motiv des künstlichen Menschen
- Analyse der Film- und Serienbeispiele
- Wenn die filmische Welt die Geschlechterrollen übernimmt
- Wenn die innerdiegetische Welt nicht mitspielt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Darstellung von künstlichen Frauen in Science-Fiction Film und Fernsehen im Kontext der feministischen bzw. Genderfilmtheorie. Sie untersucht, inwieweit etablierte Geschlechterstereotypen und Rollenbilder in diesen filmischen Welten reproduziert oder subvertiert werden. Ein besonderes Augenmerk liegt darauf, ob sich die Geschlechterrollen auf die künstlichen Frauen übertragen, obwohl die innerdiegetische Welt diese möglicherweise nicht mehr als relevant betrachtet.
- Das Motiv des künstlichen Menschen in der Science-Fiction
- Die Rolle von Geschlechterrollen in Science-Fiction Filmen und Serien
- Die Darstellung künstlicher Frauen in Science-Fiction Filmen und Serien
- Die Beziehung zwischen der realen und der filmischen Welt in Bezug auf Geschlechterrollen
- Die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf unser Bild von den Geschlechtern
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Einleitung und stellt die Fragestellung der Arbeit vor. Es erläutert die Relevanz des Themas und skizziert die Vorgehensweise. In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen für die Analyse erläutert, wobei insbesondere auf Laura Mulveys „Visual Pleasure and Narrative Cinema“ eingegangen wird.
Kapitel 3 analysiert verschiedene Film- und Serienbeispiele. Es untersucht, wie die filmische Welt die Geschlechterrollen übernimmt und inwieweit die innerdiegetische Welt mit diesen Rollenbildern konform geht.
Schlüsselwörter
Künstliche Frau, Science-Fiction, Genderfilmtheorie, Geschlechterrollen, Stereotypen, Film- und Serienanalyse, Laura Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, künstliche Intelligenz, Cyborg, Femininisierung, patriarchale Strukturen.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden künstliche Frauen im Science-Fiction-Film dargestellt?
Oft werden sie zwischen den Extremen „Faszination“ (Lust) und „Angst“ (Gefahr) dargestellt, wobei häufig traditionelle Geschlechterstereotypen auf die künstlichen Wesen übertragen werden.
Was besagt die Genderfilmtheorie in diesem Kontext?
Die Theorie untersucht, wie filmische Welten patriarchale Strukturen reproduzieren, selbst wenn die Handlung in einer technologisch fortgeschrittenen Zukunft spielt.
Warum löst die Idee künstlicher Menschen Angst aus?
Die Angst rührt oft daher, dass der Mensch „Gott spielt“ und die Schöpfung sich gegen ihren Erschaffer wenden könnte (Frankenstein-Motiv).
Welche Rolle spielt Laura Mulvey in dieser Analyse?
Mulveys Konzept des „männlichen Blicks“ (Male Gaze) wird genutzt, um zu zeigen, wie künstliche Frauen im Film oft als Objekte der Betrachtung inszeniert werden.
Könnten Cyborgs herkömmliche Geschlechterrollen auflösen?
Theoretisch ja, da ein technisch veränderbarer Körper biologische Grenzen sprengt. Dennoch zeigt die Arbeit, dass Filme oft an kulturell konstruierten Gender-Bildern festhalten.
- Quote paper
- Patricia Cramer (Author), 2014, Zwischen Angst und Lust. Die künstliche Frau im Science-Fiction-Film und Fernsehen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/439565