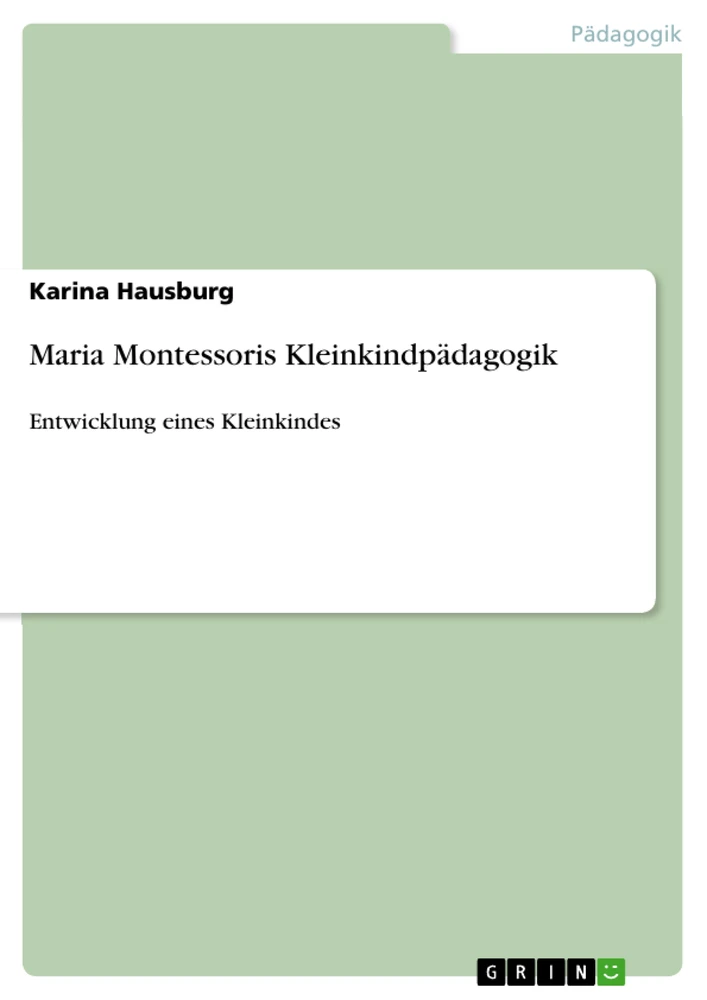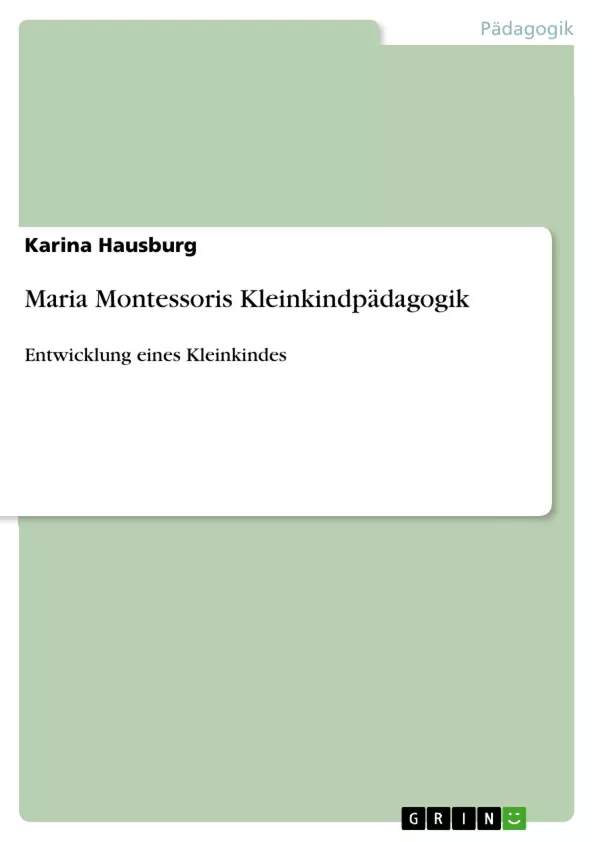Schon vor Jahrzehnten stellten große Pädagogen fest, dass die ersten drei Lebensjahre die prägendsten und lernintensivsten Jahre sind. Leider wird bisher sehr wenig dafür getan, die Erziehung und Bildung in der frühen Kindheit zu verbessern, obwohl es bereits vielfältige Erkenntnisse darüber gibt, wie lernfähig und kompetent Kinder unter drei Jahren bereits sind. Zwar hat jedes Kleinkind, laut SGB VIII, §24, ab August 2013, Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder Tagespflege bereits ab dem vollendeten ersten Lebensjahr, doch dies allein reicht nicht aus um den Bedürfnissen kleiner Kinder gerecht zu werden. Dazu müssen wir erst einmal die Entwicklung und Lernfähigkeit von Kindern unter drei Jahren besser verstehen, um zu überlegen wie die Erziehung und Bildung in der frühen Kindheit aussehen soll. Kleine Kinder brauchen mehr als ihre Mutter bzw. ihre Bezugsperson, Essen, ausreichend Schlaf und frische Luft. Sie brauchen Anreize in ihrer Umgebung und genug Raum für eigene Aktivitäten, damit sie angemessen gefördert werden. Bei der Geburt sind alle Sinne funktionsbereit und das angeborene Lernvermögen richtet sich auf seine neue Erfahrungswelt, Familie, Gesellschaft, Kultur, Umgebung und Natur. Sie geben dem Kind die Erfahrungen für seinen Persönlichkeitsaufbau. Ein Kind lernt von Geburt an, es entdeckt und erforscht bereits mit wenigen Monaten intensiv seine Hände, verfeinert aktiv seine Feinmotorik und übt immer wieder seine Augen-Hand Koordination. Mit zwei Jahren ordnet und sortiert es Gegenstände, was als eine Vorläuferfähigkeit für die Mathematik dient. In den ersten drei Lebensjahren verfeinern Kinder alle ihre Sinne und Bewegungen, wodurch sie ihr Gehirn zu einem intelligenten Denkorgan strukturieren. Sie tun dies unbewusst, durch ihre inneren Anlagen und ihren besonderen Lernhunger. Doch diese Anlagen müssen durch Anreize aus der Umwelt aktiviert werden. Somit nimmt die Umwelt, mit der ein Kleinkind in interaktiven Austausch steht, großen Einfluss auf die gesamte Entwicklung und Bildung. Sie sollte auf kindliche Bedürfnisse abgestimmt sein und keine Entwicklungs- und Lernphasen ungenutzt verstreichen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anthropologisches Menschenbild Maria Montessoris und die Förderung Null-bis Dreijähriger
- Wie Kleinkinder sich entwickeln
- Der innere Bauplan
- Die sensiblen Phasen
- Zusammenfassungen der kindlichen Entwicklung
- Bestätigung der Arbeit Maria Montessori mit moderner Wissenschaft und
- Montessori-Pädagogik und Fröbels Einflüsse
- Montessori und Pikler
- Montessori und Ko-Konstruktivistische Ansatz
- Kleinkindgerechte Umgebung
- Kleinkindgerechte Umgebung
- Die Aufgaben der Erzieherin/ des Erziehers bei der Erziehung der Null- bis Dreijährigen
- Gestaltung der Räume
- Kleinkinder einfühlsam beobachten
- Freiheit als pädagogisches Prinzip
- Arbeit und Spiel
- Das Spiel der Null- bis Dreijährigen
- Arbeit aus der Sicht Maria Montessori
- Gestaltung und Vergleich von Spielräumen
- Grundlagen der Spielraumidee
- Montessori-Spielraum
- Ziel
- Rolle der Eltern
- Räumliche Gestaltung
- Pikler-Spielraum
- Ziel
- Rolle der Eltern
- Räumliche Gestaltung
- Zusammenfassung und persönliches Resümee
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Werk befasst sich mit der Förderung von Kindern im Alter von null bis drei Jahren, insbesondere im Hinblick auf die Pädagogik von Maria Montessori. Es soll die Bedeutung dieser frühen Entwicklungsphase für die gesamte kindliche Entwicklung beleuchten und aufzeigen, wie eine kindgerechte Umgebung gestaltet werden kann, die die natürliche Lernfreude und -fähigkeit der Kleinkinder optimal unterstützt.
- Die Bedeutung der frühen Kindheit für die gesamte Entwicklung
- Das anthropologische Menschenbild Maria Montessoris
- Die Entwicklungsphasen und Lernbedürfnisse von Kleinkindern
- Die Gestaltung einer kindgerechten Umgebung
- Die Rolle von Arbeit und Spiel in der frühkindlichen Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und unterstreicht die besondere Bedeutung der ersten drei Lebensjahre für die Entwicklung des Kindes. Sie beleuchtet die Lernfähigkeit und Kompetenz von Kindern unter drei Jahren und zeigt auf, warum eine bessere Förderung in dieser Phase notwendig ist. Anschließend wird das anthropologische Menschenbild Maria Montessoris vorgestellt, das die Eigenaktivität und Lernbereitschaft von Kindern in den Mittelpunkt stellt. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung der frühen Kindheit für die Entwicklung des Kindes und betont die Notwendigkeit, die natürlichen Bedürfnisse der Kleinkinder zu berücksichtigen.
Das Kapitel "Wie Kleinkinder sich entwickeln" beschäftigt sich mit den Entwicklungsphasen und Lernbedürfnissen von Kleinkindern. Es werden der innere Bauplan, die sensiblen Phasen und die verschiedenen Entwicklungsstufen erläutert. Das Kapitel zeigt, wie die Arbeit Maria Montessoris durch moderne wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigt wird und beleuchtet die Einflüsse von Fröbel, Pikler und dem ko-konstruktivistischen Ansatz auf die Montessori-Pädagogik.
Im Kapitel "Kleinkindgerechte Umgebung" geht es um die Gestaltung einer Umgebung, die den Bedürfnissen von Kleinkindern gerecht wird. Es werden Aspekte wie die Gestaltung der Räume, die Beobachtung der Kinder und das pädagogische Prinzip der Freiheit behandelt. Das Kapitel "Arbeit und Spiel" beleuchtet die Bedeutung von Arbeit und Spiel für die Entwicklung von Kleinkindern. Es werden das Spielverhalten von Kindern unter drei Jahren sowie Maria Montessoris Sicht auf die Rolle der Arbeit in der frühen Kindheit beschrieben. Das Kapitel "Gestaltung und Vergleich von Spielräumen" widmet sich der Gestaltung von Montessori- und Pikler-Spielräumen. Es werden die Ziele, die Rolle der Eltern und die räumliche Gestaltung der Spielräume in beiden Pädagogiken verglichen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieses Textes sind: Montessori-Pädagogik, frühkindliche Entwicklung, Kleinkinder, kindgerechte Umgebung, Lernbedürfnisse, sensible Phasen, Spiel, Arbeit, Selbstständigkeit, Freiheit, Beobachtung, Entwicklungspsychologie, Anthropologie, Bildung, Erziehung.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind die ersten drei Lebensjahre laut Montessori so wichtig?
Es sind die lernintensivsten Jahre, in denen das Kind durch seinen „inneren Bauplan“ und einen „besonderen Lernhunger“ die Grundlagen seiner Persönlichkeit und Intelligenz aufbaut.
Was versteht Maria Montessori unter „sensiblen Phasen“?
Das sind zeitlich begrenzte Zeiträume in der Entwicklung, in denen das Kind eine besondere Empfänglichkeit für den Erwerb bestimmter Fähigkeiten (z. B. Sprache, Ordnung, Bewegung) besitzt.
Wie sollte eine kleinkindgerechte Umgebung gestaltet sein?
Die Umgebung sollte Anreize bieten, sicher sein und genug Raum für eigenständige Aktivitäten lassen, damit das Kind seine Feinmotorik und Sinne aktiv trainieren kann.
Was ist der Unterschied zwischen Montessori- und Pikler-Pädagogik?
Beide betonen die Selbstständigkeit. Pikler legt einen besonderen Fokus auf die freie Bewegungsentwicklung und die beziehungsvolle Pflege, während Montessori stärker die strukturierte Umgebung und das „Material“ betont.
Welche Rolle hat die Erzieherin bei Kleinkindern?
Die Erzieherin ist eine achtsame Beobachterin und Vorbereiterin der Umgebung. Sie greift nur dann ein, wenn nötig, und lässt dem Kind die Freiheit, seinen eigenen Lernweg zu gehen.
- Arbeit zitieren
- Karina Hausburg (Autor:in), 2017, Maria Montessoris Kleinkindpädagogik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/439567