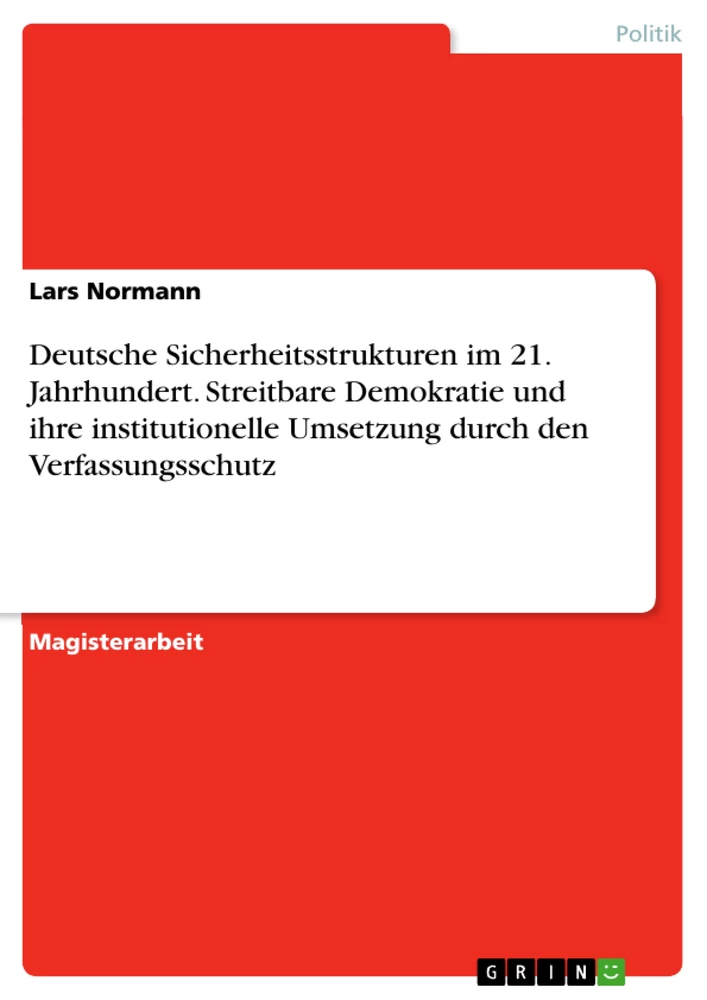Im Spiegel der Geschichte und der politischen Theorie bildet das Konzept der streitbaren Demokratie und ihr institutioneller Ausfluss der administrative Verfassungsschutz Grundpfeiler des Rechtsstaates und der Demokratie in Deutschland. Die kritische Genese des Verfassungsprinzips erläutert nicht nur Aufbau und Geschichte der Bundesrepublik, aus diesem Konzept lassen sich die Elemente der freiheitlich demokratischen Grundordnung und der inneren Sicherheit ableiten.
Nach den islamistischen Terrorangriffen vom 11. September 2001 und 11. März 2004 wurden auch in Deutschland die institutionellen Sicherheitsstrukturen einem Reformprozess unterworfen. „Kein Staat darf es zulassen, dass sein Volk terroristischen Angriffen schutzlos ausgeliefert ist und er damit erpressbar wird. Vorrangiges Ziel muss es sein, bereits die Vorbereitung terroristischer Anschläge so frühzeitig zu erkennen, dass sie verhindert werden können.“ Diesen von dem ehemaligen Präsidenten des BfV Eckart Werthebach aufgezählten Zielsetzungen stehen die Problematiken aus der aktuellen Reformdebatte gegenüber. Exemplarisch ist hier der „Kompetenzwirrwarr“ zu nennen, welcher sich u.a. aus dem schlichten Vorhandensein einer Vielzahl von Sicherheitsbehörden ergibt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Diskussion um das Trennungsgebot in Verbindung mit dem Recht zur vorverlagerten Ermittlungsmöglichkeit in Verdachtsfällen.
Diese Untersuchung soll das Konzept der streitbaren Demokratie als grundlegende Theorie für die Sicherheitsinstitutionen, also auch des Inlandsgeheimdienstes Verfassungsschutz, in Deutschland kritisch darstellen. Am Beispiel der praktischen Arbeit des institutionellen Verfassungsschutzes wird fokussiert wie dieses Konzept umgesetzt wird. Anschließend erfolgt eine Untersuchung der aktuellen Reformkonzeptionen anhand einer Zeitungsanalyse. Schwerpunkte liegen hier in der Darstellung der Aufgabenbereiche des Verfassungsschutzes bezüglich des Islamismus und den unterschiedlichen Reformen und Vorschlägen vor und nach den Terroranschlägen. Die jährlichen Verfassungsschutzberichte sind die wichtigsten Publikationen der Verfassungsschutzämter. Daher ist ein Vergleich zwischen einer Auswahl von Bundes- und Landesverfassungsschutzberichten bzgl. islamistischen Aktivitäten - ebenfalls vor und nach den Terroranschlägen - sinnvoll für die Darstellung konkreter Arbeit des Verfassungsschutzes.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Streitbare Demokratie
- Konzept der streitbaren Demokratie
- Theoretische und geistesgeschichtliche Grundlagen
- Die grundlegende Rechtsprechung zur streitbaren Demokratie
- Das KPD-Urteil
- Das Soldaten- und das Abhörurteil
- Der „Radikalenbeschluss“
- Der „Radikalenerlass“
- Eigenständige rechtliche Bedeutung der „streitbaren Demokratie“
- Abgrenzung Radikalismus und Extremismus
- Freiheitlich demokratische Grundordnung
- Verbindung zwischen streitbarer Demokratie/fdGO und weiteren Kritikpunkten
- Konzept der streitbaren Demokratie
- Der administrative Verfassungsschutz
- Rechtliche Grundlagen
- Das Bundesamt, die Landesämter und das Trennungsgebot
- Aufgaben des administrativen Verfassungsschutzes
- Ausländerextremismus, Islamismus und Terrorismus
- Spionageabwehr und Geheimschutz
- Religiöser Extremismus
- Organisierte Kriminalität
- Publikationen des Verfassungsschutzes
- Kontrolle des Verfassungsschutzes
- Verwaltungsinterne Kontrolle
- Der Datenschutzbeauftragte
- Parlamentarische Kontrolle
- Das Parlamentarische Kontrollgremium
- Große und Kleine Anfragen
- Gerichtliche Kontrolle
- Kontrolle durch die Öffentlichkeit
- Reformkonzepte
- Chronologische Zeitungsanalyse
- Zeitungsanalyse Jahrgang 2000
- Zeitungsanalyse Jahrgang 2001
- Zeitungsanalyse Jahrgang 2002
- Zeitungsanalyse Jahrgang 2003
- Zeitungsanalyse Jahrgang 2004
- Zeitungsanalyse Jahrgang 2005
- Ergebnisse der Zeitungsanalyse
- Chronologische Zeitungsanalyse
- Analyse der Verfassungsschutzberichte
- Der Untersuchungsgegenstand
- Aufbau der Verfassungsschutzberichte
- Islamismus in den Bundesverfassungsschutzberichten 2000 und 2003
- Islamismus in den Landesverfassungsschutzberichten 2000 und 2003
- Vergleichsergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der streitbaren Demokratie und seiner Umsetzung durch den administrativen Verfassungsschutz in Deutschland. Sie untersucht die historische Entwicklung und die rechtlichen Grundlagen des Konzepts, analysiert die Aufgabenbereiche des Verfassungsschutzes und beleuchtet die aktuelle Reformdebatte im Kontext des Islamismus und des Terrorismus.
- Das Konzept der streitbaren Demokratie als Grundlage für die Sicherheitsstrukturen in Deutschland
- Die Aufgaben und Herausforderungen des Verfassungsschutzes im 21. Jahrhundert
- Die Reformkonzepte für den Verfassungsschutz nach den Terroranschlägen von 2001 und 2004
- Die Rolle des Islamismus und des Terrorismus in der Arbeit des Verfassungsschutzes
- Die Bedeutung der Verfassungsschutzberichte für die öffentliche Diskussion über die Sicherheitsstrukturen in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Konzept der streitbaren Demokratie und den administrativen Verfassungsschutz als grundlegende Elemente des Rechtsstaates und der Demokratie in Deutschland vor. Sie beleuchtet die Relevanz der Thematik im Kontext des islamistischen Terrorismus und der Reformdiskussionen.
- Streitbare Demokratie: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept der streitbaren Demokratie und seinen theoretischen und historischen Grundlagen. Es analysiert die Rechtsprechung zur streitbaren Demokratie, die Abgrenzung von Radikalismus und Extremismus sowie die Verbindung zum Konzept der freiheitlich demokratischen Grundordnung.
- Der administrative Verfassungsschutz: Dieses Kapitel beschreibt die rechtlichen Grundlagen, die Aufgabenbereiche und die Kontrollmechanismen des Verfassungsschutzes. Es beleuchtet die Rolle des Verfassungsschutzes bei der Bekämpfung von Extremismus, Terrorismus, Spionage und organisierter Kriminalität sowie die Bedeutung der öffentlichen Kontrolle.
- Reformkonzepte: Dieses Kapitel untersucht die aktuelle Reformdebatte im Zusammenhang mit dem Verfassungsschutz anhand einer chronologischen Zeitungsanalyse. Es beleuchtet die verschiedenen Reformen und Vorschläge vor und nach den Terroranschlägen und analysiert die Ergebnisse der Zeitungsanalyse.
- Analyse der Verfassungsschutzberichte: Dieses Kapitel analysiert die Verfassungsschutzberichte im Hinblick auf islamistische Aktivitäten. Es vergleicht die Berichte vor und nach den Terroranschlägen und zieht daraus Schlussfolgerungen für die Arbeit des Verfassungsschutzes.
Schlüsselwörter
Streitbare Demokratie, Verfassungsschutz, Innere Sicherheit, Islamismus, Terrorismus, Rechtsextremismus, Linksextremismus, Reformkonzepte, Verfassungsschutzberichte, Datenschutz, Kontrolle, Parlamentarische Kontrolle, Zeitungsanalyse, Islamistische Aktivitäten.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das Konzept der "streitbaren Demokratie"?
Es ist ein Verfassungsprinzip der Bundesrepublik Deutschland, das besagt, dass der Staat aktiv gegen Bestrebungen vorgehen darf, die die freiheitlich demokratische Grundordnung abschaffen wollen.
Welche Rolle spielt der Verfassungsschutz in diesem Konzept?
Der Verfassungsschutz ist der administrative Ausfluss der streitbaren Demokratie; er sammelt Informationen über extremistische Bestrebungen, um die innere Sicherheit zu gewährleisten.
Was ist das "Trennungsgebot"?
Das Trennungsgebot schreibt die organisatorische und befugnisrechtliche Trennung zwischen Polizei (Exekutive) und Nachrichtendiensten (Information) vor.
Wie wird der Verfassungsschutz kontrolliert?
Die Kontrolle erfolgt verwaltungsintern, durch Datenschutzbeauftragte, parlamentarische Gremien (wie das PKGr), Gerichte und die Öffentlichkeit.
Warum gab es nach 2001 Reformdebatten im Sicherheitsbereich?
Die Terroranschläge vom 11. September 2001 führten zu einer Neubewertung der Bedrohung durch den Islamismus und zu Diskussionen über Kompetenzwirrwarr und vorverlagerte Ermittlungen.
Was sind die wichtigsten Publikationen der Verfassungsschutzämter?
Die jährlichen Verfassungsschutzberichte des Bundes und der Länder sind die zentralen Publikationen zur Aufklärung der Öffentlichkeit.
- Quote paper
- Lars Normann (Author), 2005, Deutsche Sicherheitsstrukturen im 21. Jahrhundert. Streitbare Demokratie und ihre institutionelle Umsetzung durch den Verfassungsschutz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44051