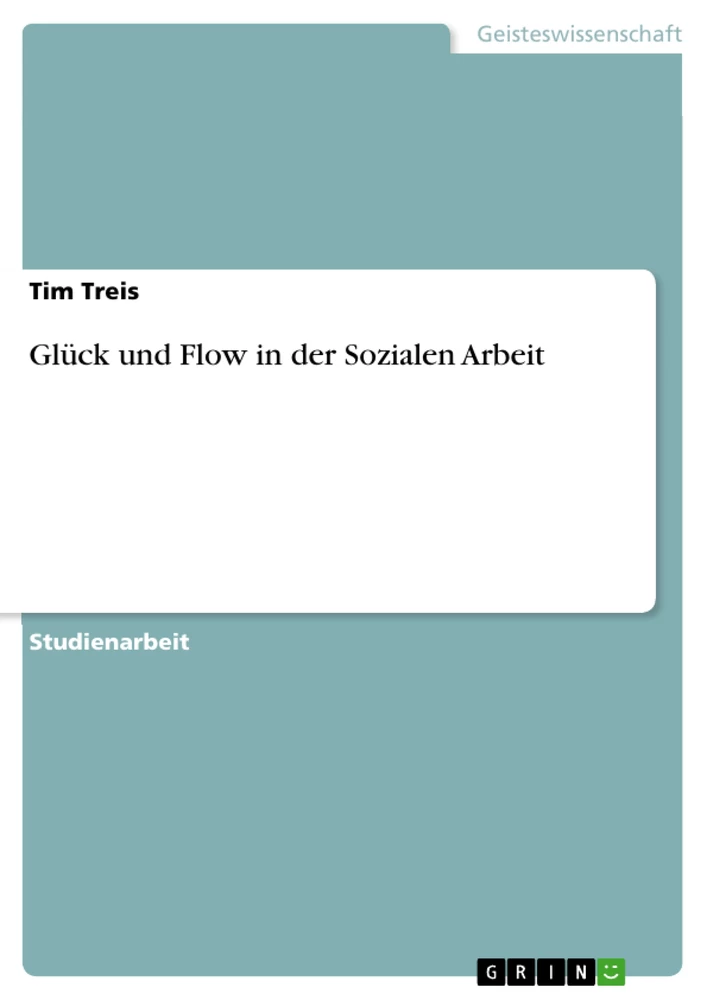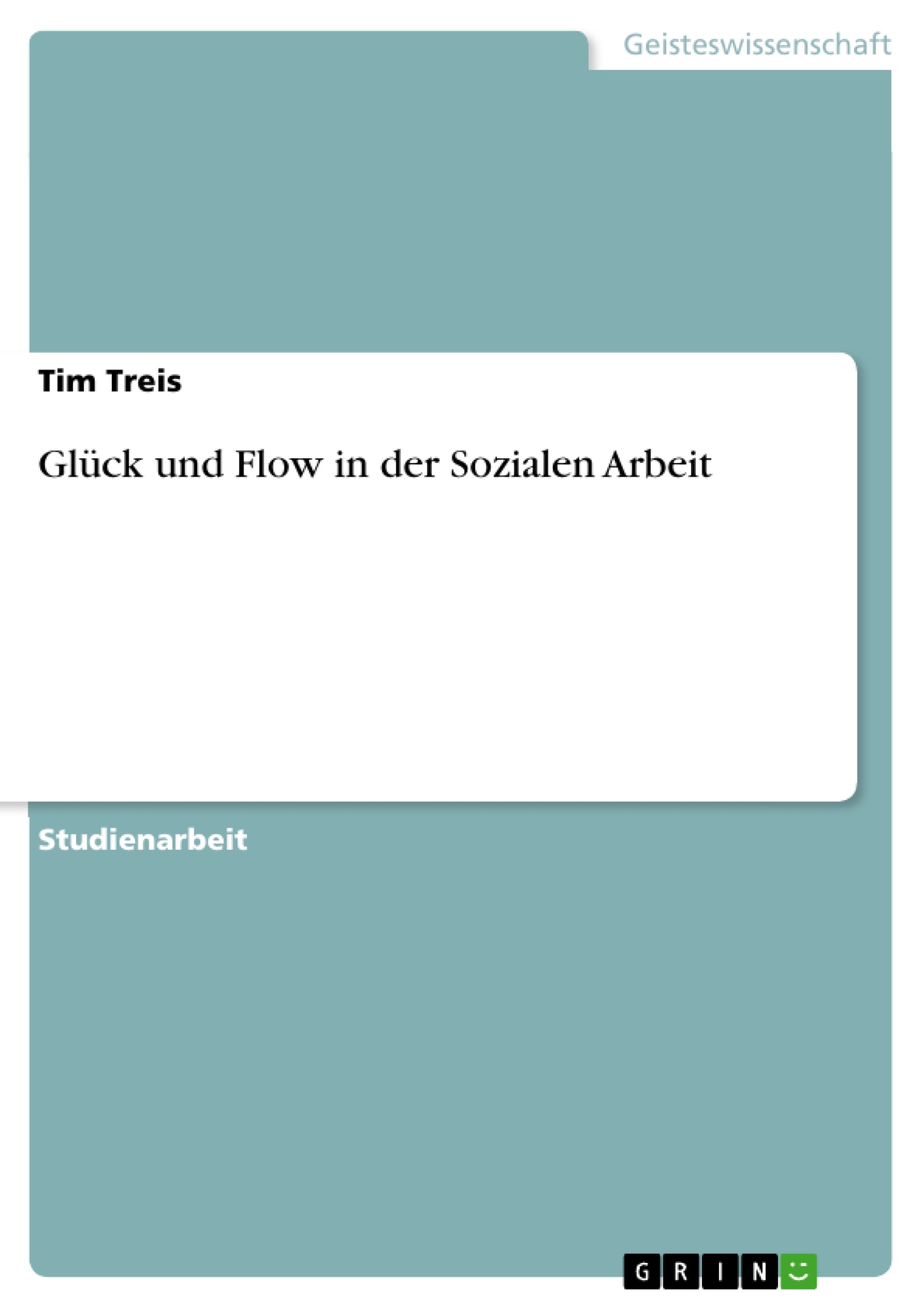Die Suche nach dem menschlichen Glück ist wesentlich älter als man zunächst denkt. Schon die Griechen setzten sich in der Antike damit außeinander. So war bereits für den berühmten Aristoteles die Glückseeligkeit nichts anderes als das Ziel und Ende allen menschlichen Tuns. Auch heute boomt die Glücksforschung wieder. Gleich auf mehreren verschiedenen Ebenen der Wissenschaft versucht man das Glück zu erforschen. Es begeben sich verschiedenste wissenschaftliche Disziplinen auf die Suche nach dem Glück wie z.B. die Psychologie, Genetik, Soziologie, Neurologie und auch die Ökonomie. Wobei die Forscher den schwammigen Begriff "Glück" lieber anders definieren. Denn Glück kann zuvieles bedeuten. "Glück haben" oder auch "glücklich sein" kann damit gemeint sein. Im englischen Spachgebrauch ist dies deutlicher zu trennen. Hier steht "luck" für Glück haben und "happy" für glücklich sein. Im deutschen Sprachgebrauch fällt beides unter den Begriff Glück. Die Forschung setzt sich jedoch mit dem Thema des "glücklich sein" bzw "happy" außeinander und spricht deshalb meisten vom "subjektivem Wohlbefinden" anstelle von "Glück".
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in das Seminarthema
- Glück und Zufriedenheit oder Flow?
- Die Flow-Theorie
- Aspekte des Glücks im Berufsfeld der Sozialen Arbeit
- Flow im Berufsfeld der Sozialen Arbeit
- Negative Aspekte von Flow
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Vorlesungsreihe „Glück und Unglück – wie planbar ist unser Leben?“, die von Prof. Dr. Michael Borg-Laufs eröffnet wurde, befasst sich mit der Erforschung des subjektiven Wohlbefindens aus verschiedenen Perspektiven. Sie analysiert die Komplexität des Glücks und untersucht, inwieweit es messbar und beeinflussbar ist.
- Zusammenhang zwischen Glück und Zufriedenheit
- Die Rolle des Flow-Erlebens für das subjektive Wohlbefinden
- Faktoren, die das Glücksempfinden beeinflussen, wie z.B. Gesundheit, Einkommen, soziale Kontakte und Alter
- Kritische Betrachtung von Glücksmessungen und Studien zum subjektiven Wohlbefinden
- Zusammenhänge zwischen Glück und Arbeit im Berufsfeld der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung in das Seminarthema
Die Einführung beleuchtet die lange Geschichte der Suche nach Glück, beginnend mit der Antike und Aristoteles. Die Vorlesungsreihe untersucht das subjektive Wohlbefinden aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven, u.a. der Psychologie, Soziologie, Neurologie und Ökonomie. Der Fokus liegt auf dem Begriff des „glücklich sein“ bzw. „happy“ im Sinne des subjektiven Wohlbefindens.
Glück und Zufriedenheit oder Flow?
Prof. Dr. Michael Borg-Laufs stellt in seiner Vorlesung verschiedene Fragen zur Natur des Glücks: Kann man mit Depressionen glücklich sein? Ist Glück subjektiv? Kann Glück etwas Dauerhaftes sein? Er argumentiert, dass Glück durch Zufriedenheit, Sicherheit und Gemeinschaftsgefühl entsteht. Anhand einer Allensbach-Studie werden verschiedene Faktoren, die mit Glück assoziiert werden, wie z.B. Gesundheit, Zufriedenheit, Familienleben und finanzielle Absicherung, präsentiert. Borg-Laufs unterscheidet zwischen Zufriedenheit als kognitiver Bewertung und Glück als intensiver Emotion.
Weiterhin untersucht Borg-Laufs die Messbarkeit von Glück und kritisiert die Grenzen verschiedener Messmethoden wie z.B. Erlebnisstichprobenmethoden (ESM) und objektive Messungen. Er stellt fest, dass selbst wenn wir nicht permanent emotionale Glücksgefühle haben, wir dennoch in unserem Leben überwiegend glücklich sind, was durch eine Studie der Bertelsmann-Stiftung belegt wird.
Der Vortrag beleuchtet auch den Zusammenhang zwischen Glück und verschiedenen Faktoren wie Alter, Wohlstand und Gesundheit. Dabei wird deutlich, dass das Glücksempfinden im Laufe des Lebens schwankt, aber nicht zwingend mit Gesundheit zusammenhängt.
An dieser Stelle wird das SOK-Modell von Baltes und Baltes erwähnt, welches die Verbindung zwischen Fähigkeiten, Glück und bestimmten Tätigkeiten aufzeigt.
Schlüsselwörter
Die Vorlesungsreihe beschäftigt sich mit dem Konzept des subjektiven Wohlbefindens, dem Einfluss von Faktoren wie Zufriedenheit, Flow, Gesundheit, Einkommen, sozialen Kontakten und Alter auf das Glücksempfinden sowie der Kritik an Glücksmessungen und Studien zum subjektiven Wohlbefinden. Weitere wichtige Begriffe sind die Flow-Theorie, das SOK-Modell, ESM-Methoden und die Allensbach-Studie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen „luck“ und „happy“?
Im Englischen steht „luck“ für das Zufallsglück (Glück haben), während „happy“ den Zustand des Glücklichseins (subjektives Wohlbefinden) beschreibt.
Was besagt die „Flow-Theorie“?
Flow bezeichnet das beglückende Erleben eines restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit, bei der Anforderung und Fähigkeit im Einklang stehen.
Welche Faktoren beeinflussen das subjektive Wohlbefinden?
Wichtige Faktoren sind laut Studien Gesundheit, finanzielle Absicherung, soziale Kontakte, das Familienleben und das Lebensalter.
Was ist das SOK-Modell von Baltes?
Das SOK-Modell (Selektion, Optimierung, Kompensation) erklärt, wie Menschen ihre begrenzten Ressourcen nutzen, um trotz Einschränkungen Wohlbefinden zu erreichen.
Wie wird Glück in der Wissenschaft gemessen?
Methoden umfassen die Erlebnisstichprobenmethode (ESM), kognitive Bewertungen der Lebenszufriedenheit und objektive neurologische Messungen.
Welche Bedeutung hat Flow für die Soziale Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie Flow-Erlebnisse im Berufsalltag von Sozialarbeitern zur Arbeitszufriedenheit beitragen können, beleuchtet aber auch negative Aspekte.
- Quote paper
- Tim Treis (Author), 2018, Glück und Flow in der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/441276