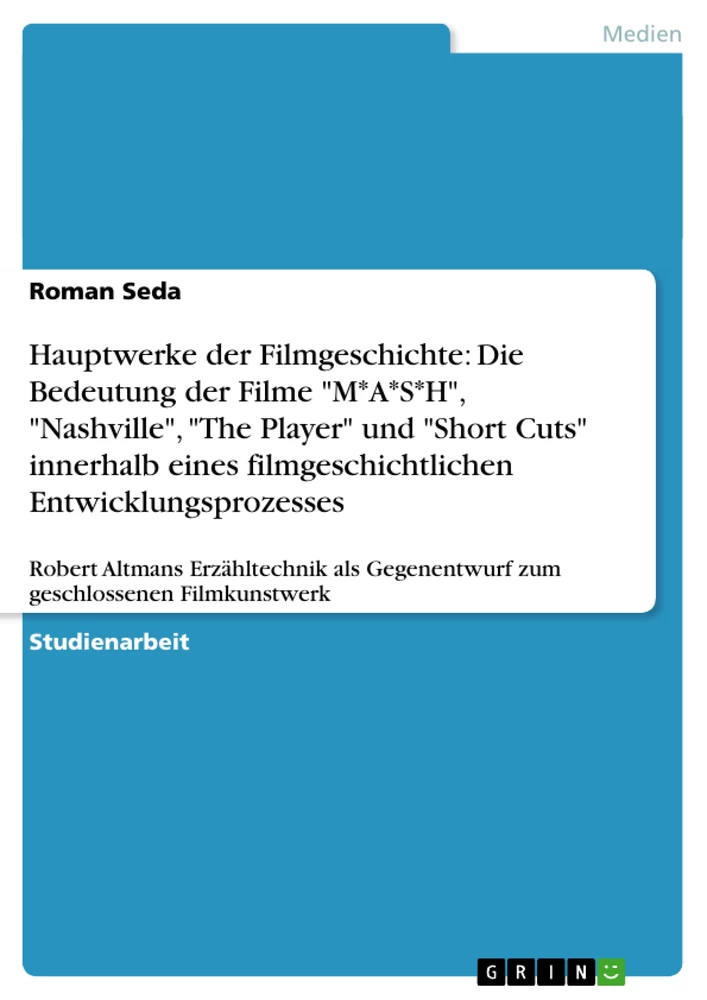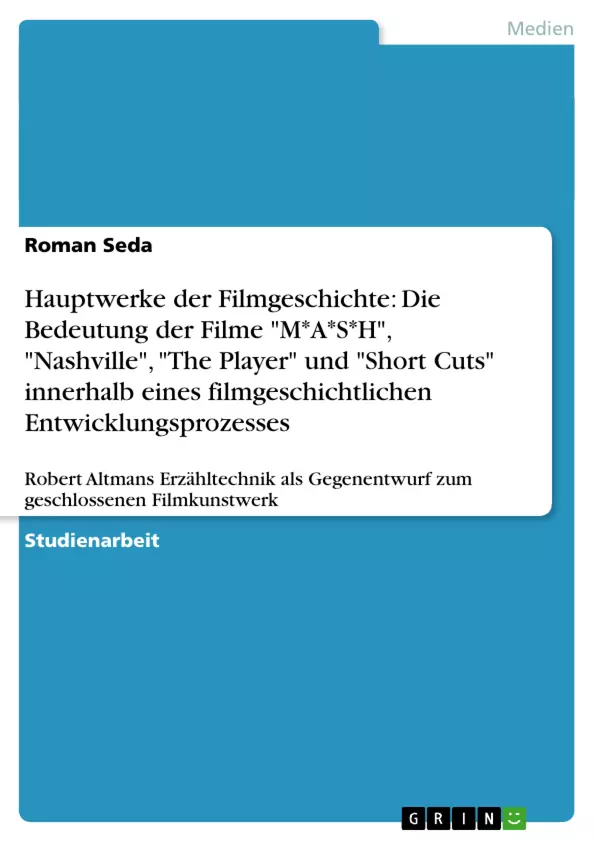1. Einleitung
1.1 Allgemeines
Im Rahmen des längerfristig angelegten Hauptseminars „Hauptwerke der Theater-, Film- und Fernsehgeschichte“ verfolgen die Theater- und Medienwissenschaftsstudenten in Erlangen ein ehrgeiziges Projekt, das zum einen schlankweg den historischen Blick für problematische Fragestellungen innerhalb des eigenen wissenschaftlichen Studiums schärfen soll und zum anderen (darüber hinaus) nutzbringende Studienmaterialien erarbeiten will. Neben dem wissenschaftlichen Anspruch besteht das erklärte Hauptziel des Vorhabens darin, den vom Institut für Theater- und Medienwissenschaft aufgestellten Kanon bestimmter Werke der Theater-, Film- und Fernsehgeschichte, die es im Verlauf des Studiums zu rezipieren gilt, auf ihre Relevanz hinsichtlich der Geschichte des jeweiligen Mediums zu überprüfen. Dazu ist die Sichtung allgemeiner und spezieller Sekundärliteratur erforderlich, was einen gewissenhaften Umgang mit dem historischen Quellenmaterial bezüglich der Werksgeschichte inklusive seiner Rezeption und Produktion voraussetzt. Neben der Analyse geschichtlicher Fakten, mit der die grundsätzliche Problematik einhergeht, das spezifische Werk hinsichtlich der verschiedensten Ansätze in eine angemessene Relation zu stellen, kreist die Auseinandersetzung vor allem um die zentrale Fragestellung, warum das zu bearbeitende Werk als Hauptwerk der jeweiligen Einzelmediengeschichte im Sinne eines objektiv-begründbaren Kanons gilt. Die Schwierigkeit hierbei besteht darin, die subjektiven Einschätzungen von einem Werk innerhalb der Rezeptionsgeschichte aus der historischen Distanz heraus zu erfassen, objektiv zu beschreiben und somit ein möglichst wertfreies und umfassendes Bild des Hauptwerkes, seiner jeweiligen Zeit und deren Phänomene zu erhalten.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeines
- Vorzüge und Nachteile einer Kanonisierung
- Vier Filme Altmans als Hauptwerk im Gesamtzusammenhang
- Der autorspezifische Kontext - über Robert Altman
- Aufbruchsstimmungen in Hollywood
- Altman als Erzählkünstler
- Frühzeitiges Ende und verspätetes Comeback
- Extensive Gesellschaftsporträts und intensive Psychogramme
- Biographie bis 1970 (in Stichpunkten)
- Filmographie (als Autor und/oder Regisseur und/oder Produzent)
- Ausgewählte Fragen an Robert Altman. [OPTIONAL]
- M*A*S*H (1970)
- Produktion
- Der (sozial-)historische Kontext: New Hollywood – Robert Altman und die 70er
- Produktionsnotizen
- Fragen an Robert Altman zu M*A*S*H . .[OPTIONAL]
- Werk
- Inhalt - Story
- Plot - Interpunktion
- Cast
- Rezeption
- Ökonomischer Kontext
- Preise und Pressestimmen
- Wirkungsgeschichtliche Dimension
- NASHVILLE (1975)
- Produktion
- Der (sozial-)historische Kontext: New Hollywood - Altman und die 70er (siehe 3.1.1)
- Produktionsnotizen
- Fragen an Robert Altman zu Nashville . . [OPTIONAL]
- Werk
- Inhalt - Story
- Plot - Interpunktion
- Cast
- Rezeption
- Ökonomischer Kontext
- Preise und Pressestimmen
- Wirkungsgeschichtliche Dimension
- THE PLAYER (1992)
- Produktion
- (New) Hollywood und das Kino im Wandel – Altman und die 90er Jahre (siehe 6.1.1)
- Produktionsnotizen
- Fragen an Robert Altman zu The Player... [OPTIONAL]
- Werk
- Inhalt - Story
- Plot - Interpunktion
- Cast
- Rezeption
- ökonomischer Kontext
- Preise und Pressestimmen
- Wirkungsgeschichtliche Dimension
- SHORT CUTS (1993)
- Produktion
- (New) Hollywood und das Kino im Wandel - Altman und die 90er Jahre
- Produktionsnotizen
- Fragen an Robert Altman zu Short Cuts ... [OPTIONAL]
- Werk
- Inhalt - Story
- Plot - Interpunktion
- Cast
- Sequenzprotokoll
- Rezeption
- Ökonomischer Kontext
- Preise und Pressestimmen
- Wirkungsgeschichtliche Dimension
- Gemeinsame Hauptmerkmale von M*A*S*H, Nahsville, The Player und Short Cuts - Altman als Begründer und Wegbereiter eines (Sub-)Genres
- Altmans Stil/Handschrift: das Experiment mit offenen Erzählformen
- Altmans Erzähltechnik: Bildmontage und Altmanscope
- Offene Kompositionsformen (Eco)
- Merkmale offener Formen (Pfister/Klotz)
- Die offene Komposition – eine besondere Art der Kommunikation (Wuss)
- Fragen an Altman zur Erzählstruktur und der Leidenschaft des Inszenierens
- Altmans Arbeitsweise
- Die Brechung des Buches
- Dreharbeiten im Ensemble: Altman als Schauspielerregisseur
- Der Kreativprozess im Schneideraum
- Altman als Satiriker der Gesellschaft: Enthüllung von Sein und Schein
- Gesellschaftskritik in Altman-Filmen
- Fragen an Altman zur Thematik von Short Cuts und seiner Filme im Allgemeinen
- Die Entwicklung des (New) Hollywood-Kinos
- Robert Altmans Erzähltechnik als Gegenentwurf zum klassischen Hollywood-Kino
- Die Bedeutung von M*A*S*H, Nashville, The Player und Short Cuts als Hauptwerke von Robert Altman
- Die gesellschaftliche Relevanz der Filme Altmans
- Die Rezeption der vier Filme und deren Einfluss auf die Filmgeschichte
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar, indem sie die Bedeutung der Kanonisierung von Filmen sowie die Besonderheiten der Erzähltechnik von Robert Altman beleuchtet.
- Vier Filme Altmans als Hauptwerk im Gesamtzusammenhang: Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über Robert Altmans Karriere, seine Filme und seine Arbeitsweise.
- M*A*S*H (1970): Dieses Kapitel analysiert die Produktion, den Inhalt, die Rezeption und die Bedeutung von M*A*S*H im Kontext des New Hollywood-Kinos.
- NASHVILLE (1975): Dieses Kapitel setzt sich mit der Produktion, dem Inhalt, der Rezeption und der Bedeutung von Nashville auseinander und beleuchtet dabei auch den sozialen und historischen Kontext des Films.
- THE PLAYER (1992): Dieses Kapitel analysiert die Produktion, den Inhalt, die Rezeption und die Bedeutung von The Player im Kontext der Veränderungen des Hollywood-Kinos in den 1990er Jahren.
- SHORT CUTS (1993): Dieses Kapitel analysiert die Produktion, den Inhalt, die Rezeption und die Bedeutung von Short Cuts und beleuchtet dabei die filmtechnischen Besonderheiten des Films.
- Gemeinsame Hauptmerkmale von M*A*S*H, Nahsville, The Player und Short Cuts - Altman als Begründer und Wegbereiter eines (Sub-)Genres: Dieser Abschnitt analysiert die gemeinsamen Merkmale der vier Filme und zeigt, wie Altman mit seinen offenen Erzählformen und seiner spezifischen Arbeitsweise ein neues Genre des Films etablierte.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Bedeutung der Filme M*A*S*H, Nashville, The Player und Short Cuts von Robert Altman innerhalb eines filmgeschichtlichen Entwicklungsprozesses. Ziel ist es, Robert Altmans Erzähltechnik als Gegenentwurf zum geschlossenen Filmkunstwerk zu analysieren und zu zeigen, wie seine Filme die konventionellen Erzählformen und -strukturen des klassischen Hollywood-Kinos durchbrechen. Dabei werden die vier Filme im Kontext von Robert Altmans Werk und im Verhältnis zum (New) Hollywood-Kino betrachtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen des New Hollywood-Kinos, der offenen Erzählformen, der Gesellschaftskritik und der Filmgeschichte im Kontext der Werke von Robert Altman. Die Analyse der Filme M*A*S*H, Nashville, The Player und Short Cuts wird anhand von Aspekten wie der Produktion, dem Inhalt, der Rezeption und der Bedeutung im filmgeschichtlichen Kontext betrieben. Zusätzliche Schlüsselbegriffe sind die Erzähltechnik von Altman, die Brechung von konventionellen Erzählstrukturen und die gesellschaftliche Relevanz seiner Filme.
- Citar trabajo
- Roman Seda (Autor), 2004, Hauptwerke der Filmgeschichte: Die Bedeutung der Filme "M*A*S*H", "Nashville", "The Player" und "Short Cuts" innerhalb eines filmgeschichtlichen Entwicklungsprozesses, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44167