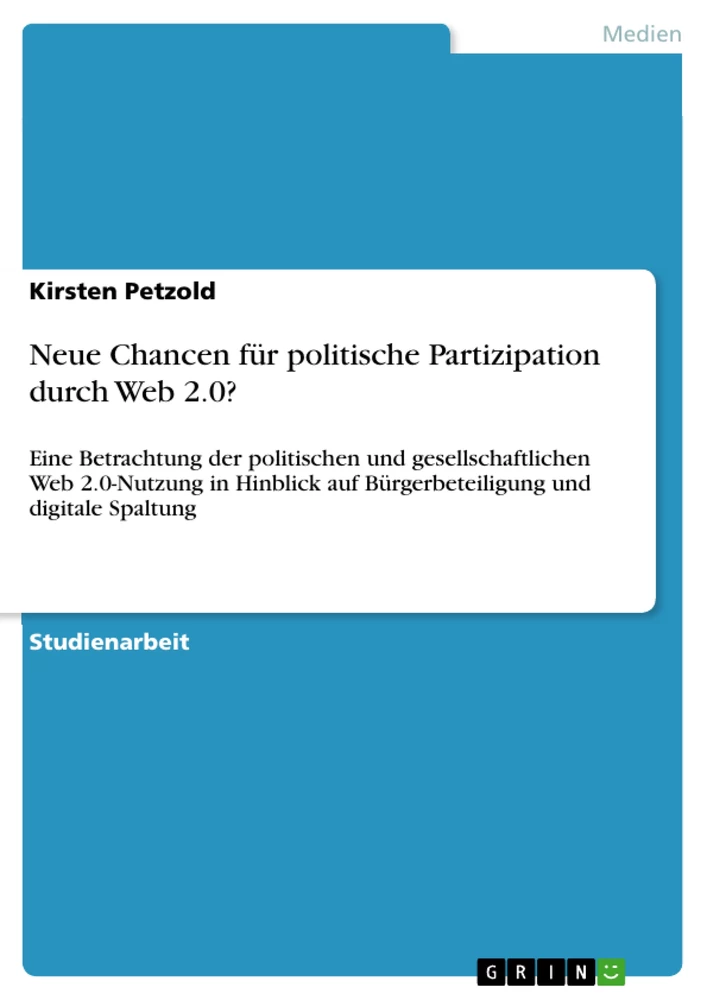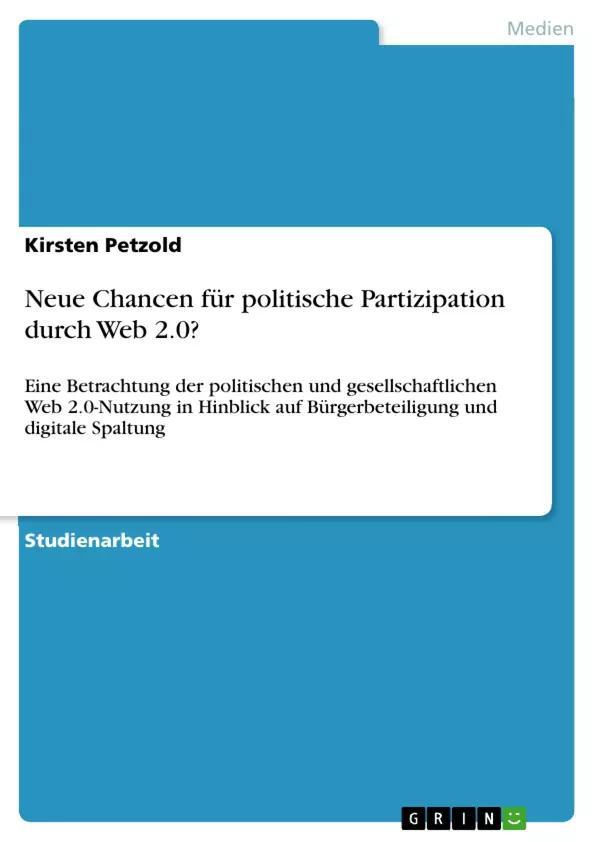Steckt unsere Demokratie in einer Krise? Bereits seit mehreren Jahren wird über zunehmende Politikverdrossenheit, vor allem unter jungen Wählern, diskutiert. Die Fakten sprechen dafür, dass die Politik nicht nur in dieser Zielgruppe einen schweren Stand hat: Die Wahlbeteiligung sinkt, traditionelle Bindungen zu politischen Milieus lösen sich auf, Parteien klagen über Mitgliederschwund. Ein immer größerer Teil der Bevölkerung ist nicht zufrieden damit, wie seine Interessen vertreten werden. Dies birgt Risiken für eine stabile Demokratie – sind politische Repräsentanten in diesem System doch auf die Legitimation durch ihre Wähler angewiesen. Vor diesem Hintergrund ist das Internet in den letzten Jahren Gegenstand vieler Hoffnungen in Bezug auf die Belebung des demokratischen Systems gewesen. Die Entwicklung immer neuer Mitmach-Angebote, zusammengefasst unter dem Schlagwort Web 2.0, hat diese Hoffnungen zusätzlich befeuert. So hat gerade innerhalb des letzten Jahres der neu gewählte US-Präsident Barack Obama gezeigt, wie man diese Technologien nutzen kann, um Anhänger zu mobilisieren und langfristig an sich zu binden.
Doch die Angebote des Web 2.0 haben sich noch nicht in breiten gesellschaftlichen Schichten durchgesetzt. Zwischen Nutzern des Web 2.0 und anderen Onlinern zeigen sich deutliche soziodemografische Unterschiede: Web 2.0-Nutzer sind demnach jünger, höher gebildet und verfügen über eine höhere finanzielle Ausstattung. Schon geht die Sorge von einer Vergrößerung der Kluft zwischen beiden Gruppen um. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob sich durch Web 2.0-Angebote neue Chancen für politische Partizipation bieten oder ob sich dadurch im Gegenteil das Problem der Digital Divide weiter vergrößert.
Diese Arbeit gliedert sich in drei Teile: Zunächst sollen die Hoffnungen, die in Bezug auf die Belebung der Demokratie in das Internet und speziell das Web 2.0 gesetzt werden, sowie die sich daraus ergebenden Probleme beschrieben werden. In einem zweiten Teil werden die spezifischen Charakteristika des Web 2.0 und dessen aktuelle Nutzung betrachtet. Außerdem soll auf das Problem der Digital Divide eingegangen werden. Der dritte Teil befasst sich mit aktuellen Formen der Nutzung des Web 2.0 durch die Politik und durch zivilgesellschaftliche Akteure. Zum Schluss soll in einem kurzen Fazit eine Antwort auf die leitende Fragestellung dieser Arbeit gefunden werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Neue Partizipationsmöglichkeiten durch das Internet?
- Die,,Krise\" des demokratischen Systems
- Internet als Chance für mehr politische Partizipation
- Elektronische Demokratie
- Web 2.0 - Begriffsbestimmung und Nutzungsweise
- Der Begriff Web 2.0
- Die Nutzung des Web 2.0
- Digital Divide als Problem für die politische Internetnutzung
- Die Nutzung von Web 2.0-Angeboten zur Steigerung politischer Partizipation
- Die Nutzung von Web 2.0-Angeboten durch die Politik
- Die Nutzung,,konventioneller“ Internetangebote
- Die Nutzung,,klassischer\" Web 2.0-Angebote
- Chancen und Probleme der Web 2.0-Nutzung durch die Politik
- Die Nutzung von Web 2.0-Angeboten durch gesellschaftliche Gruppen
- Die Nutzung alternativer Online-Medien
- Die Nutzung anderer Web 2.0-Angebote
- Chancen und Probleme der Web 2.0-Nutzung durch gesellschaftliche Gruppen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Potenziale von Web 2.0-Angeboten für die politische Partizipation. Sie beleuchtet sowohl die Hoffnungen, die in diesen neuen Technologien liegen, als auch die Herausforderungen, die sich daraus ergeben können, insbesondere im Kontext des Digital Divide.
- Politische Partizipation im digitalen Zeitalter
- Das Web 2.0 als Instrument der politischen Partizipation
- Die Rolle des Digital Divide in der politischen Nutzung des Internets
- Chancen und Risiken der Web 2.0-Nutzung für die politische Partizipation
- Analyse der Nutzung von Web 2.0-Angeboten durch Politik und Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die aktuelle Debatte um die „Krise“ des demokratischen Systems und die damit verbundenen Herausforderungen. Dabei werden insbesondere die sinkende Wahlbeteiligung und die zunehmende Politikverdrossenheit thematisiert. Das Internet wird als mögliche Lösung für diese Probleme vorgestellt, wobei insbesondere das Potenzial von Web 2.0-Anwendungen hervorgehoben wird.
Im zweiten Kapitel wird der Begriff Web 2.0 definiert und die Nutzung dieser neuen Technologien beleuchtet. Dabei wird auch auf das Problem des Digital Divide eingegangen, das die politische Internetnutzung stark beeinflussen kann.
Kapitel drei analysiert die Nutzung von Web 2.0-Angeboten durch die Politik und gesellschaftliche Gruppen. Dabei werden sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen dieser neuen Technologien für die politische Partizipation diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema politische Partizipation im Kontext des Web 2.0. Zentrale Themen sind die Digital Divide, die Nutzung von Online-Plattformen durch Politik und Bürger sowie die Auswirkungen auf die demokratischen Prozesse. Weitere wichtige Begriffe sind Elektronische Demokratie, Cyber-Demokratie, Mobilisierungsthese, Verstärkungs- bzw. Reinforcementthese und die verschiedenen Formen der politischen Partizipation.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Digital Divide" im politischen Kontext?
Die Digital Divide beschreibt die Kluft zwischen Menschen mit Zugang zu digitalen Technologien und solchen ohne. In der Politik besteht die Sorge, dass Web 2.0-Nutzer (oft jünger und gebildeter) mehr Einfluss gewinnen als Offline-Bürger.
Wie nutzen Politiker das Web 2.0 zur Mobilisierung?
Politiker nutzen soziale Medien und Mitmach-Angebote, um Anhänger direkt anzusprechen, sie langfristig zu binden und für Wahlen oder Kampagnen zu mobilisieren, wie es etwa Barack Obama erfolgreich tat.
Welche Risiken birgt das Internet für die Demokratie?
Neben der Digital Divide besteht das Risiko, dass traditionelle politische Bindungen erodieren und die politische Partizipation nur in bestimmten sozialen Schichten zunimmt, was die Legitimation des Systems gefährden könnte.
Was ist der Unterschied zwischen konventionellen Internetangeboten und Web 2.0 in der Politik?
Konventionelle Angebote dienen meist der reinen Information, während Web 2.0-Angebote den Dialog, die Interaktion und die aktive Beteiligung der Bürger ermöglichen.
Was versteht man unter "Elektronischer Demokratie"?
Elektronische Demokratie (oder Cyber-Demokratie) nutzt Informations- und Kommunikationstechnologien, um demokratische Prozesse wie Wahlen, Debatten und die Teilhabe der Bürger zu unterstützen und zu beleben.
Fördert das Web 2.0 die politische Partizipation tatsächlich?
Das Web 2.0 bietet neue Chancen zur Beteiligung, doch ob es die allgemeine Politikverdrossenheit löst oder nur bestehende Strukturen verstärkt (Reinforcement-These), ist Gegenstand wissenschaftlicher Debatten.
- Quote paper
- Kirsten Petzold (Author), 2009, Neue Chancen für politische Partizipation durch Web 2.0?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/441858