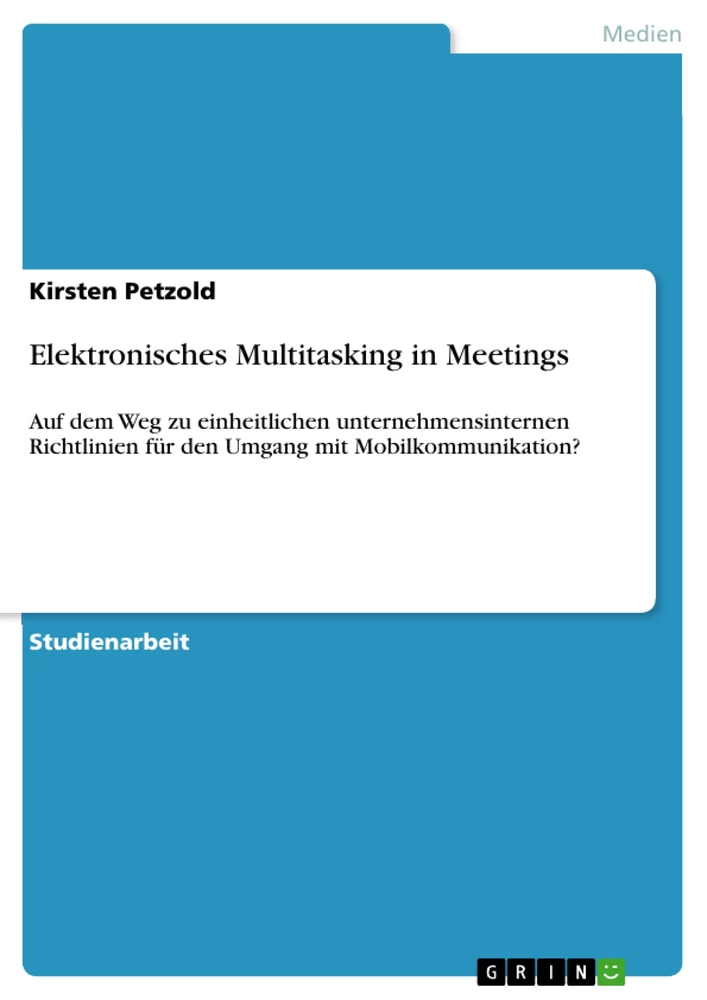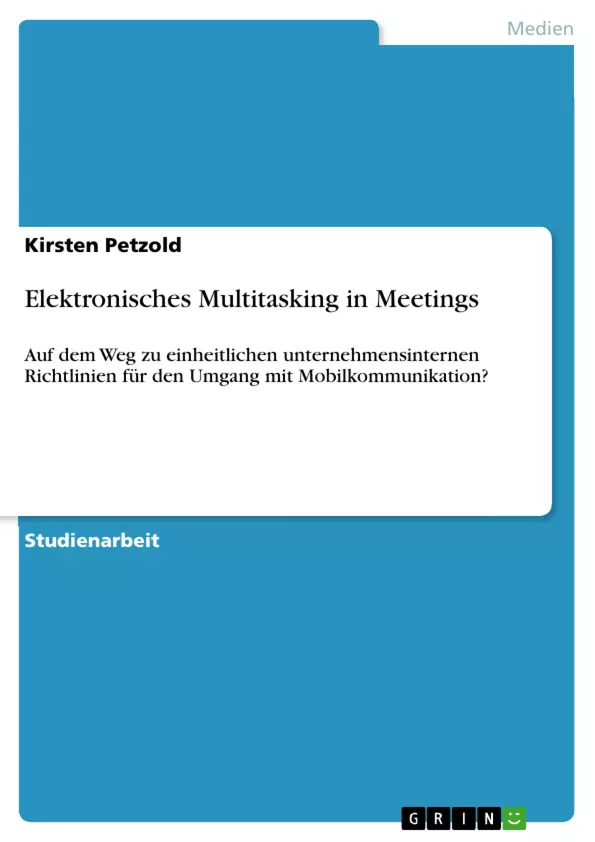Schon immer haben Medien eine Verbindung zwischen verschiedenen Orten – in der Regel jenen, an denen sich Sender und Empfänger einer Nachricht befinden – geschaffen. Dennoch blieb die Mediennutzung vor der Entwicklung mobiler Medien weitgehend statisch, d.h. eng mit dem lokalen, privaten Lebensumfeld der Nutzer verknüpft. Dies hat sich seit der Verbreitung des Mobiltelefons grundlegend verändert. Heutzutage können Handynutzer mit dem Medium mobil sein. Ihre Erreichbarkeit ist daher weniger an räumliche und zeitliche Strukturen geknüpft. Stattdessen können die Nutzer nahezu immer und überall Anrufe und Nachrichten empfangen. Dies bleibt jedoch nicht ohne Konsequenzen für die Interaktionen mit anderen physisch Anwesenden, denn diese Interaktionen können durch die Nutzung des Mobiltelefons unterbrochen werden. Handynutzer bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen verschiedenen Normen.
Diese Situationen finden sich jedoch nicht nur im Privatleben der Nutzer, sondern zunehmend auch in der Arbeitswelt. Immer mehr Beschäftigte werden von ihren Unternehmen mit mobilen Kommunikationstechnologien ausgestattet – ihnen wird somit signalisiert, dass von ihnen erwartet wird, für berufliche Angelegenheiten erreichbar zu sein. Was zum Beispiel auf Dienstreisen nützlich sein kann, erweist sich jedoch in anderen beruflichen Situationen als Herausforderung. Hierzu zählen zum Beispiel Meetings. Das Multitasking mittels mobiler Medien verletzt auch hier die soziale Interaktionsordnung. Doch wie entscheiden Beschäftigte, welches Verhalten in Hinblick auf Mobilkommunikation und Multitasking angebracht ist bzw. von ihnen erwartet wird? Und welche Rolle spielt dabei die Organisationskultur, d.h. die wahrgenommenen Normen und das beobachtete Verhalten anderer? Dies sind die leitenden Fragestellungen dieser Arbeit.
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil soll der Begriff Multitasking erklärt werden, außerdem werden unterschiedliche Typen von Multitasking vorgestellt. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen für die Beschäftigung mit Multitasking in Meetings. Im dritten Teil werden die bereits angesprochenen Studien von Stephens & Davis vorgestellt und ihre Ergebnisse in Hinblick auf die Frage nach der Notwendigkeit einheitlicher Unternehmensrichtlinien für die Nutzung von mobilen Medien diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff Multitasking
- Theoretische Grundlagen des Multitaskings in Meetings
- Veränderung räumlicher und zeitlicher Strukturen durch Multitasking
- Konsequenzen mobiler Kommunikation für die Interaktionen in Meetings
- Empirische Studien zum elektronischen Multitasking in Meetings
- ,The Social Influences on Electronic Multitasking in Organizational Meetings“
- „Electronic Multitasking in Meetings: A Challenge for Organizational Policy“
- Diskussion: Einheitliche Unternehmensrichtlinien zur Nutzung mobiler Medien?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Nutzung mobiler Kommunikationsmedien während Meetings und deren Auswirkungen auf die soziale Interaktionsordnung. Ziel ist es, die Herausforderungen des elektronischen Multitaskings in Meetings zu beleuchten und die Notwendigkeit einheitlicher Unternehmensrichtlinien für den Umgang mit Mobilkommunikation in diesem Kontext zu diskutieren.
- Begriffsbestimmung und verschiedene Formen des Multitaskings
- Theoretische Grundlagen des Multitaskings in Meetings
- Empirische Studien zum elektronischen Multitasking in Meetings
- Diskussion der Notwendigkeit einheitlicher Unternehmensrichtlinien
- Konsequenzen für die soziale Interaktionsordnung in Meetings
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Arbeit beleuchtet den Wandel der Mediennutzung durch mobile Kommunikation und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Interaktionsordnung, insbesondere in beruflichen Kontexten, wie z.B. Meetings.
- Kapitel 2: Der Begriff Multitasking: Es werden verschiedene Formen des Multitaskings, insbesondere kognitives und soziales Multitasking, definiert und ihre spezifischen Merkmale erläutert.
- Kapitel 3: Theoretische Grundlagen des Multitaskings in Meetings: Dieses Kapitel behandelt die Auswirkungen mobiler Kommunikation auf die räumliche und zeitliche Struktur von Meetings und analysiert die Folgen für die Interaktionen zwischen Teilnehmern.
- Kapitel 4: Empirische Studien zum elektronischen Multitasking in Meetings: Die Arbeit stellt zwei Studien von Stephens & Davis vor, die sich mit den sozialen Einflüssen des elektronischen Multitaskings in Meetings und den Herausforderungen für die Organisationspolitik auseinandersetzen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Multitasking, elektronisches Multitasking, mobile Kommunikation, Meetings, soziale Interaktion, Organisationskultur, Unternehmensrichtlinien und empirischer Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter elektronischem Multitasking in Meetings?
Es bezeichnet die gleichzeitige Nutzung mobiler Endgeräte (Smartphones, Laptops) für andere Aufgaben während einer laufenden Besprechung.
Wie beeinflusst die Organisationskultur das Multitasking-Verhalten?
Mitarbeiter orientieren sich an wahrgenommenen Normen und dem Verhalten von Vorgesetzten und Kollegen; wird Multitasking vorgelebt, wird es oft als akzeptabel angesehen.
Welche sozialen Konsequenzen hat Multitasking in Meetings?
Es verletzt die soziale Interaktionsordnung, da die Aufmerksamkeit geteilt ist, was von anderen Teilnehmern oft als unhöflich oder desinteressiert wahrgenommen wird.
Sind einheitliche Unternehmensrichtlinien für die Handynutzung sinnvoll?
Studien diskutieren dies als Herausforderung, da klare Regeln helfen können, Erwartungen zu klären und die Effizienz von Meetings zu steigern.
Was ist der Unterschied zwischen kognitivem und sozialem Multitasking?
Kognitives Multitasking bezieht sich auf die mentale Verarbeitung mehrerer Aufgaben, während soziales Multitasking die Interaktion mit physisch Abwesenden bei gleichzeitiger Anwesenheit in einer Gruppe beschreibt.
- Quote paper
- Kirsten Petzold (Author), 2010, Elektronisches Multitasking in Meetings, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/441862