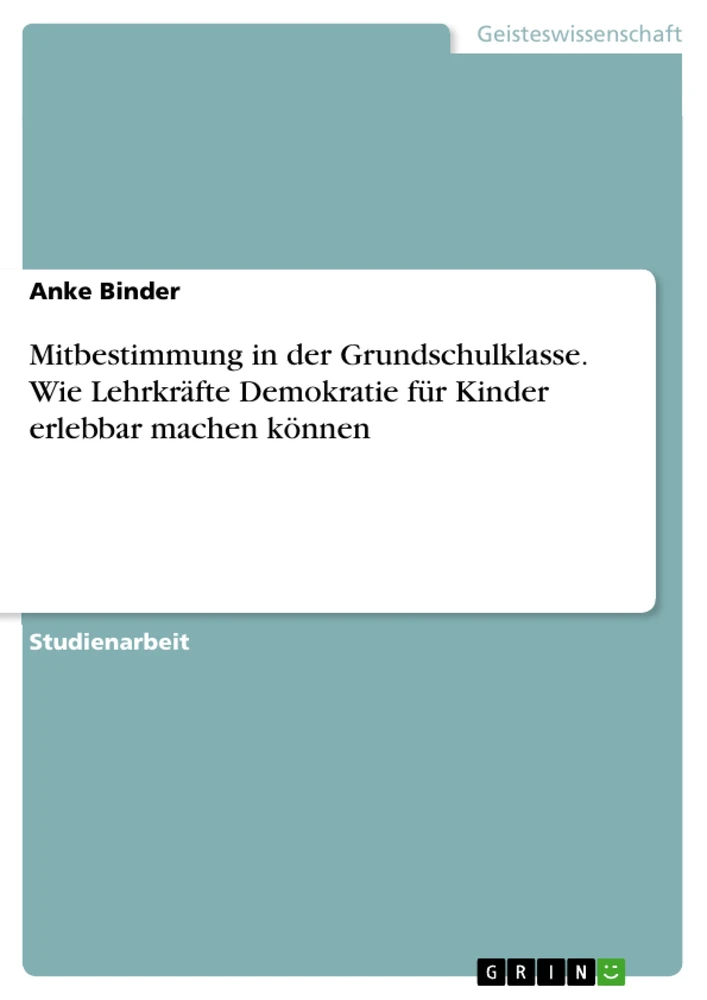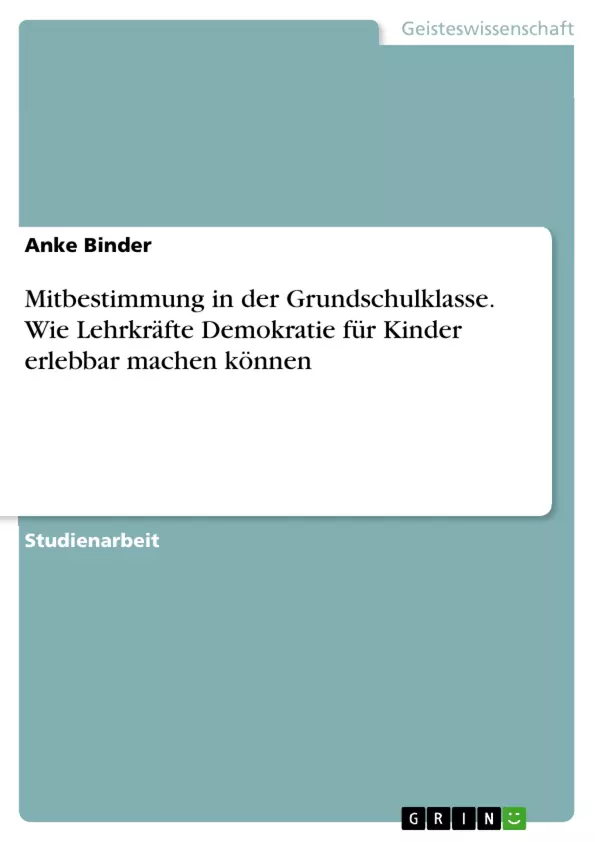Diese Hausarbeit gibt einen Überblick über Möglichkeiten der Mitbestimmung von Schüler*innen in der Grundschulklasse. Ausgehend von der Schule als Gewaltkontext soll erörtert werden, welche Möglichkeiten einzelne Lehrende haben, Demokratieerziehung als gelebte Mitbestimmung in der Regelschule einzubeziehen. Dabei werden gestaltbare Rahmenbedingungen, demokratische Unterrichtsformen und demokratische Institutionen der Kinder vorgestellt. Hierzu wurde Literatur zu theoretischen Konzepten der Pädagogik, zu gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und insbesondere zu konkreten Lern- und Mitbestimmungsformen ausgewertet. Die Hausarbeit ist vor allem für Studierende Grundschullehramt interessant, aber auch für alle an Demokratiepädagogik Interessierten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mitbestimmung als Demokratieerziehung
- Begriffsbestimmung
- Demokratische Kompetenzen
- Gewaltkontext Schule
- Mitbestimmung im Rahmen der Grundschulklasse
- Von Schüler*innen (mit)gestaltbare Rahmenbedingungen
- Demokratische Arbeitsweisen
- Demokratische Institutionen
- Rahmenbedingungen und Grundeinstellungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Möglichkeiten der Schülermitbestimmung in der Grundschule, um Demokratieerziehung als gelebte Praxis zu fördern. Sie analysiert den Gewaltkontext Schule und erörtert, wie Lehrkräfte trotz bestehender Herausforderungen demokratische Partizipation im Unterricht ermöglichen können. Die Arbeit fokussiert auf konkrete, umsetzbare Maßnahmen innerhalb einer einzelnen Grundschulklasse.
- Demokratieerziehung in der Grundschule
- Schülermitbestimmung als gelebte Demokratie
- Gewaltprävention durch Partizipation
- Gestaltung von Rahmenbedingungen für Mitbestimmung
- Demokratische Unterrichtsmethoden und -institutionen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Relevanz von Demokratieerziehung im Kontext gesellschaftlicher Politikverdrossenheit und der begrenzten Rezeption von John Deweys Werk. Sie betont die Notwendigkeit, Kindern demokratische Partizipation bereits in der Grundschule zu ermöglichen und verweist auf die UN-Kinderrechtskonvention als Grundlage für das Recht der Kinder auf Mitbestimmung. Die Arbeit fokussiert darauf, konkrete Möglichkeiten der Mitbestimmung in der Grundschulklasse aufzuzeigen, ohne umfassende Schulreformen vorauszusetzen. Der Bezug zu Oscar Wilde und Paulo Freire unterstreicht die Bedeutung von Kinderrechten und dem Respekt vor der Autonomie jedes Kindes.
Mitbestimmung als Demokratieerziehung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Mitbestimmung im Kontext von Demokratieerziehung und beschreibt die damit verbundenen demokratischen Kompetenzen, die Kinder erwerben können. Es legt den theoretischen Grundstein für die praktischen Vorschläge der folgenden Kapitel und betont die Bedeutung von Partizipation für die Entwicklung von Kindern zu mündigen Bürgern. Der Abschnitt dient als theoretische Grundlage für die folgenden Kapitel, die sich mit der praktischen Umsetzung beschäftigen.
Gewaltkontext Schule: Dieses Kapitel analysiert die Schule als einen potenziellen Gewaltkontext und beleuchtet die Herausforderungen, die dies für die Implementierung von Demokratieerziehung darstellt. Es argumentiert, dass gerade in solchen Kontexten Partizipation und Mitbestimmung als wichtige Instrumente der Gewaltprävention und der Stärkung von demokratischen Werten dienen können. Es liefert somit den Kontext für die nachfolgenden Kapitel, die sich mit praktischen Lösungen befassen.
Mitbestimmung im Rahmen der Grundschulklasse: Dieses Kapitel stellt konkrete Möglichkeiten der Mitbestimmung in der Grundschulklasse vor. Es unterteilt sich in die Bereiche gestaltbare Rahmenbedingungen, demokratische Arbeitsweisen und demokratische Institutionen, die alle Möglichkeiten zur Schülerpartizipation bieten. Es bietet detaillierte Beispiele für die praktische Umsetzung und betont, wie diese Maßnahmen zum Erlernen demokratischer Kompetenzen beitragen können. Der Fokus liegt auf der Umsetzbarkeit der Vorschläge im Schulalltag.
Schlüsselwörter
Demokratieerziehung, Schülermitbestimmung, Grundschule, Partizipation, Gewaltprävention, demokratische Kompetenzen, UN-Kinderrechtskonvention, Mitspracherecht, demokratische Unterrichtsmethoden, Rahmenbedingungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Mitbestimmung in der Grundschule als Demokratieerziehung
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht Möglichkeiten der Schülermitbestimmung in der Grundschule, um Demokratieerziehung als gelebte Praxis zu fördern. Sie analysiert den Gewaltkontext Schule und erörtert, wie Lehrkräfte trotz bestehender Herausforderungen demokratische Partizipation im Unterricht ermöglichen können. Der Fokus liegt auf konkreten, umsetzbaren Maßnahmen innerhalb einer einzelnen Grundschulklasse.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Demokratieerziehung in der Grundschule, Schülermitbestimmung als gelebte Demokratie, Gewaltprävention durch Partizipation, Gestaltung von Rahmenbedingungen für Mitbestimmung, demokratische Unterrichtsmethoden und -institutionen. Es werden theoretische Grundlagen gelegt und konkrete praktische Beispiele für die Umsetzung in der Grundschulklasse gegeben.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit ist in Kapitel unterteilt: Einleitung, Mitbestimmung als Demokratieerziehung (inkl. Begriffsbestimmung und demokratischer Kompetenzen), Gewaltkontext Schule, Mitbestimmung im Rahmen der Grundschulklasse (inkl. gestaltbarer Rahmenbedingungen, demokratischer Arbeitsweisen und Institutionen sowie Rahmenbedingungen und Grundeinstellungen) und Fazit. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Welche konkreten Beispiele für Mitbestimmung werden genannt?
Die Hausarbeit nennt konkrete, umsetzbare Beispiele für Mitbestimmung in der Grundschulklasse. Diese Beispiele beziehen sich auf gestaltbare Rahmenbedingungen, demokratische Arbeitsweisen und demokratische Institutionen. Die genauen Beispiele werden im Kapitel "Mitbestimmung im Rahmen der Grundschulklasse" detailliert beschrieben.
Welche Rolle spielt der Gewaltkontext Schule?
Die Hausarbeit analysiert den Gewaltkontext Schule als Herausforderung für die Implementierung von Demokratieerziehung. Sie argumentiert, dass Partizipation und Mitbestimmung in solchen Kontexten wichtige Instrumente der Gewaltprävention und der Stärkung demokratischer Werte darstellen.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Hausarbeit bezieht sich auf die UN-Kinderrechtskonvention als Grundlage für das Recht der Kinder auf Mitbestimmung. Sie diskutiert auch die Bedeutung von Kinderrechten und dem Respekt vor der Autonomie jedes Kindes, unter anderem mit Bezug auf Oscar Wilde und Paulo Freire. Der theoretische Teil legt den Grundstein für die praktischen Vorschläge.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Demokratieerziehung, Schülermitbestimmung, Grundschule, Partizipation, Gewaltprävention, demokratische Kompetenzen, UN-Kinderrechtskonvention, Mitspracherecht, demokratische Unterrichtsmethoden, Rahmenbedingungen.
Was ist das Fazit der Hausarbeit?
(Das Fazit ist nicht explizit im bereitgestellten Text enthalten, aber es kann angenommen werden, dass es die Wirksamkeit und Umsetzbarkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Förderung von Schülermitbestimmung und Demokratieerziehung in der Grundschule zusammenfasst.)
- Arbeit zitieren
- Anke Binder (Autor:in), 2017, Mitbestimmung in der Grundschulklasse. Wie Lehrkräfte Demokratie für Kinder erlebbar machen können, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/441885