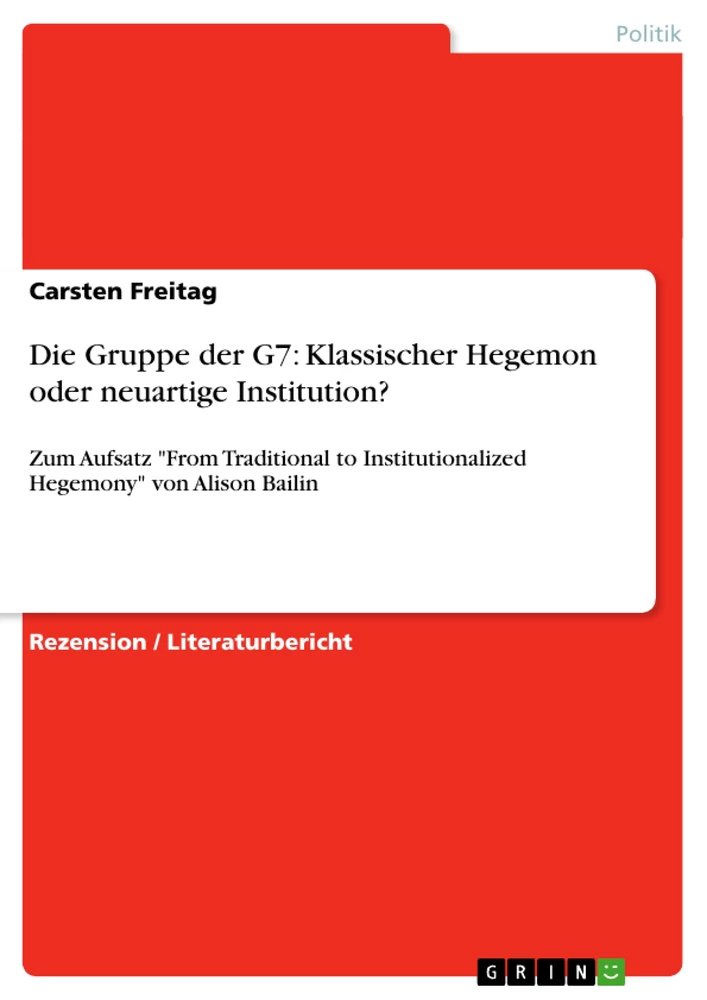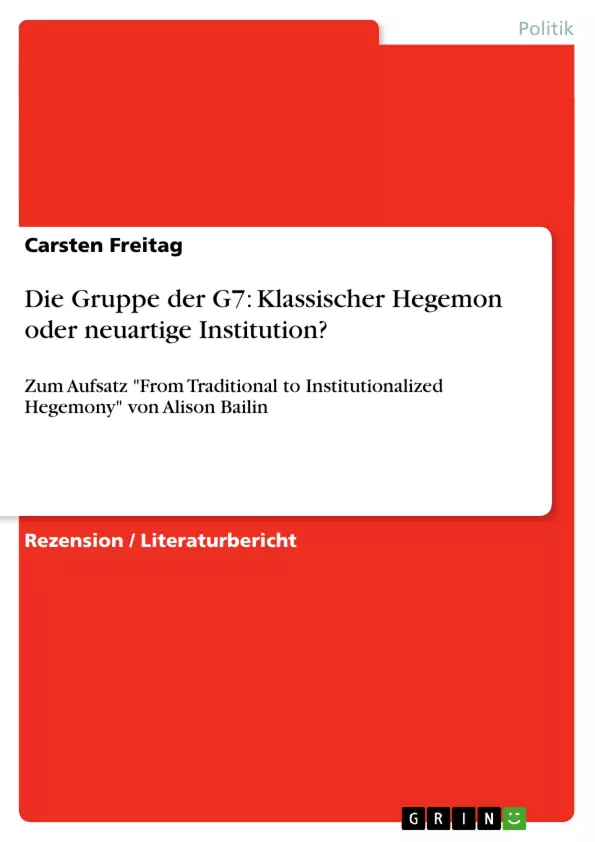Dieser Literaturbericht beschäftigt sich mit dem Aufsatz „From Traditional to Institutionalized Hegemony“ von Alison Bailin. Die hier verwendete Version ist vom Februar 2001 und stammt von der G8-Website der Universität von Toronto. Dr. Alison Bailin forscht derzeit an der Universität von Toronto mit der G8 Forschungsgruppe.
In einer von Globalisierung gekennzeichneten Welt stellt die Gruppe der sieben führenden Industrienationen (G7), mit den jährlichen Weltwirtschaftsgipfeln, eine Besonderheit dar. Die Besonderheit liegt zum einen in dem selbstgewählten Anspruch die globalisierte Weltwirtschaft zu steuern und auftretende Krisen zum eigenen Nutzen zu bewältigen. Zum anderen liegt sie in dem betont informellen Gefüge der Gruppe der G7.
Die Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Japan bilden heute die G7. Weiterhin gehört Russland zur Gruppe der G8, es besitzt jedoch kein Stimmrecht. Auf den Weltwirtschaftsgipfeln werden unterschiedliche Themen behandelt wie z.B. gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Währungspolitik, Welthandel, Energiepolitik, Nord-Süd-Probleme u.a.
Bei der Betrachtung dieser Tatsachen stellen sich viele Fragen. Wieso bilden gerade diese Staaten heutzutage die G7? Worauf gründet sich die Macht einer Gruppe von Staaten die sich absichtlich kein umfassendes formelles Gefüge geben will? Besonders interessant ist in Anbetracht dieser speziellen Voraussetzungen die Frage was die G7 eigentlich darstellt und wie es funktioniert.
Alison Bailin versucht in dem vorliegenden Beitrag eine Antwort auf diese letzte Frage zu geben. Dabei nutzt die Autorin die traditionelle intergouvernementale Hegemonietheorie und die Institutionalismustheorie als Ausgangspunkt für ihre Argumentation.
Dieser Literaturbericht versucht nun die Argumentation der Autorin kritisch nachzuvollziehen. Besonders interessant ist hier die methodische Herangehensweise an das Problem, sowie die Plausibilität der These. Die Gliederung orientiert sich daher am Aufbau des Beitrags.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Fragestellung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Theoretische Ausgangslage
- 2.2 Institutionalisierte Hegemonie als neues Konstrukt
- 2.2.1 Globale Machtkonzentration
- 2.2.2 Gruppenidentität
- 2.2.3 Kapitalistische Demokratien
- 2.2.4 Der Vorbereitungsprozess
- 2.2.5 Ein System der Interaktion zwischen Großmächten
- 2.2.6 Die Dokumentation
- 2.3 Die G7. Eine institutionelle Hegemonie?
- 3. Bewertung / Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Literaturbericht analysiert Alison Bailins Aufsatz "From Traditional to Institutionalized Hegemony" und untersucht die Funktionsweise der G7. Ziel ist es, die Argumentation Bailins kritisch zu prüfen und die Plausibilität ihrer These zu bewerten, insbesondere im Hinblick auf die methodische Herangehensweise.
- Die traditionelle Hegemonietheorie und ihre Grenzen
- Die neoliberale Institutionalismustheorie und ihre Schwächen
- Das Konzept der institutionalisierten Hegemonie als Synthese beider Theorien
- Die Rolle der G7 im Kontext globaler Wirtschaftspolitik
- Kooperation und Machtverhältnisse innerhalb der G7
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Fragestellung: Der Bericht untersucht Alison Bailins Aufsatz über die G7 und deren Funktion als "institutionalisierte Hegemonie". Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der Natur und Funktionsweise der G7 in einer globalisierten Welt, in der die USA nicht mehr die alleinige hegemoniale Macht darstellen. Der Bericht analysiert Bailins Ansatz, der die traditionelle Hegemonietheorie und den neoliberalen Institutionalismus als Ausgangspunkt nutzt. Die Fragestellung fokussiert sich auf die methodische Herangehensweise und die Plausibilität von Bailins These.
2. Hauptteil: Dieser Teil analysiert die theoretischen Grundlagen von Bailins Argumentation. Zunächst werden die traditionellen Hegemonietheorie und die neoliberale Institutionalismustheorie vorgestellt, mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen bezüglich der Erklärung des G7-Modells. Bailin zeigt auf, dass weder die alleinige Überlegenheit einer Hegemonialmacht (USA) noch ein rein institutioneller Ansatz die Funktionsweise der G7 ausreichend erklären. Im Kern des Hauptteils wird Bailins Konzept der "institutionalisierten Hegemonie" eingeführt, welche die Stärken beider Theorien vereint und eine Erklärung für die Kooperation der G7-Staaten bietet, indem es die gemeinsame Ausübung hegemonialer Kapazitäten durch die Gruppe betont. Der Abschnitt beleuchtet die institutionellen Arrangements, die diese Kooperation ermöglichen.
Schlüsselwörter
G7, Hegemonie, Institutionalisierte Hegemonie, Internationale Politik, Weltwirtschaft, Globalisierung, Kooperation, Institutionen, Neoliberaler Institutionalismus, Machtverteilung.
Häufig gestellte Fragen zu "From Traditional to Institutionalized Hegemony" - Literaturbericht
Was ist der Gegenstand dieses Literaturberichts?
Dieser Literaturbericht analysiert den Aufsatz "From Traditional to Institutionalized Hegemony" von Alison Bailin und untersucht die Funktionsweise der G7-Staaten. Der Fokus liegt auf der kritischen Prüfung von Bailins Argumentation und der Bewertung der Plausibilität ihrer These zur "institutionalisierten Hegemonie".
Welche zentralen Fragen werden behandelt?
Der Bericht beleuchtet die Grenzen der traditionellen Hegemonietheorie und des neoliberalen Institutionalismus bei der Erklärung der G7. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob und wie das Konzept der "institutionalisierten Hegemonie" diese Grenzen überwindet und die Kooperation und Machtverhältnisse innerhalb der G7 adäquat beschreibt. Die methodische Herangehensweise Bailins wird ebenfalls kritisch hinterfragt.
Welche Theorien werden im Bericht diskutiert?
Der Bericht vergleicht und kontrastiert die traditionelle Hegemonietheorie und den neoliberalen Institutionalismus. Im Kern steht Bailins Konzept der "institutionalisierten Hegemonie", das als Synthese beider Ansätze verstanden wird und die gemeinsame Ausübung hegemonialer Kapazitäten durch die G7-Staaten betont.
Wie ist der Bericht strukturiert?
Der Bericht gliedert sich in eine Einleitung mit Fragestellung, einen Hauptteil mit theoretischer Ausgangslage und Analyse der G7 im Kontext der institutionalisierten Hegemonie, sowie eine Schlussbetrachtung/Bewertung. Der Hauptteil unterteilt sich in die Darstellung der traditionellen Hegemonietheorie und des neoliberalen Institutionalismus, die Einführung des Konzepts der institutionalisierten Hegemonie und eine detaillierte Analyse der G7 im Lichte dieser Theorie.
Welche Schlüsselkonzepte werden behandelt?
Schlüsselkonzepte umfassen die G7, Hegemonie, institutionalisierte Hegemonie, internationale Politik, Weltwirtschaft, Globalisierung, Kooperation, Institutionen, neoliberaler Institutionalismus und Machtverteilung.
Was ist das Fazit des Berichts (vorläufig)?
Ein vollständiges Fazit ist dem Bericht nicht explizit zu entnehmen. Der Bericht zielt darauf ab, Bailins Argumentation kritisch zu untersuchen und die Plausibilität ihres Konzepts der institutionalisierten Hegemonie im Hinblick auf die G7 zu bewerten. Die Schlussbetrachtung wird die Ergebnisse dieser Analyse zusammenfassen und bewerten.
Welche Kapitel umfasst der Bericht?
Der Bericht ist in drei Kapitel gegliedert: Einleitung und Fragestellung, Hauptteil (mit Unterkapiteln zur theoretischen Ausgangslage, institutionalisierten Hegemonie und der Analyse der G7) und Bewertung/Schlussbetrachtung.
Für wen ist dieser Bericht gedacht?
Der Bericht richtet sich an Leser, die sich mit internationaler Politik, Globalisierung und den Machtstrukturen in der Weltwirtschaft auseinandersetzen. Er ist insbesondere für Personen relevant, die sich für die Funktionsweise der G7 und die Anwendung verschiedener theoretischer Ansätze auf internationale Organisationen interessieren.
- Arbeit zitieren
- Carsten Freitag (Autor:in), 2002, Die Gruppe der G7: Klassischer Hegemon oder neuartige Institution?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44200