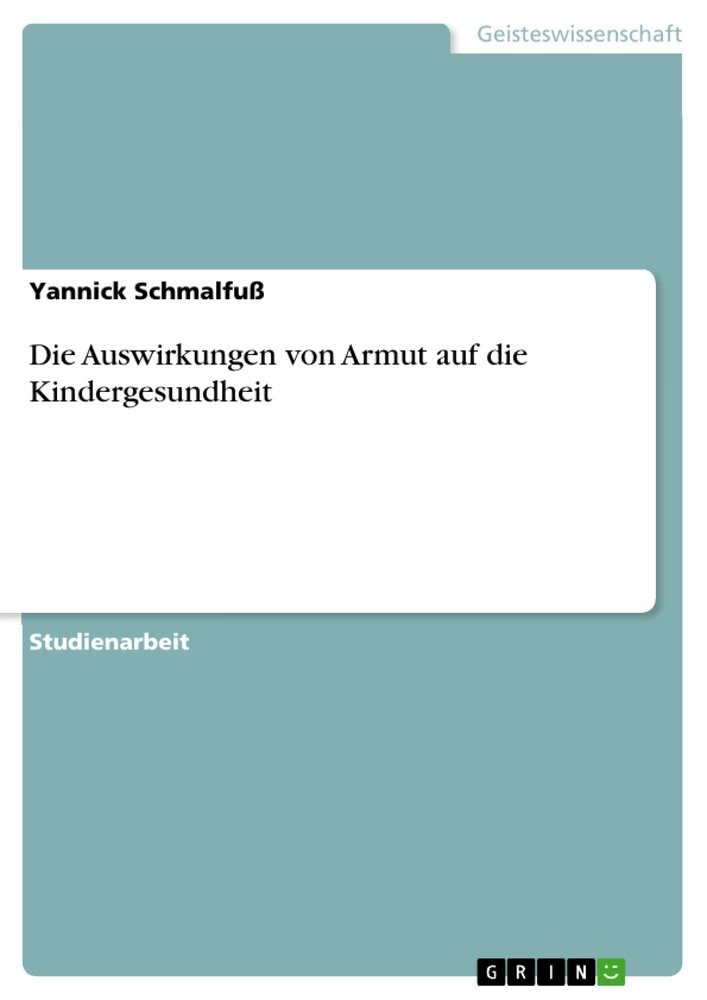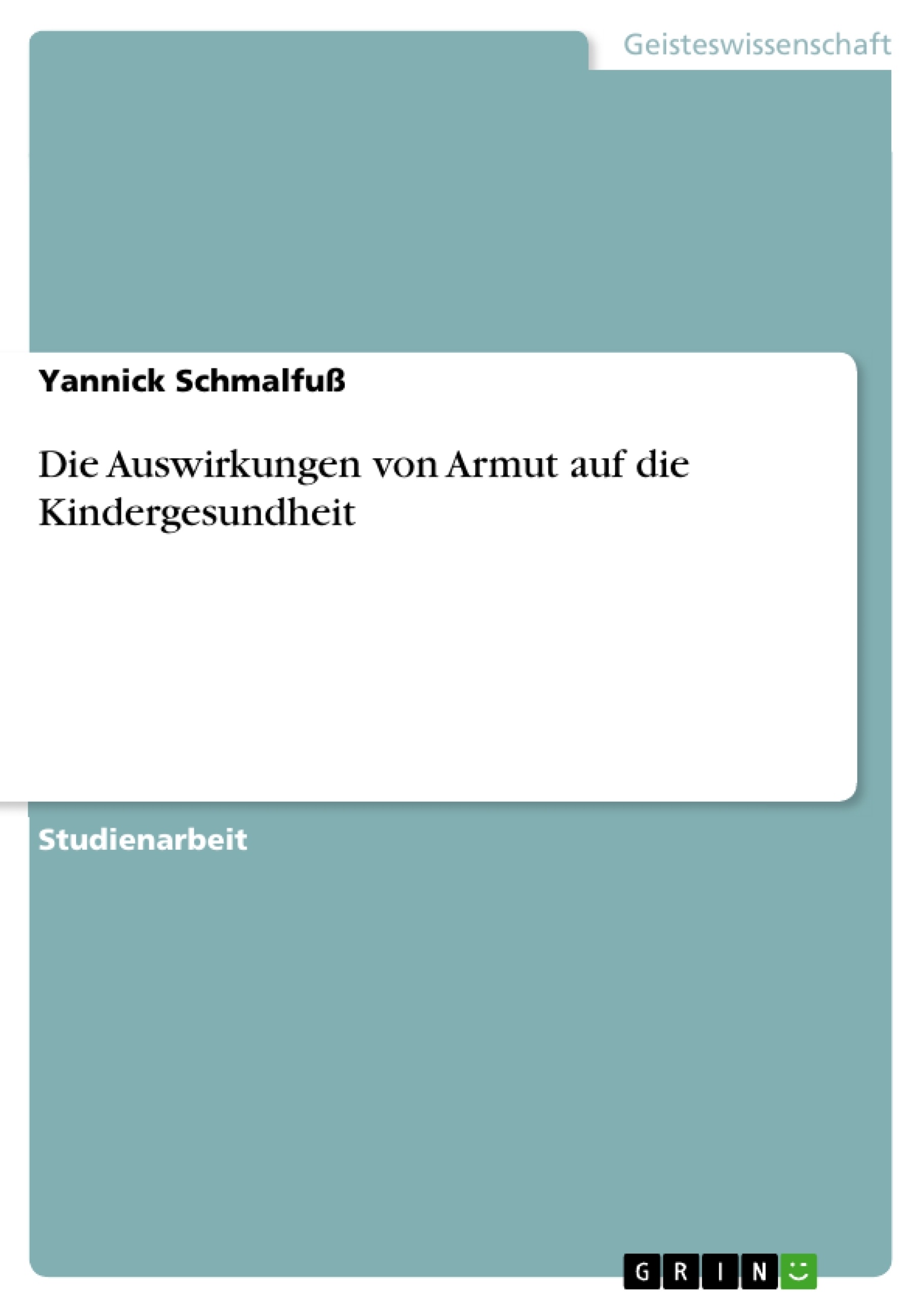Den Entschluss meiner Studienarbeit den Titel „Auswirkungen von Armut auf die Kindergesundheit“ zu geben, fasste ich bei einem interessanten Zitat über die Welt. Ein chinesischer Philosoph Namens Laotse sagte einmal: „Betrachte die Welt als dein Selbst, habe Vertrauen zum Sosein der Dinge, liebe die Welt als dein Selbst; dann kannst du dich um alle Dinge kümmern (Laotse).“
Dieses Zitat ist ein Gedanke der uns Menschen in Verbindung zur Armut eine andere Welt vorlebt als die Jetzige. Das Ausmaß von Kinderarmut in Deutschland, besonders in fernöstlichen Ländern ist alarmierend. Ein Aufwachsen in Armut ist eine schwere Hypothek, mit der Kinder ihr Leben starten. Diese Zielgruppe erlebt einen Zustand der Unterversorgung, Vernachlässigung, Risikoinkaufnahmen und Gesundheitsgefährdung. Die eigene Kraft reicht nicht aus um sich selbst aus dieser prekären familiären Lebenslage zu befreien. Sie bemerken jedoch die Hilflosigkeit und die extremen Folgen im späteren Leben. Mit der Armut kommen die schlechteren Bildungschancen, die gesundheitliche Beeinträchtigung und ein geringeres psychischen Wohlbefinden.
Dieser verkehrlichen Situation möchte ich entgegenwirken. Für mich stellt sich immer die kuriose Frage, Ist es wirklich so prägnant? Mit dieser Arbeit möchte ich zu verstehen geben, was für ein Ausmaß die Thematik Armut umfasst und in wieweit sich der „Virus-Armut“ schon in unsere Gesellschaft eingenistet hat. Im ersten Teil der Arbeit befasse ich mich mit dem Begriff Armut und versuche die aktuelle Situation und ihr gewaltiges Ausmaß zu veranschaulichen. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden Verhaltensweisen bei Grundschülern und Vorschulkindern genauer beleuchtet. Im 3. Punkt „Kindergesundheit“ werden Gesundheitliche Faktoren und ihre Funktion im Bereich der Armut beschrieben. Zu guter Letzt werden auch präventive Maßnahmen vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Armut?
- Versuch zu einer Begriffsdefinition von Armut.
- Welche Dimensionen umfasst Armut bei Kindern?
- Armutserfahrungen im Vorschulalter
- Armutserfahrungen im Grundschulalter...
- Kindergesundheit
- Gesundheit in Gefahr?
- Hygiene
- Ernährung
- Fehlende Aufklärung über „gesund leben“
- Voraussetzungen des Schulsettings..........\li>
- Möglichkeiten zur Bewegung
- Gesundheitsförderung..
- Das Schulprogramm der Fridtjof-Nansen-Schule.......
- Folgerungen für pädagogisches und soziales Handeln
- Fazit...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studienarbeit „Die Auswirkungen von Armut auf die Kindergesundheit“ befasst sich mit den Herausforderungen, die Armut für die körperliche und geistige Entwicklung von Kindern darstellt. Sie analysiert die Auswirkungen von Armut auf die Kindergesundheit und untersucht, wie Armutserfahrungen das Leben von Kindern beeinflussen.
- Definition von Armut und ihre Auswirkungen auf Kinder
- Gesundheitsrisiken, die mit Armut verbunden sind
- Einfluss von Armut auf die Bildungschancen
- Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung und Armutsbekämpfung
- Pädagogische und soziale Handlungsoptionen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung erläutert die Motivation für die Studie und stellt die Relevanz von Kinderarmut in Deutschland und anderen Ländern dar. Sie hebt die Folgen von Armut für Kinder hervor, wie Unterversorgung, Vernachlässigung und Gesundheitsgefährdung.
- Was ist Armut?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Armut und versucht die aktuelle Situation und das Ausmaß der Armut in der Gesellschaft zu veranschaulichen.
- Kindergesundheit: Dieses Kapitel widmet sich der Betrachtung der Gesundheit von Kindern im Kontext von Armut. Es analysiert die gesundheitlichen Risiken, die mit Armut verbunden sind, wie z. B. Hygiene, Ernährung und fehlende Aufklärung über gesunde Lebensweise.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Armut, Kindergesundheit, Bildungschancen, Gesundheitsförderung, soziale Ungleichheit, präventive Maßnahmen und pädagogisches Handeln. Die Studie fokussiert auf die Verbindung von Armut und ihren Auswirkungen auf die gesundheitliche Entwicklung von Kindern.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich Armut auf die Gesundheit von Kindern aus?
Armut führt oft zu einer Unterversorgung in den Bereichen Ernährung und Hygiene sowie zu einem erhöhten Risiko für psychische Belastungen und chronische Krankheiten.
Welche Rolle spielt die Bildung bei Kinderarmut?
Armut schränkt die Bildungschancen massiv ein, da betroffene Kinder oft weniger Unterstützung erhalten und familiäre Belastungen den schulischen Erfolg erschweren.
Was sind typische Armutserfahrungen im Grundschulalter?
Dazu gehören soziale Ausgrenzung, fehlende Mittel für Schulmaterialien oder Freizeitaktivitäten sowie die Wahrnehmung der elterlichen Hilflosigkeit.
Wie kann das Schulsetting die Gesundheit fördern?
Durch Programme wie an der Fridtjof-Nansen-Schule können Schulen Möglichkeiten für Bewegung, gesunde Ernährung und Aufklärung über einen gesunden Lebensstil bieten.
Welche präventiven Maßnahmen sind gegen den "Virus Armut" wirksam?
Wirksam sind integrierte soziale und pädagogische Handlungsoptionen, die frühzeitig ansetzen, um die Auswirkungen prekärer Lebenslagen abzufedern.
- Arbeit zitieren
- Yannick Schmalfuß (Autor:in), 2018, Die Auswirkungen von Armut auf die Kindergesundheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/442010